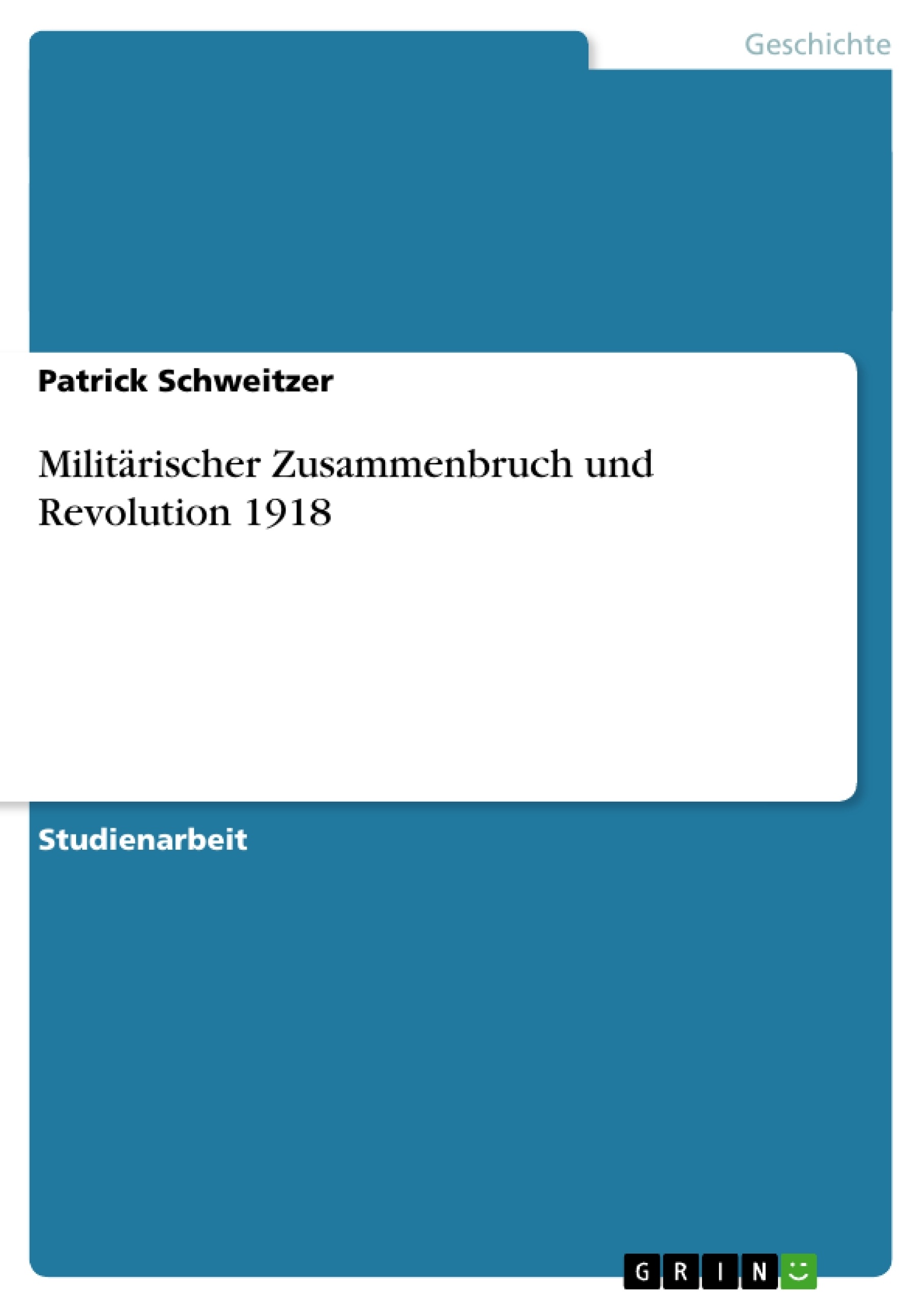„Der deutsche Zusammenbruch 1918 war historisch einzigartig nicht nur seiner unerwarteten Plötzlichkeit wegen, sondern weil nie zuvor eine Nation die Waffen gestreckt hatte, deren Armeen so tief in Feindesland standen", schrieb Wolfgang Schivelbusch in seinem Werk über die "Kultur der Niederlage".
Welche Ursachen waren verantwortlich für diesen „einzigartigen“ Zusammenbruch? Erfolgte er wirklich in unerwarteter Plötzlichkeit oder war der Zusammenbruch nur der Kulminationspunkt einer Entwicklung, deren Ursachen tief in den Mißständen des wilhelminischen Staatskörpers verortet waren? In der älteren Forschung wurde Ludendorffs Entschluß zur Offensiven Kriegführung im Jahre 1918, welcher in Konsequenz zur Überspannung der deutschen Kräfte führte, als Hauptursache heraus gearbeitet. Kontroversen existierten lediglich in Umfang und Einfluß der Überspannung auf die Truppe. Die erste Hauptrichtung, als deren Exponent z.B. Gerhard Ritter gelten kann, konstatierte bereits für den Mai 1918 erste Anzeichen für die Überspannung und damit ein Nachlassen der Kampfkraft. Als Indikator galten für ihn die zunehmende Meuterei bei Transporten, steigende Desertionszahlen und die nachlassende Widerstandskraft einiger Heeresverbände. Die zweite Hauptrichtung, namentlich z.B. durch Karl Dietrich Erdmann vertreten, erkannte ein wirkliches Nachlassen der Kampfkraft erst nach dem 8.8.1918. Erdmann sah dennoch im Heer bis zu seiner Demobilisierung einen festgefügten Verband. Er schrieb: „Aber bis zum letzten Tag war die Fronttruppe im Kampf fest in der Hand ihrer Führer. Das deutsche Heer insgesamt blieb bis zu seiner Demobilisierung festgefügt.“ Die genaue Klärung der Ursachen gestaltet sich schwierig, da ein Großteil der Akten beim Brand des Heeresarchivs in Potsdam 1945 zerstört wurde. Ich werde in meiner Arbeit weitestgehend der Argumentation des Wilhelm Deist folgen, der mit seinem 1986 erschienenen Aufsatz „Verdeckter Militärstreik im Kriegsjahr 1918?“ einen neuen Ansatz zur Lösung der Frage präsentierte. Ziel der Arbeit ist es, die tiefgehenden, ja systemimmanenten Ursachen für den Ausbruch des verdeckten Militärstreiks sowohl in der Heimat, als auch an der Front und dessen substantielle Bedeutung für den Zusammenbruch des Heeres und damit für den Zusammenbruch des wilhelminischen Staates herauszustellen. Dabei wird vor allem die mentalitätsgeschichtliche Ebene im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Heimat
- 1. Rückblick: Situation 1916/17
- 2. Der Metallarbeiterstreik vom 28.01.1918
- III. Front
- 1. Generelle Miẞstände
- IV. Dialektische Wechselwirkung Front – Heimat
- V. Die >>Michael<<-offensive
- 1. Optionen und Planung
- 2. Durchführung
- VI. Die mentale Ebene
- 1. Der verdeckte Militärstreik
- VII. Das Verhalten der OHL und die „Dolchstoßlegende“
- VIII. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die systemimmanenten Ursachen für den Ausbruch des verdeckten Militärstreiks sowohl in der Heimat als auch an der Front und dessen Bedeutung für den Zusammenbruch des Heeres und des wilhelminischen Staates zu analysieren. Dabei steht die mentalitätsgeschichtliche Ebene im Mittelpunkt der Betrachtung.
- Versorgungslage und soziale Unruhen in der Heimat
- Mißstände an der Front
- Die >>Michael<<-offensive als Katalysator
- Der verdeckte Militärstreik als Ausdruck der Desillusionierung
- Die Rolle der Obersten Heeresleitung (OHL) und die „Dolchstoßlegende“
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet den einzigartigen Charakter des deutschen Zusammenbruchs 1918 und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen dieses Zusammenbruchs. Sie skizziert verschiedene Ansätze in der Forschung, die den Fokus auf die Überlastung der deutschen Kräfte durch die Offensiven Kriegführung legen. Die Arbeit verfolgt einen neuen Ansatz, der sich auf den "verdeckten Militärstreik" konzentriert.
- Kapitel II: Heimat: Dieses Kapitel schildert die prekären Lebensbedingungen in der Heimat während des Krieges. Es zeigt die Folgen der englischen Blockade, die Lebensmittelknappheit und die zunehmende soziale Ungleichheit auf. Der Metallarbeiterstreik von 1918 wird als Ausdruck des zunehmenden politischen Protests dargestellt.
- Kapitel III: Front: Dieses Kapitel befasst sich mit den generellen Miẞständen an der Front. Es wird auf die schwierigen Lebensbedingungen, die hohe Belastung der Soldaten und die wachsende Desillusionierung eingegangen.
- Kapitel IV: Dialektische Wechselwirkung Front – Heimat: Dieser Abschnitt analysiert die wechselseitige Beeinflussung zwischen den Problemen an der Front und den sozialen Spannungen in der Heimat. Er beleuchtet, wie die zunehmende Desillusionierung an der Front die politische Stimmung in der Heimat beeinflusste.
- Kapitel V: Die >>Michael<<-offensive: Dieses Kapitel untersucht die Planung und Durchführung der >>Michael<<-offensive. Es zeigt, wie diese Offensive die Belastung der deutschen Kräfte weiter erhöhte und zur Eskalation der Spannungen beitrug.
- Kapitel VI: Die mentale Ebene: Dieser Abschnitt widmet sich dem "verdeckten Militärstreik" als Ausdruck der mentalen Verzweiflung und der wachsenden Kriegsmüdigkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die komplexen Ursachen des militärischen Zusammenbruchs im Deutschen Reich 1918. Im Fokus stehen die Folgen der englischen Blockade, die soziale und politische Unruhen in der Heimat, die Kriegserfahrungen an der Front und der verdeckte Militärstreik als Ausdruck der Desillusionierung und Kriegsmüdigkeit. Die >>Michael<<-offensive wird als Katalysator für die Eskalation der Spannungen betrachtet. Darüber hinaus werden die Rolle der OHL und die "Dolchstoßlegende" als wichtige Elemente in der Analyse des Zusammenbruchs behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Warum brach das deutsche Heer 1918 zusammen?
Ursachen waren die militärische Überlastung durch die Michael-Offensive, die prekäre Versorgungslage in der Heimat und eine zunehmende Kriegsmüdigkeit an der Front.
Was versteht man unter dem "verdeckten Militärstreik"?
Der Historiker Wilhelm Deist prägte diesen Begriff für die massenhafte Desertion, das Drücken vor dem Dienst und die Gehorsamsverweigerung im letzten Kriegsjahr.
Was war die "Dolchstoßlegende"?
Eine von der Obersten Heeresleitung (OHL) verbreitete Propaganda, die behauptete, das "unbesiegte" Heer sei durch Revolutionäre in der Heimat von hinten erstochen worden.
Welche Rolle spielte der Metallarbeiterstreik 1918?
Er war ein deutliches Zeichen für den politischen Protest und die soziale Not in der Heimat, die direkt auf die Moral der Soldaten an der Front ausstrahlte.
Was war die Michael-Offensive?
Der letzte große Versuch der deutschen Führung im Frühjahr 1918, den Krieg im Westen zu entscheiden, der jedoch an der Erschöpfung der Truppen scheiterte.
- Citar trabajo
- Patrick Schweitzer (Autor), 2003, Militärischer Zusammenbruch und Revolution 1918, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18589