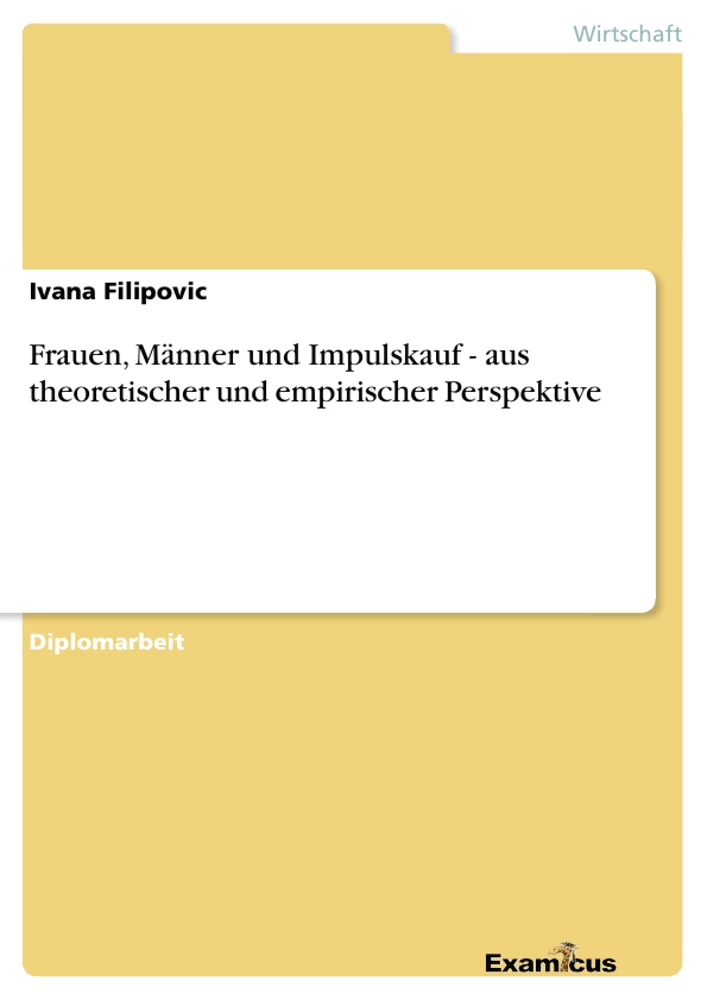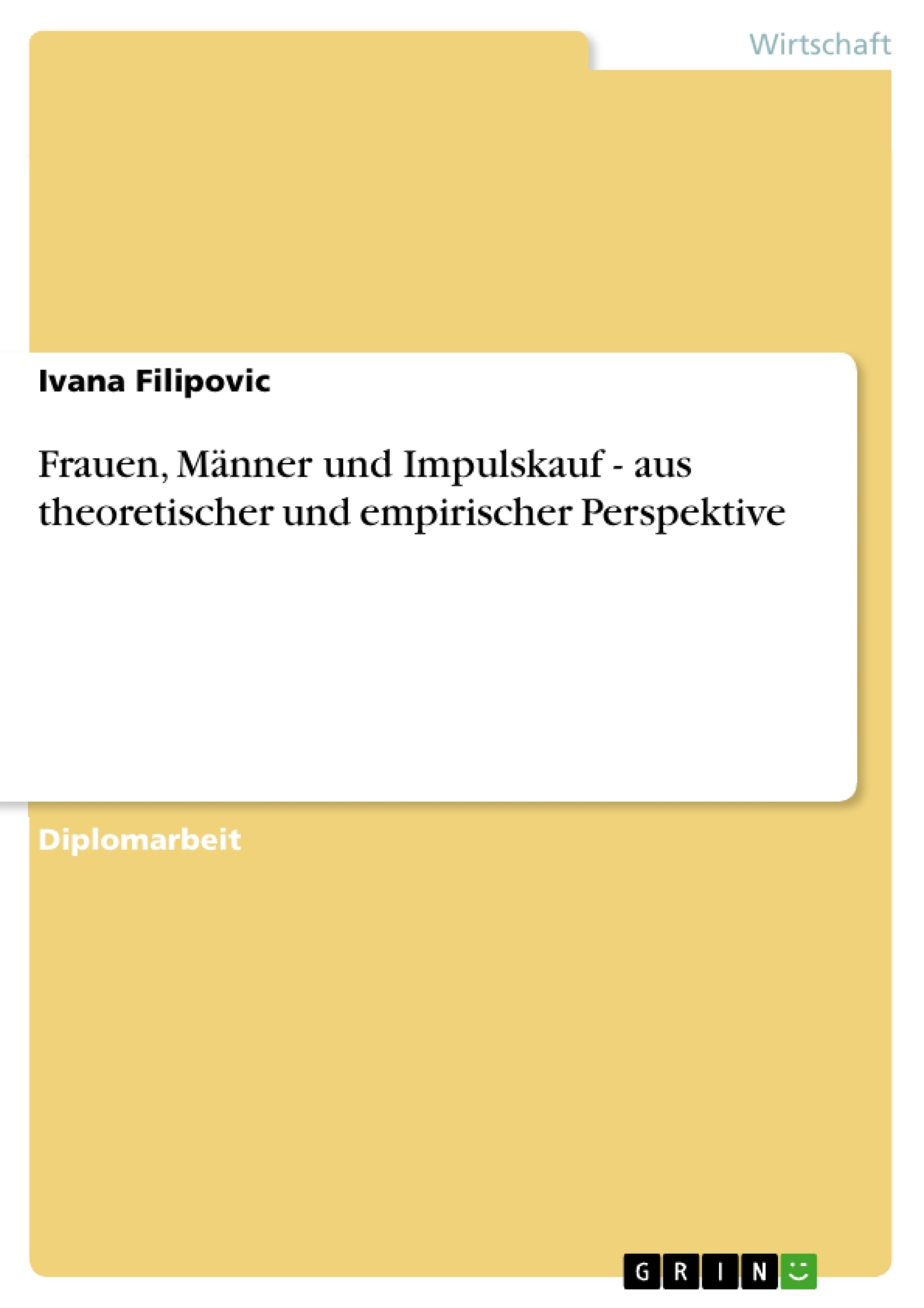Die Arbeit demonstriert eine thematische Verbindung des impulsiven Kaufverhaltens mit dem Konstrukt Geschlecht. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen, einer theoretischen Studie, die auf der Literaturrecherche basiert, und einer empirischen Studie, die dieses bisher selten erforschte Thema untersucht. In der Auswahl der Literatur und Beschreibung der theoretischen Grundlage wurde ein interdisziplinärer Ansatz realisiert. Zunächst wird das Konstrukt Impulskauf von anderen Kaufentscheidungsarten abgegrenzt und definiert. Die Impulskauf-Einflussfaktoren (inneren und äußeren), sowie bisherige Impulskaufstudien werden dargestellt. Im Folgenden werden die negativen Aspekte der Impulskäufe erläutert. Darauf folgt ein Überblick über innere Reize, die Impulskäufe steuern. Der Unterschied sowie die Gemeinsamkeit zwischen Männern und Frauen, Geschlechterrollen und Stereotype im Kaufverhalten werden auch behandelt. Dazu wird ein Überblick der durchgeführten Untersuchungen gegeben. Die empirische Untersuchung beinhaltet eine qualitative Impulskaufstudie, die zum Ziel hat, ein tieferes Verständnis der Thematik zu liefern und Anregungen für die Praxis, vor allem für die Zukunft der Konsumentengesellschaft zu geben. Methodisch wurde ein Vorgehen mit halbstandardisierten Interviews als Datenerhebungsinstrument und qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren gewählt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Kaufentscheidungen
- 2.1 Klassifikation der Kaufentscheidungen
- 2.1.1 Extensive Kaufentscheidungen
- 2.1.2 Limitierte Kaufentscheidungen
- 2.1.3 Habitualisierte Kaufentscheidungen
- 2.1.4 Impulsive Kaufentscheidungen
- 2.2 Weitere Merkmale bei Kaufentscheidungen
- 3 Impulskauf
- 3.1 Definitionen des Impulskaufes
- 3.2 Komponenten des Impulskaufes
- 3.3 Arten des Impulskaufes
- 3.4 Einflussfaktoren auf die Produktauswahl
- 3.4.1 Persönlichkeit der KonsumentInnen
- 3.4.2 Bedeutung materieller Güter
- 3.4.3 Interaktion
- 3.4.4 Informationsverhalten
- 3.4.5 Produkte
- 3.4.5.1 Produktsymbolismus
- 3.4.6 Preis
- 3.5 Einflussfaktoren auf die Kaufhandlung
- 3.5.1 Werbung
- 3.5.2 Produktplatzierungen
- 3.5.3 Ladengestaltung
- 3.5.4 Reize mit starkem Aktivierungspotential am Kaufort
- 3.6 Entstehung impulsiver Kaufentscheidungen
- 3.6.1 Impulsivität als Folge der Reizsituation
- 3.6.2 Impulsivität als Folge psychischer Prozesse
- 3.6.2.1 Motivationale Prozesse
- 3.6.2.2 Selbstkontrolle
- 3.7 Impulskaufstudien
- 3.7.1 Rook (1987)
- 3.7.2 Shiv und Fedorikhin (1999)
- 3.7.2.1 Erste Untersuchung
- 3.7.2.2 Zweite Untersuchung
- 3.7.3 Überblick ausgewählter empirischen Studien zum Impulskauf
- 4 Negative Aspekte des Impulskaufes
- 4.1 Kaufsucht
- 4.1.1 Wonach sind die KäuferInnen süchtig?
- 4.2 Kaufsucht und Impulskauf
- 4.3 Eine europäische Kaufsuchtstudie
- 4.3.1 Ergebnisse
- 4.3.2 Empfehlungen
- 5 Psychische Prozesse
- 5.1 Aktivierende Prozesse
- 5.1.1 Aktivierung
- 5.1.2 Auslösende Faktoren der Aktivierung
- 5.1.3 Wie wirkt die Aktivierung?
- 5.2 Emotionen
- 5.2.1 Fundamentale Emotionen
- 5.3 Motivation
- 5.4 Involvement und Aufmerksamkeit
- 5.5 Einstellung
- 5.6 Emotion - Motivation - Einstellung
- 5.7 Kognitive Prozesse
- 5.8 Zusammenspiel von Affekten und Kognition im Kaufentscheidungsprozess
- 5.9 Was ist ein Impuls?
- 6 Geschlecht und Kaufverhalten
- 6.1 Geschlechterdifferenz
- 6.1.1 Biologische Unterschiede
- 6.1.2 Psychologische Unterschiede
- 6.1.2.1 Geschlechterrollen
- 6.1.2.2 Geschlechtstypisches Verhalten und Stereotype
- 6.1.3 Soziologische Unterschiede
- 6.2 Geschlecht und Emotionen
- 6.3 Kaufverhalten und Geschlecht
- 6.4 Bisherige Studien
- 7 Impulskauf und Geschlecht
- 7.1 Empirische Studien zu Impulskauf und Geschlecht
- 7.1.1 Keine zweiten Gedanken mehr
- 7.1.2 Dittmar, Beattie und Friese - erste Studie
- 7.1.3 Dittmar, Beattie und Friese - zweite Studie
- 8 Qualitative Studie
- 8.1 'Soft Methods for Soft Data'
- 8.2 Warum qualitativ?
- 8.3 Qualitativer Forschungsdesign
- 8.3.1 Planung des Untersuchungsdesigns
- 8.3.2 Sample
- 8.4 Qualitative Interviews
- 8.5 Auswertung qualitativer Interviewdaten
- 8.5.1 Daten erzeugen
- 8.5.2 Kodierung
- 8.5.2.1 QSR N6
- 8.5.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse
- 8.6 Ergebnisse der Studie
- 8.6.1 Impulskauf
- 8.6.1.1 Reiner Impulskauf
- 8.6.1.2 Suggestionsimpulskauf
- 8.6.1.3 Impulskauf durch Sonderangebot
- 8.6.1.4 Impulskauf durch Erinnerung
- 8.6.1.5 Geplanter Impulskauf
- 8.6.2 Produkte
- 8.6.2.1 Kleidung
- 8.6.2.2 Schuhe
- 8.6.2.3 Accessoires
- 8.6.2.4 Lebensmittel
- 8.6.2.5 Bücher und Zeitschriften
- 8.6.2.6 CDs
- 8.6.2.7 Kosmetik
- 8.6.2.8 Geschenke
- 8.6.2.9 Technik
- 8.6.2.10 Wohndekor
- 8.6.2.11 Haushaltsgeräte
- 8.6.2.12 Sportartikel
- 8.6.3 Kaufziele
- 8.6.3.1 Persönliche Kaufziele
- 8.6.3.2 Soziale Kaufziele
- 8.6.4 Emotionen und Impulskauf
- 8.6.4.1 Emotionen in der Vorkaufphase
- 8.6.4.2 Emotionen beim Kaufakt
- 8.6.4.3 Nachkaufreaktionen
- 8.6.5 Impulskauf und Risiko
- 8.6.6 Geschlecht über Geschlecht
- 8.6.6.1 Aus der weiblichen Sicht
- 8.6.6.2 Aus der männlichen Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Impulskaufs, insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede. Ziel ist es, die Faktoren zu identifizieren, die impulsive Kaufentscheidungen beeinflussen und herauszufinden, inwieweit sich das Kaufverhalten von Männern und Frauen unterscheidet.
- Klassifizierung und Definition von Impulskäufen
- Einflussfaktoren auf Impulskäufe (psychologische und situative Faktoren)
- Negative Folgen von Impulskäufen (z.B. Kaufsucht)
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Impulskaufverhalten
- Empirische Untersuchung des Impulskaufverhaltens mittels qualitativer Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einführende Kapitel legt die Problemstellung dar, definiert die Zielsetzung der Arbeit und beschreibt den Aufbau. Es skizziert die zentrale Forschungsfrage nach den geschlechtsspezifischen Unterschieden im Impulskaufverhalten und gibt einen Überblick über die Struktur der folgenden Kapitel.
2 Kaufentscheidungen: Dieses Kapitel liefert eine fundierte theoretische Basis, indem es verschiedene Arten von Kaufentscheidungen klassifiziert (extensive, limitierte, habitualisierte und impulsive Kaufentscheidungen). Es werden die jeweiligen Merkmale und Unterschiede erläutert, um den Impulskauf im Kontext des gesamten Kaufentscheidungsprozesses zu verorten.
3 Impulskauf: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Impulskauf. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt und die Komponenten des Impulskaufes analysiert. Der Einfluss von Faktoren wie Persönlichkeit, Bedeutung materieller Güter, Interaktion, Informationsverhalten, Produktgestaltung, Preis, Werbung und Ladengestaltung auf die Produktauswahl und die Kaufhandlung werden eingehend beleuchtet. Es werden verschiedene Theorien zur Entstehung impulsiver Kaufentscheidungen präsentiert (Reizsituation, psychische Prozesse, Motivation, Selbstkontrolle) und relevante empirische Studien (Rook, Shiv und Fedorikhin) kritisch diskutiert.
4 Negative Aspekte des Impulskaufes: Dieses Kapitel widmet sich den negativen Folgen von Impulskäufen, insbesondere der Kaufsucht. Es wird definiert, wodurch Kaufsucht gekennzeichnet ist und inwiefern ein Zusammenhang zwischen Kaufsucht und Impulskäufen besteht. Eine europäische Kaufsuchtstudie wird vorgestellt, deren Ergebnisse und Empfehlungen diskutiert werden.
5 Psychische Prozesse: Dieses Kapitel beleuchtet die psychologischen Prozesse, die dem Impulskauf zugrunde liegen. Es werden aktivierende Prozesse (Aktivierung, auslösende Faktoren, Wirkung), Emotionen, Motivation, Involvement, Aufmerksamkeit, Einstellungen und das Zusammenspiel von Affekten und Kognition im Kaufentscheidungsprozess detailliert erläutert. Die Bedeutung von Emotionen, Motivation und Einstellung für den Impulskauf wird hervorgehoben.
6 Geschlecht und Kaufverhalten: In diesem Kapitel werden geschlechtsspezifische Unterschiede im Kaufverhalten thematisiert. Biologische, psychologische (Geschlechterrollen, Stereotype) und soziologische Unterschiede werden im Kontext des Kaufverhaltens diskutiert. Emotionen und ihr Einfluss auf das Kaufverhalten von Männern und Frauen werden analysiert, sowie bisherige Studien zum Thema vorgestellt.
7 Impulskauf und Geschlecht: Dieses Kapitel präsentiert empirische Studien, die sich explizit mit dem Zusammenhang zwischen Impulskauf und Geschlecht auseinandersetzen. Die Ergebnisse dieser Studien werden kritisch diskutiert und deren Bedeutung für das Verständnis des Forschungsgegenstandes herausgestellt.
8 Qualitative Studie: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte qualitative Studie zum Thema Impulskauf und Geschlecht. Es werden die Forschungsmethodik (qualitatives Forschungsdesign, Sample, Durchführung qualitativer Interviews, Auswertung der Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse), die Ergebnisse der Studie und deren Interpretation detailliert erläutert. Die Ergebnisse umfassen die verschiedenen Arten von Impulskäufen, die gekauften Produkte, die Kaufziele, die Rolle von Emotionen sowie geschlechtsspezifische Unterschiede.
Schlüsselwörter
Impulskauf, Kaufentscheidung, Konsumentenverhalten, Kaufsucht, Geschlecht, Geschlechterrollen, Emotionen, Motivation, Aktivierung, Qualitative Forschung, Empirische Studie, Qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Impulskauf und Geschlecht
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen des Impulskaufs, insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede. Das zentrale Ziel ist die Identifizierung der Faktoren, die impulsive Kaufentscheidungen beeinflussen, und die Klärung der Frage, inwieweit sich das Kaufverhalten von Männern und Frauen unterscheidet.
Welche Arten von Kaufentscheidungen werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen extensiven, limitierten, habitualisierten und impulsiven Kaufentscheidungen. Jede Art wird hinsichtlich ihrer Merkmale und Unterschiede erläutert, um den Impulskauf im Kontext des gesamten Kaufentscheidungsprozesses einzuordnen.
Wie wird der Impulskauf definiert und welche Komponenten werden betrachtet?
Es werden verschiedene Definitionen des Impulskaufs vorgestellt und seine Komponenten analysiert. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von Faktoren wie Persönlichkeit, Bedeutung materieller Güter, Interaktion, Informationsverhalten, Produktgestaltung, Preis, Werbung und Ladengestaltung auf die Produktauswahl und die Kaufhandlung.
Welche Theorien zur Entstehung impulsiver Kaufentscheidungen werden behandelt?
Die Arbeit präsentiert Theorien zur Entstehung impulsiver Kaufentscheidungen, die sich auf Reizsituationen, psychische Prozesse, Motivation und Selbstkontrolle konzentrieren. Relevante empirische Studien (Rook, Shiv und Fedorikhin) werden kritisch diskutiert.
Welche negativen Aspekte des Impulskaufs werden behandelt?
Die Arbeit widmet sich den negativen Folgen von Impulskäufen, insbesondere der Kaufsucht. Es wird definiert, wodurch Kaufsucht gekennzeichnet ist und inwiefern ein Zusammenhang zwischen Kaufsucht und Impulskäufen besteht. Eine europäische Kaufsuchtstudie wird vorgestellt, deren Ergebnisse und Empfehlungen diskutiert werden.
Welche psychischen Prozesse spielen beim Impulskauf eine Rolle?
Die Arbeit beleuchtet aktivierende Prozesse (Aktivierung, auslösende Faktoren, Wirkung), Emotionen, Motivation, Involvement, Aufmerksamkeit, Einstellungen und das Zusammenspiel von Affekten und Kognition im Kaufentscheidungsprozess. Die Bedeutung von Emotionen, Motivation und Einstellung für den Impulskauf wird hervorgehoben.
Wie werden geschlechtsspezifische Unterschiede im Kaufverhalten behandelt?
Die Arbeit thematisiert geschlechtsspezifische Unterschiede im Kaufverhalten, indem sie biologische, psychologische (Geschlechterrollen, Stereotype) und soziologische Unterschiede im Kontext des Kaufverhaltens diskutiert. Emotionen und ihr Einfluss auf das Kaufverhalten von Männern und Frauen werden analysiert, und bisherige Studien zum Thema werden vorgestellt.
Welche empirischen Studien zum Zusammenhang zwischen Impulskauf und Geschlecht werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert empirische Studien, die sich explizit mit dem Zusammenhang zwischen Impulskauf und Geschlecht auseinandersetzen. Die Ergebnisse dieser Studien werden kritisch diskutiert und ihre Bedeutung für das Verständnis des Forschungsgegenstandes herausgestellt.
Wie wird die qualitative Studie zum Impulskauf und Geschlecht durchgeführt?
Die Arbeit beschreibt eine durchgeführte qualitative Studie zum Thema Impulskauf und Geschlecht. Es werden die Forschungsmethodik (qualitatives Forschungsdesign, Sample, Durchführung qualitativer Interviews, Auswertung der Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse), die Ergebnisse der Studie und deren Interpretation detailliert erläutert.
Welche Ergebnisse liefert die qualitative Studie?
Die Ergebnisse der qualitativen Studie umfassen verschiedene Arten von Impulskäufen, gekaufte Produkte, Kaufziele, die Rolle von Emotionen sowie geschlechtsspezifische Unterschiede. Diese werden detailliert im Kapitel 8 dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Mag. Ivana Filipovic (Autor:in), 2003, Frauen, Männer und Impulskauf - aus theoretischer und empirischer Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186114