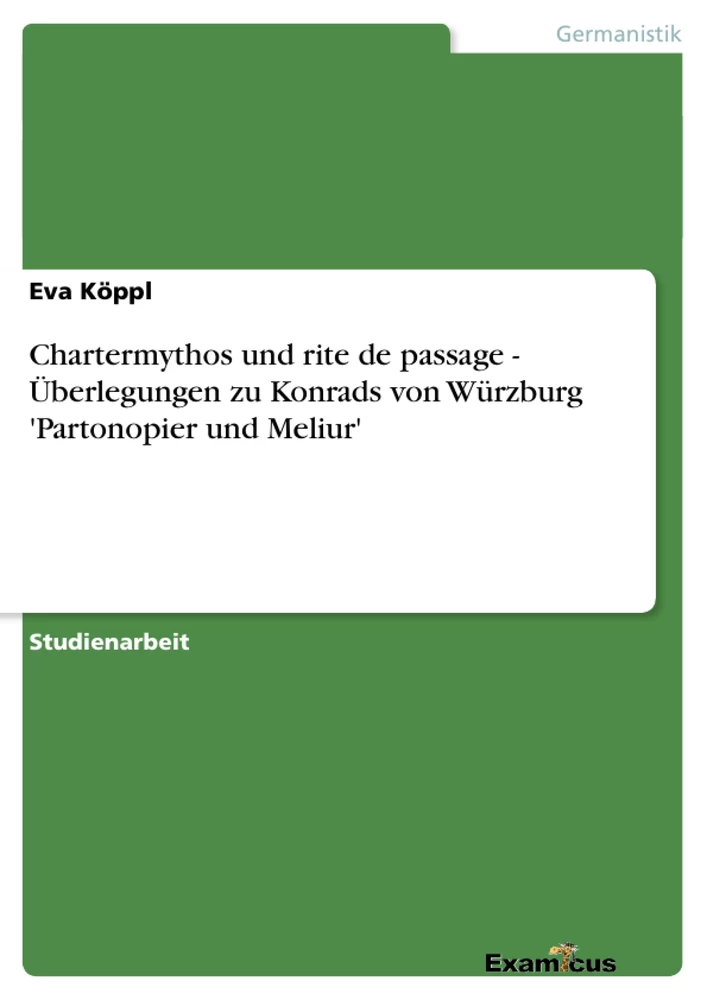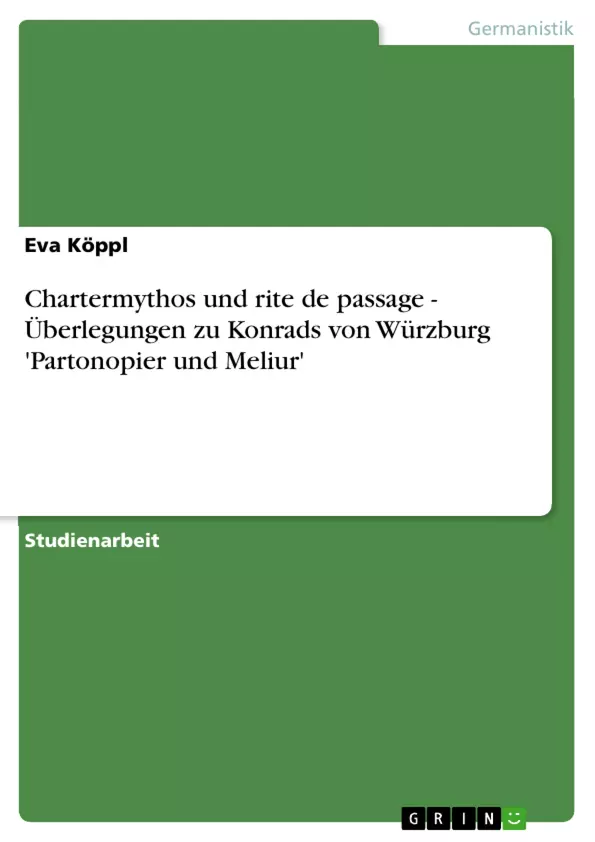Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Feenproblematik im Zusammenhang mit Übergangs- und Initiationsriten (rites de passage) und vergleicht Konrads von Würzburg späthöfischen Roman ?Partonopier und Meliur? mit keltischen Paralleltexten. Dabei wird ein bestimmter Mythostyp, der Chartermythos, untersucht, und es wird der Frage nachgegangen, ob in Bezug auf diese Mythosform matriarchalische Strukturen vorliegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verbindungen zu keltischen (u.a.) Mythen und Sagen
- Erzählmotive und Erzählstruktur
- Motivische Parallelen zwischen dem Roman Partonopier und Meliur und der irokeltischen Sagenwelt
- Zur ,,Herkunft“ der irokeltischen Feenmotive
- Christliche Überlieferung und die Deutung des Feenreichs im Roman Partonopier und Meliur
- Die Umwertung keltischer Motive im Partonopier und Meliur am Beispiel der Meliurfigur und des Feenreiches
- Variationen innerhalb der Gender-Konzeption
- Der Roman Partonopier und Meliur und der irokeltische Chartermythos
- Der irokeltische Chartermythos
- Die späthöfische Konzeption von Privatheit und Öffentlichkeit im Partonopier und Meliur und der irokeltische Chartermythos
- Die Verbindung von Liebe und repräsentativer Funktion
- Erzählmotive und Erzählstruktur
- Partenopier und Meliur, der rite de passage und die Mädchentragödie
- Van Genneps Stufenmodell des rite de passage und Turners Untersuchungen zum Schwellenreich
- Burkerts mythologisches Schema der Mädchentragödie
- Die Modelle des rite de passage und der Mädchentragödie und der Roman Partonopier und Meliur
- Zwei Entwicklungswege: der un-schematische Ablauf des rite de passage und der Mädchentragödie im Partonopier und Meliur
- Die Entwicklungswege der „,wirklichen“ und der „Anderswelt" im Vergleich
- Geschlechtsspezifische Aspekte der Schwellenphase in Meliurs Reich
- Der Weg von Meliurs Andersweltreich in die gesellschaftliche Integration
- Verheiratungspolitik in Lucretes Reich
- Rücktritt von der sexuell-integrativen Initiation ins Reich der Mutter
- Mögliche ethnographische Entsprechungen
- Vermittlung zwischen den Welten. Festhalten an der Gedankenwelt der Feen
- Irekel als Verkörperung eines neuen Frauentyps
- Schwertleite, Hochzeit und „Happy Ending“
- Die Entwicklungswege der „,wirklichen“ und der „Anderswelt" im Vergleich
- Schluss
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem späthöfischen Minne- und Aventiureroman "Partonopier und Meliur" von Konrad von Würzburg. Ziel ist es, die Verarbeitung von Motiven irokeltischer Herkunft im Roman zu untersuchen, insbesondere die Umdeutung und Neubewertung von Motiven, die auf das irokeltische Sakrale Königtum verweisen. Die Arbeit analysiert die Verbindungen des Romans zu keltischen Mythen und Sagen, insbesondere zu den irokeltischen Feenerzählungen und Echtrai, und untersucht die Integration von Elementen des Erzähltyps "Übernatürliche Partnerin" in den Kontext des Werkes. Darüber hinaus werden die Modelle des rite de passage und der Mädchentragödie herangezogen, um die Entwicklung des Protagonisten und die Rolle der weiblichen Figuren im Roman zu beleuchten.
- Verbindungen zu keltischen Mythen und Sagen, insbesondere zu den irokeltischen Feenerzählungen und Echtrai
- Umdeutung und Neubewertung von Motiven, die auf das irokeltische Sakrale Königtum verweisen
- Integration von Elementen des Erzähltyps "Übernatürliche Partnerin" in den Kontext des Romans
- Anwendung der Modelle des rite de passage und der Mädchentragödie auf die Entwicklung des Protagonisten und die Rolle der weiblichen Figuren
- Analyse der Geschlechterrollen und der Konzeption von Privatheit und Öffentlichkeit im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman "Partonopier und Meliur" von Konrad von Würzburg in den Kontext der späthöfischen Minne- und Aventiureromane und beleuchtet die Verbindungen zu anderen Werken wie den Lais Lanval und Guingamor von Marie de France sowie zu Apuleius' Kunstmythos Amor und Psyche. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Verarbeitung von Motiven irokeltischer Herkunft im Roman und die Anwendung der Modelle des rite de passage und der Mädchentragödie auf die Analyse der Figuren und Handlungsstränge.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Verbindungen des Romans zu keltischen Mythen und Sagen. Es werden die Erzählmotive und die Erzählstruktur des Romans im Vergleich zu irokeltischen Sagen und Feenerzählungen analysiert. Dabei wird insbesondere auf die Umdeutung und Neubewertung von Motiven wie dem Feenreich, der Meliurfigur und dem irokeltischen Chartermythos eingegangen. Das Kapitel beleuchtet auch die Variationen innerhalb der Gender-Konzeption im Roman und die Verbindung von Liebe und repräsentativer Funktion.
Das dritte Kapitel untersucht den Roman "Partonopier und Meliur" im Kontext des rite de passage und der Mädchentragödie. Es werden die Modelle von van Gennep und Burkert auf die Entwicklung des Protagonisten und die Rolle der weiblichen Figuren im Roman angewendet. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Entwicklungswege des Protagonisten und die geschlechtsspezifischen Aspekte der Schwellenphase in Meliurs Reich. Es beleuchtet auch die Verheiratungspolitik in Lucretes Reich und den Rücktritt von der sexuell-integrativen Initiation ins Reich der Mutter. Das Kapitel geht auf mögliche ethnographische Entsprechungen ein und analysiert die Vermittlung zwischen den Welten und die Rolle der Figur Irekel als Verkörperung eines neuen Frauentyps.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Roman "Partonopier und Meliur", Konrad von Würzburg, irokeltische Mythen und Sagen, Feenerzählungen, Chartermythos, rite de passage, Mädchentragödie, Geschlechterrollen, Liebe, Repräsentation, gesellschaftliche Integration, Anderswelt, Schwellenphase, Verheiratungspolitik, ethnographische Entsprechungen, Frauentyp.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Konrads von Würzburg „Partonopier und Meliur“?
Es ist ein späthöfischer Roman, der die Beziehung zwischen einem Ritter und einer Fee sowie deren Einbindung in gesellschaftliche Strukturen thematisiert.
Was ist ein „Chartermythos“?
Ein Mythos, der soziale oder rechtliche Institutionen begründet und legitimiert, hier speziell im Kontext des irokeltischen Sakralkönigtums.
Was bedeutet „rite de passage“ in diesem Werk?
Es bezeichnet Übergangs- und Initiationsriten, die der Protagonist durchläuft, um sich von der Kindheit zum erwachsenen Ritter zu entwickeln.
Welche Rolle spielt die Meliurfigur?
Meliur wird als „übernatürliche Partnerin“ analysiert, deren Darstellung auf keltischen Feenmotiven basiert, aber christlich umgedeutet wurde.
Was ist die „Mädchentragödie“ nach Burkert?
Ein mythologisches Schema, das zur Analyse der weiblichen Entwicklungswege im Roman herangezogen wird.
- Quote paper
- Magistra Artium Eva Köppl (Author), 2002, Chartermythos und rite de passage - Überlegungen zu Konrads von Würzburg 'Partonopier und Meliur', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186270