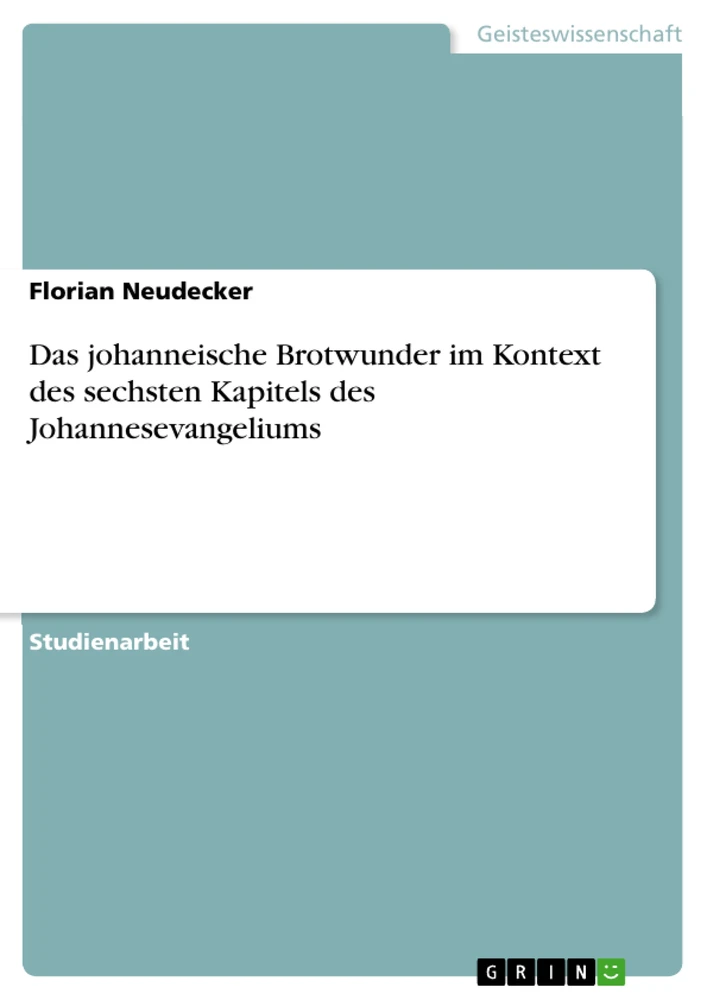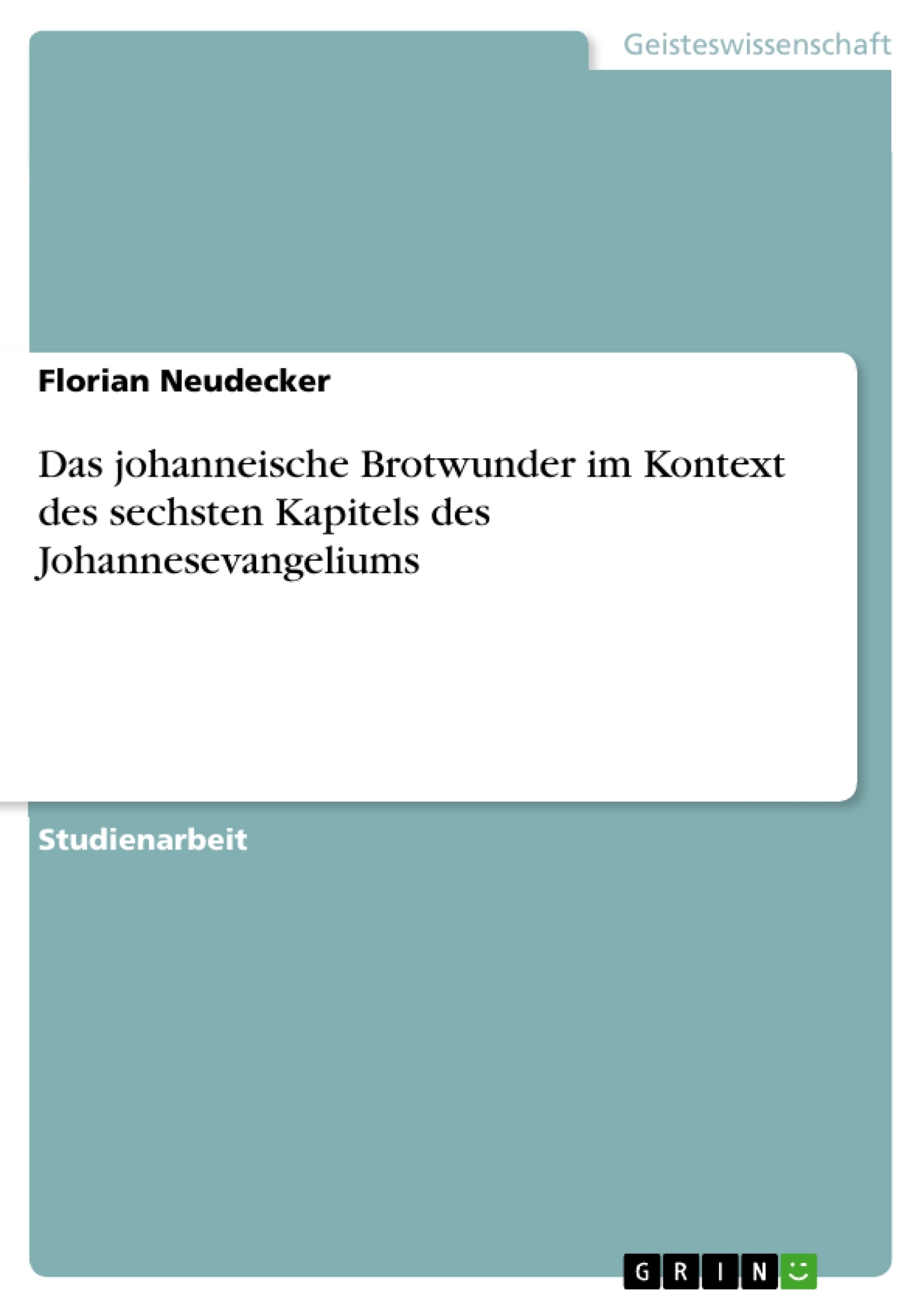Die sog. Brotvermehrung ist eines der bekanntesten und rätselhaftesten Wunder Jesu. Sie faszinierte die Autoren der Bibel derart, dass sie 6-mal überliefert wird, 2-mal davon in Kombination mit einem anderen Wunder, dem Gang über das Wasser. Diese Arbeit interpretiert das Brotwunder aus Sicht des Evangelisten Johannes. Es erfolgt eine Interpretation als Wunder und eine als Offenbarungszeihen. Bei Letzerem muss das ganze 6. Kapitel des Johannesevangeliums beachtet werden. Außerdem werden die Fragen nach der Ähnlichkeit zum letzten Abendmahl und den Motiven "Mose" und "Pascha" sowie auf Theorien zur Entstehung dieses Kapitels eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Das johanneische Brotwunder im Kontext des sechsten Kapitels des Johannesevangeliums
- 1 Versuch einer Gliederung für Joh 6
- 2 Synoptischer Vergleich der sechs Brotwundertraditionen
- 3 Textanalyse
- 4 Motivkritik
- 4.1 Literarische Motive
- 4.2 Das Motiv ,,Mose"
- 4.3 Das Motiv ,,Pascha"
- 4.4 Die Geschenkwunder im Elija-Elischa-Zyklus
- 4.5 Die Einsetzungsworte im Herrenmahl im Vergleich mit Joh 6,11
- 5 Gattungskritik
- 6 Die Entstehung der Perikope – 2 Theorien
- 6.1 Semeiaquelle - Evangelist - Kirchliche Redaktion
- 6.2 Ur Markus - secondary orality - secondary literacy - Evangelist - eucharistische relecture
- 6.3 Fazit
- 7 Interpretation
- 7.1 Interpretation als Wundergeschichte
- 7.2 Interpretation als Zeichen zu Beginn von Joh 6
- C. Zeichen oder Wunder?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das johanneische Brotwunder im Kontext des sechsten Kapitels des Johannesevangeliums. Sie analysiert den Text und seine literarischen Motive, vergleicht ihn mit synoptischen Traditionen und erforscht seine Entstehung. Darüber hinaus werden zwei Interpretationsansätze vorgestellt: eine Interpretation als Wundergeschichte und eine Interpretation als Zeichen.
- Textanalyse und Motivkritik des johanneischen Brotwunders
- Vergleich mit den synoptischen Brotwundertraditionen
- Gattungskritik und Analyse der Entstehung der Perikope
- Interpretation des Brotwunders als Wundergeschichte und als Zeichen
- Diskussion der Frage, ob es sich bei dem Brotwunder um ein Wunder oder ein Zeichen handelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Arbeit in den Kontext der synoptischen Wundergeschichten und erläutert die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel analysiert die Perikope des Brotwunders im Kontext des sechsten Kapitels des Johannesevangeliums und bietet eine mögliche Gliederung für das Kapitel. Es vergleicht das johanneische Brotwunder mit den synoptischen Traditionen und untersucht die literarischen Motive in der Perikope. Die Kapitel 5 und 6 behandeln die Gattungskritik und die Entstehung des Brotwunders. Die Interpretation des Brotwunders als Wundergeschichte und als Zeichen am Anfang des sechsten Kapitels werden in Kapitel 7 diskutiert. Das abschließende Kapitel reflektiert die Frage, ob es sich bei dem Brotwunder um ein Wunder oder ein Zeichen handelt.
Schlüsselwörter
Johanneisches Brotwunder, Johannesevangelium, sechstes Kapitel, synoptische Wundergeschichten, Textanalyse, Motivkritik, Gattungskritik, Entstehung, Interpretation, Zeichen, Wunder.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Brotwunder im Johannesevangelium?
Im Gegensatz zu den Synoptikern deutet Johannes das Brotwunder primär als „Zeichen“ (Semeion), das auf die tiefere Identität Jesu als das „Brot des Lebens“ hinweist.
Welche Rolle spielt das Motiv „Mose“ in Johannes 6?
Das Brotwunder wird in Typologie zu Mose und der Speisung mit Manna in der Wüste gesetzt, wobei Jesus als der neue, größere Prophet dargestellt wird.
Was ist der Unterschied zwischen einem Wunder und einem Zeichen?
Während ein Wunder das außergewöhnliche Ereignis selbst betont, ist ein Zeichen ein Hinweis auf eine dahinterliegende spirituelle Wahrheit oder die göttliche Vollmacht Jesu.
Wie hängen das Brotwunder und das Abendmahl zusammen?
Die Arbeit untersucht die eucharistische Sprache in Joh 6,11, die starke Parallelen zu den Einsetzungsworten des Abendmahls aufweist.
Welche Theorien gibt es zur Entstehung von Johannes 6?
Es werden Theorien diskutiert, die von einer Semeia-Quelle ausgehen, die später vom Evangelisten und einer kirchlichen Redaktion bearbeitet wurde.
- Arbeit zitieren
- Florian Neudecker (Autor:in), 2003, Das johanneische Brotwunder im Kontext des sechsten Kapitels des Johannesevangeliums , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186385