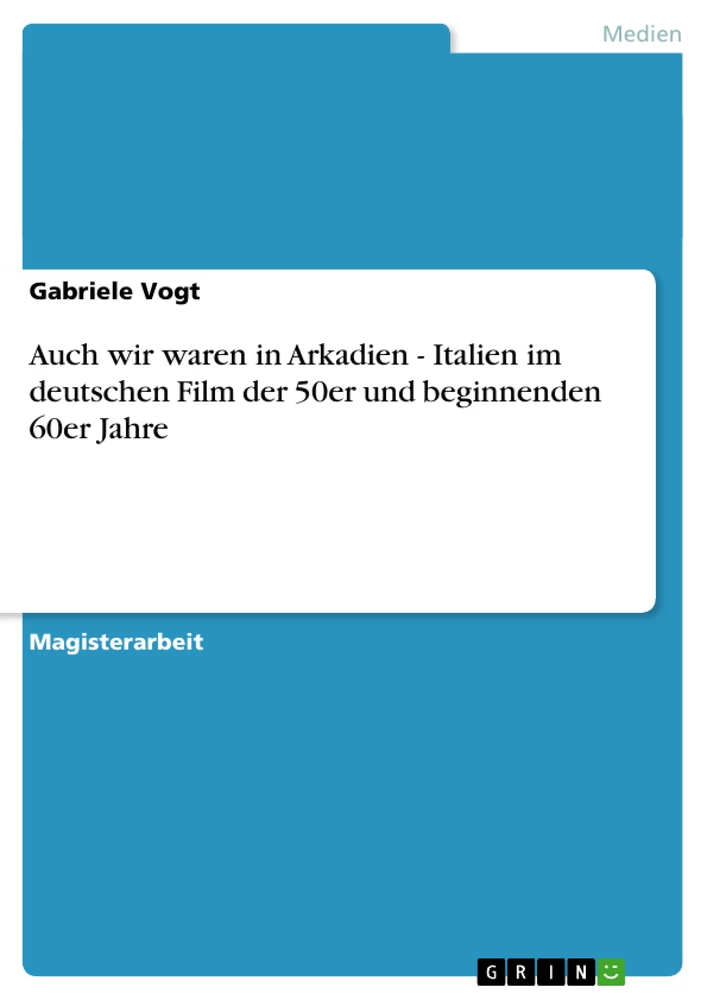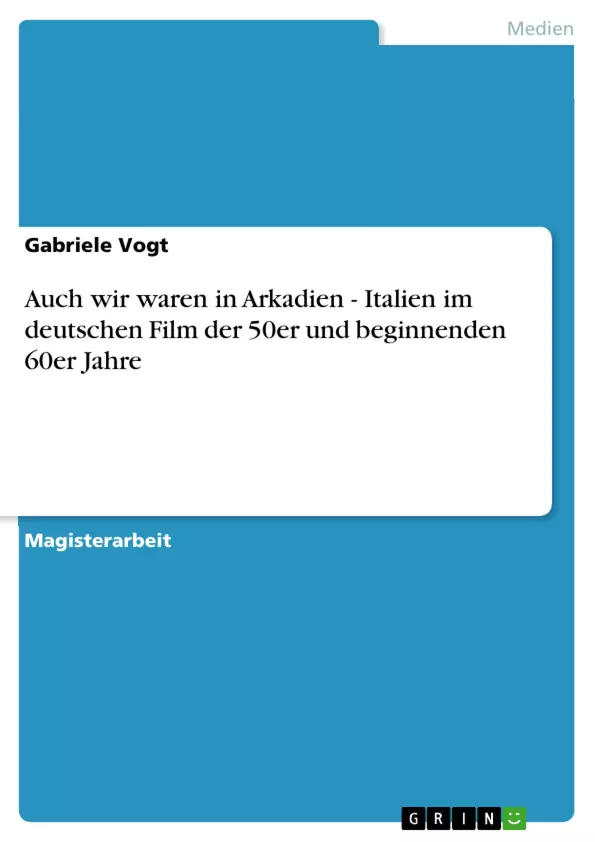Mit dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit die Darstellung von Italien in den
Filmen typisiert und standardisiert ist. Bereits 1959 wird von Hugo Hartung hierzu in
der Reisezeitschrift Merian über die italienische Riviera, die er ”hübsch vollgestopft
mit solchen Vorurteilen” bereist hat, festgestellt:
Daß die Riviera anders sei, wird der skeptische Leser weniger gutwillig hinnehmen.
Bunte Prospekte und Ansichtskarten, jene gefällige Schlagerkonfektion,
die rotem Wein, roten Lippen und blauem Meer immer neue Tonlimonaden
entpreßt, haben zuviel Unheil angerichtet, als daß die Behauptung, die
Riviera könne auch karg und arm, wild und urtümlich sein, bereitwillig geglaubt
werde. Denn soviel weiß jeder Kinogänger von ihr: sie ist der Ort mondänen
Lebensgenusses, wo sich in Palmenparks längs der Küste Kasinos und
Hotelpaläste aus Zuckerguß und Schlagsahne reihen.2
Palmen, blaues Meer und mondäner Lebensgenuß – ob diese und andere Klischees
über Italien vom Film der 50er Jahre (mit-)gebildet werden, soll Leitfrage der Film-
Analyse sein. Die Gewichtung der Untersuchung liegt hierbei auf den Merkmalen, mit
denen das Land und seine Bewohner ausgestattet werden und inwieweit diese ein
einheitliches Bild ergeben.
Nach ausführlicher Beschäftigung mit den Filmen der Zeit zeigt sich, daß Italien als
Thema im Film noch bis ca. 1962/63 eine große Rolle spielt3. Vor allen Dingen stellt
sich heraus, daß die Filme der 60er Jahre ein verändertes Bild von Italien
präsentieren und so eine interessante Erweiterung zu dem Italienbild der 50er Jahre
darstellen. Eng verknüpft mit dieser Entwicklung sind die Reisegewohnheiten der Deutschen,
die eine Überprüfung der ‘oktroyierten‘ Vorstellungen ermöglichen. Interessant ist
insbesondere die Frage, ob die Entwicklung in der Italiendarstellung mit der
Reisegeschichte korrespondiert.
Die pauschale Formulierung ”deutsche Filme” beinhaltet mehrere Einschränkungen.
Zum einen ist der ostdeutsche Film ausgeklammert, da von staatlicher Seite
erheblicher Einfluß auf ihn ausgeübt wurde. [...]
2 H. Hartung: Alessandro geht tanzen. In: Merian. Italienische Riviera, Jg.12, 1959, H. 2, S. 10-13. In :
Gries, Rainer et al.: Gestylte Geschichte: vom alltäglichen Umgang mit Geschichtsbildern. Münster
1989, S. 147
3 Heute sind es gerade die Filme der beginnenden 60er Jahre, die in der derzeitigen Fernsehunterhaltung
am häufigsten wiederholt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Auswahl des Untersuchungsmaterials
- 2.1. Erläuterung zur Quellenlage
- 2.2. Geographische Eingrenzung Italiens
- 3. Die Deutschen reisen/ Italien: Reiseziel Nr. 1
- 4. Der Schlager
- 5. Filme mit Italien als Handlungsschauplatz
- 5.1. Chronologische Auflistung der in Gattungen eingeteilten Filme
- 5.2. Das Italienbild in den Musikfilmen
- 5.2.1. Operettenfilme
- 5.2.2. Revuefilme
- 5.2.3. Musikalische Lustspiele
- 5.3. Zusammenfassung
- 6. Das Italienbild in Filmen ohne Italien-Komplex
- 6.1. Italien als Thema des Dialogs
- 6.2. Italienische Personen
- 6.3. Italien als Lebensstil in Deutschland
- 7. Entwicklungstendenzen des Italienbildes in den deutschen Filmen bis heute
- 8. Bella Italia, brutta Italia – das verlorene Paradies
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Darstellung Italiens im deutschen Film der 1950er und frühen 1960er Jahre. Ziel ist es, den Ursprung und die Entwicklung von Klischees und Stereotypen über Italien im deutschen Film dieser Epoche zu analysieren und deren Einfluss auf das Bild Italiens im deutschen Bewusstsein zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet die enge Verknüpfung zwischen dem damals stark ausgeprägten Italien-Tourismus und der filmischen Darstellung des Landes.
- Klischees und Stereotype von Italien im deutschen Film
- Der Einfluss des Italien-Tourismus auf die filmische Darstellung
- Entwicklung des Italienbildes im Laufe der 1950er und frühen 1960er Jahre
- Vergleich zwischen Musikfilmen und Filmen ohne expliziten Italien-Bezug
- Die Rolle Italiens als Sehnsuchtsort ("Arkadien") im Kontext der Nachkriegszeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die klischeehafte Darstellung Italiens im deutschen Film vor und führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie beschreibt die stereotypen Bilder von Italien (Sonne, Meer, liebeshungrige Italiener etc.) und benennt die zentrale Forschungsfrage: Inwieweit prägen und formen deutsche Filme der 50er Jahre diese Klischees? Die Einleitung legt den Fokus auf die Analyse der Merkmale, mit denen Italien und seine Bewohner im Film ausgestattet werden, und untersucht, ob diese ein einheitliches Bild ergeben. Der Bezug zu zeitgenössischen Reiseberichten und der Kontext der Nachkriegsgesellschaft werden angedeutet.
2. Auswahl des Untersuchungsmaterials: Dieses Kapitel beschreibt die Auswahlkriterien für die untersuchten Filme. Es wird erläutert, warum der ostdeutsche Film ausgeschlossen und der österreichische Film miteinbezogen wird. Die Entscheidung, Koproduktionen auszuschließen, wird begründet, da in diesen Filmen die deutsche Perspektive nicht unverfälscht zum Tragen kommt. Das Kapitel skizziert somit die methodischen Grenzen und den Umfang der Untersuchung.
3. Die Deutschen reisen/ Italien: Reiseziel Nr. 1: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung Italiens als beliebtes Reiseziel für Deutsche in den 1950er und frühen 1960er Jahren. Es untersucht den Zusammenhang zwischen dem stark ansteigenden Tourismus und den im Film dargestellten Bildern von Italien. Die Reiseberichte und -erfahrungen der Deutschen werden als wichtiger Kontext für die filmische Darstellung analysiert, um die Wechselwirkung zwischen Realität und fiktionaler Darstellung zu untersuchen. Die Kapitel verbindet Tourismus und Film als Medien der Italien-Rezeption.
4. Der Schlager: Das Kapitel widmet sich der Rolle des Schlagers als musikalisches Medium, das Klischees und Stereotype über Italien vermittelt und verstärkt. Es analysiert, wie musikalische Elemente und Texte zum Aufbau eines bestimmten Italienbildes beitragen und wie diese Bilder in den Filmen der Zeit aufgegriffen und weiterverarbeitet werden. Der Schlager wird als ein bedeutender Faktor für die Verbreitung und Festigung von Klischees über Italien betrachtet.
5. Filme mit Italien als Handlungsschauplatz: Dieses Kapitel analysiert Filme, die Italien als Handlungsort haben. Es unterteilt die Filme nach Genres (Operettenfilme, Revuefilme, musikalische Lustspiele) und untersucht, wie das Italienbild in diesen verschiedenen Genres konstruiert und dargestellt wird. Die Analyse betrachtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung Italiens in den jeweiligen Gattungen und untersucht, wie die einzelnen Genres zu dem Gesamtbild Italiens im deutschen Film beitragen. Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Italienbildes innerhalb der verschiedenen Filmgenres.
6. Das Italienbild in Filmen ohne Italien-Komplex: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung Italiens in Filmen, deren Handlung nicht explizit in Italien spielt. Die Analyse konzentriert sich auf die Art und Weise, wie Italien als Thema in Dialogen, durch italienische Figuren oder als Lebensstil in Deutschland dargestellt wird. Es wird untersucht, ob und wie auch in diesen Filmen Klischees und Stereotype über Italien zum Tragen kommen und welche Rolle Italien in diesen Filmen spielt. Dieses Kapitel veranschaulicht die tiefgreifende Präsenz des Italienbildes im deutschen Film, auch außerhalb von explizit italienischen Kontexten.
7. Entwicklungstendenzen des Italienbildes in den deutschen Filmen bis heute: (Kapitel 7 und 8 sind ausgelassen um Spoiler zu vermeiden)
Schlüsselwörter
Italienbild, deutscher Film, 1950er Jahre, 1960er Jahre, Klischees, Stereotype, Tourismus, Schlager, Musikfilme, Operette, Revue, Nachkriegsgesellschaft, Arkadien, typisierung, Standardisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: "Das Italienbild im deutschen Film der 1950er und frühen 1960er Jahre"
Welche Themen werden in der Magisterarbeit behandelt?
Die Magisterarbeit analysiert die Darstellung Italiens im deutschen Film der 1950er und frühen 1960er Jahre. Im Fokus stehen die Entstehung und Entwicklung von Klischees und Stereotypen über Italien in dieser Zeit und deren Einfluss auf das deutsche Bild von Italien. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem starken Italien-Tourismus und der filmischen Darstellung des Landes.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte den Ursprung und die Entwicklung von Klischees und Stereotypen über Italien im deutschen Film der 1950er und frühen 1960er Jahre analysieren und deren Einfluss auf das Bild Italiens im deutschen Bewusstsein beleuchten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Verbindung zwischen dem damaligen Tourismusboom und der filmischen Darstellung Italiens.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit untersucht deutsche Filme der 1950er und frühen 1960er Jahre. Ostdeutsche Filme wurden ausgeschlossen, österreichische Filme hingegen miteinbezogen. Koproduktionen wurden ausgeschlossen, um die unverfälschte deutsche Perspektive zu gewährleisten. Zusätzlich werden zeitgenössische Reiseberichte herangezogen, um den Kontext der filmischen Darstellungen zu beleuchten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Auswahl des Untersuchungsmaterials, Die Deutschen reisen/ Italien: Reiseziel Nr. 1, Der Schlager, Filme mit Italien als Handlungsschauplatz (inkl. Unterkapitel zu verschiedenen Filmgenres), Das Italienbild in Filmen ohne Italien-Komplex, Entwicklungstendenzen des Italienbildes in den deutschen Filmen bis heute und Bella Italia, brutta Italia – das verlorene Paradies. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Darstellung Italiens im deutschen Film.
Welche Aspekte der filmischen Darstellung Italiens werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Klischees und Stereotype über Italien, den Einfluss des Italien-Tourismus auf die filmische Darstellung, die Entwicklung des Italienbildes im Laufe der 1950er und frühen 1960er Jahre und den Vergleich zwischen Musikfilmen und Filmen ohne expliziten Italien-Bezug. Die Rolle Italiens als Sehnsuchtsort ("Arkadien") im Kontext der Nachkriegszeit wird ebenfalls untersucht.
Welche Rolle spielt der Schlager in der Arbeit?
Der Schlager wird als musikalisches Medium betrachtet, das Klischees und Stereotype über Italien vermittelt und verstärkt. Die Arbeit analysiert, wie musikalische Elemente und Texte zum Aufbau eines bestimmten Italienbildes beitragen und wie diese Bilder in den Filmen der Zeit aufgegriffen und weiterverarbeitet werden.
Wie werden die Filme in der Arbeit kategorisiert?
Filme mit Italien als Handlungsort werden nach Genres unterteilt (Operettenfilme, Revuefilme, musikalische Lustspiele), um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung Italiens in den verschiedenen Genres zu untersuchen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die letzten beiden Kapitel der Arbeit (7 und 8) werden ausgelassen, um Spoiler zu vermeiden, beschreiben jedoch die Entwicklungstendenzen des Italienbildes bis in die Gegenwart sowie eine umfassende Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Italienbild, deutscher Film, 1950er Jahre, 1960er Jahre, Klischees, Stereotype, Tourismus, Schlager, Musikfilme, Operette, Revue, Nachkriegsgesellschaft, Arkadien, Typisierung, Standardisierung.
- Arbeit zitieren
- Gabriele Vogt (Autor:in), 1999, Auch wir waren in Arkadien - Italien im deutschen Film der 50er und beginnenden 60er Jahre, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18659