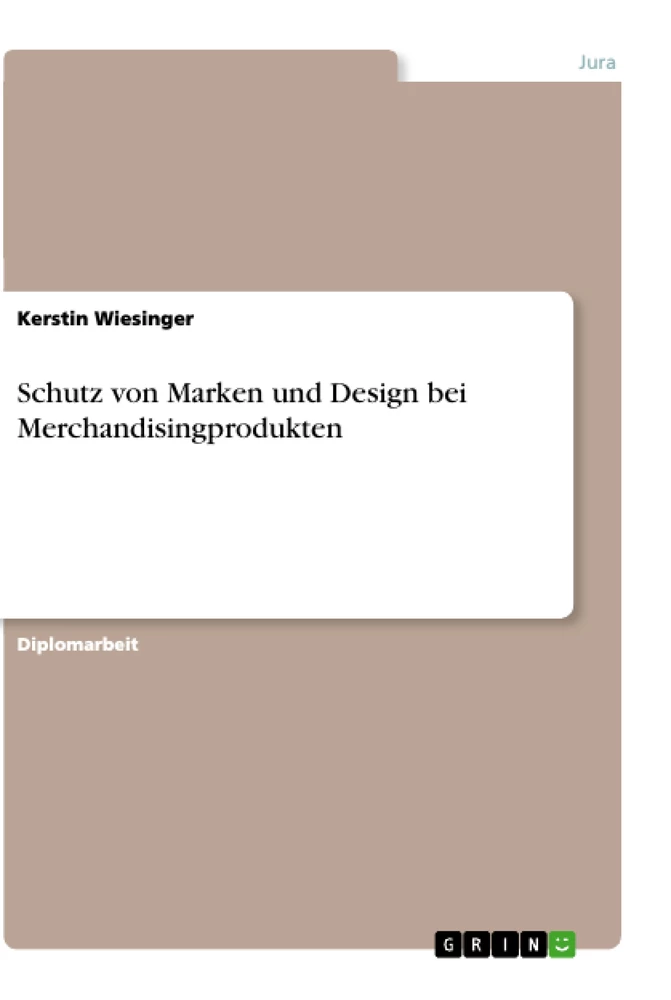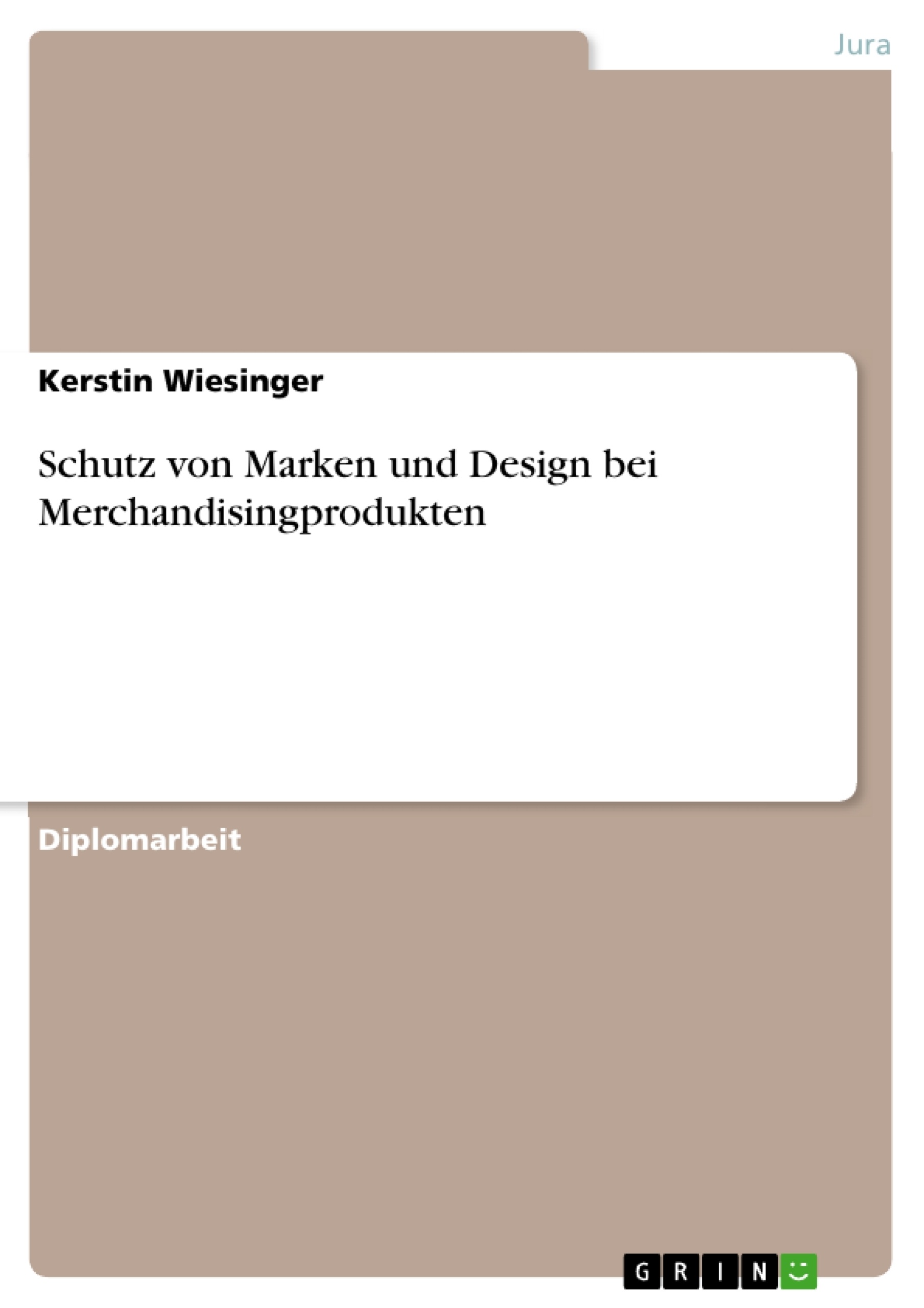Ziel der DA ist es ein grundlegendes Verständnis über die Vielzahl gewerblicher Schutzrechte und ihre besondere Bedeutung im Merchandising zu erzeugen. Die Arbeit beschäftigt sich mit einer präzisen Darstellung der Schutzbereiche einzelner Merchandising-Objekte. Der erste Teil beinhaltet die Abgrenzung der Immaterialgüterrechte hinsichtlich ihrer Dauer und Schutzvoraussetzungen. Danach erfolgt eine Begriffsdefinition von Merchandising und die Abgrenzung zum verwandten Licensing, sowie eine kurze Zusammenfassung der Historie bis zur heutigen Entwicklung dieser Vermarktungsformen. Neben den typischen Inhalten von Lizenzverträgen wird auch die rechtliche Einordnung von Lizenzen behandelt. Nach der Vorstellung einzelner Merchandising-Objekte erfolgt eine detaillierte Darstellung der Rechtsgebiete in denen derartige Objekte Schutz genießen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Entwicklung des Musterschutzes
- 3. Einteilung der Immaterialgüterrechte
- 3.1 Patent
- 3.1.1 Patentgegenstand und Schutzvoraussetzungen
- 3.1.2 Entstehung, Inhalt und Schutzumfang
- 3.1.3 Schutzdauer
- 3.2 Gebrauchsmuster
- 3.2.1 Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen
- 3.2.2 Entstehung, Inhalt und Schutzumfang
- 3.2.3 Schutzdauer und Verlängerung
- 3.3 Geschmacksmusterrecht/Designschutz
- 3.3.1 Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen
- 3.3.2 Entstehung, Inhalt und Schutzumfang
- 3.3.3 Schutzdauer und Verlängerung
- 3.4 Markenrecht
- 3.4.1 Schutzgegenstand und Voraussetzungen
- 3.4.2 Entstehung, Inhalt und Schutzumfang
- 3.4.3 Schutzdauer und Verlängerung
- 3.5 Urheberrecht
- 3.5.1 Schutzgegenstand und Voraussetzungen
- 3.5.2 Entstehung, Inhalt und Schutzumfang
- 3.5.3 Schutzdauer
- 3.6 UWG/Wettbewerbsrecht
- 3.6.1 Schutzgegenstand und Voraussetzungen
- 3.6.2 Schutzdauer
- 3.1 Patent
- 4. Merchandising
- 4.1 Definition
- 4.2 Abgrenzung von Merchandising und Licensing
- 4.3 Formen des Merchandisings
- 4.4 Problembereiche und Konfliktfelder
- 5. Licensing
- 5.1 Historische Entwicklung
- 5.2 Lizenzmarkt
- 5.2.1 Quantitative Sicht
- 5.2.2 Qualitative Sicht
- 5.3 Beteiligte im Licensing
- 5.3.1 Lizenzgeber
- 5.3.2 Lizenznehmer
- 5.3.3 Licensing-Dienstleister
- 5.3.4 Medien und Mediennutzer
- 6. Merchandising-Lizenzverträge
- 6.1 Rechtsnatur des Lizenzvertrages
- 6.2 Vertragsinhalt
- 6.2.1 Lizenzarten
- 6.2.2 Inhaltliche Schranken des Lizenzvertrages
- 6.2.3 Lizenzgebühr
- 6.3 Gestaltungstypen/Standardformen
- 7. Rechtsübertragung/Gestattung
- 7.1 Lizenzvergabe auf Grundlage urheberrechtlichen Schutzes
- 7.2 Lizenzvergabe auf Grundlage leistungsschutzrechtlichen Schutzes
- 7.3 Lizenzvergabe auf Grundlage geschmacksmusterrechtlichen Schutzes
- 7.4 Lizenzvergabe von Marken
- 7.5 Lizenzvergabe auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage
- 7.6 Lizenzvergabe auf Grundlage persönlichkeitsrechtlichen Schutzes
- 8. Merchandising-Objekte als Vertragsgegenstand
- 8.1 Fiktive Figuren
- 8.2 Reale Personen
- 8.3 Namen, Titel und andere wörtliche Zeichen
- 8.4 Signets, Logos, Etiketten und bildliche Zeichen
- 8.5 Ausstattungselemente, Designs und Dekorationen
- 8.6 Bilder
- 9. Erscheinungsformen des Licensing
- 9.1 Reinformen
- 9.1.1 Brand-Licensing
- 9.1.2 Character-Licensing
- 9.1.3 Personality-Licensing
- 9.1.4 Event-Licensing
- 9.2 Mischformen
- 9.1 Reinformen
- 10. Rechtlicher Schutz der Merchandising-Objekte
- 10.1 Urheberrechtlicher Schutz
- 10.1.1 Fiktive Figuren
- 10.1.2 Reale Personen
- 10.1.3 Namen, Titel und andere wörtliche Zeichen
- 10.1.4 Signets, Logos, Etiketten und bildliche Zeichen
- 10.1.5 Ausstattungselemente, Designs und Dekorationen
- 10.1.6 Bilder (Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Filmbilder)
- 10.2 Das Leistungsschutzrechte
- 10.3 Geschmacksmusterschutz
- 10.3.1 Fiktive Figuren
- 10.3.2 Reale Personen
- 10.3.3 Signets, Logos, Etiketten und bildliche Zeichen
- 10.3.4 Ausstattungselemente, Designs, Dekorationen
- 10.3.5 Bilder (Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Filmbilder)
- 10.4 Markenrechtlicher Schutz
- 10.4.1 Fiktive Figuren
- 10.4.2 Reale Personen
- 10.4.3 Namen, Titel und andere wörtliche Zeichen
- 10.4.4 Signets, Logos, Etiketten und bildliche Zeichen
- 10.4.5 Ausstattungselemente, Designs, Dekorationen
- 10.4.6 Bilder (Fotografien, Gemälde oder Zeichnungen)
- 10.5 Wettbewerbsrechtlicher Schutz
- 10.5.1 Fiktive Figuren
- 10.5.2 Literarische Figuren
- 10.5.3 Reale Personen
- 10.5.4 Namen, Titel und andere wörtliche Zeichen
- 10.5.5 Signets, Logos, Etiketten und bildliche Zeichen
- 10.5.6 Ausstattungselemente, Designs, Dekorationen
- 10.5.7 Bilder
- 10.6 Persönlichkeitsrechtlicher Schutz
- 10.6.1 Recht am eigenen Bild
- 10.6.2 Namensrecht
- 10.6.3 Allgemeines Persönlichkeitsrecht
- 10.1 Urheberrechtlicher Schutz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Schutz von Marken und Design bei Merchandising-Produkten im deutschen Recht. Die Zielsetzung ist es, einen umfassenden Überblick über die relevanten Rechtsgebiete und deren Anwendung in der Praxis zu geben. Dabei werden die verschiedenen Schutzmöglichkeiten für Merchandising-Objekte beleuchtet und die Herausforderungen bei der Lizenzvergabe und -verwertung analysiert.
- Historische Entwicklung des Musterschutzes
- Übersicht und Abgrenzung verschiedener gewerblicher Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Markenrecht, Urheberrecht, UWG)
- Merchandising und Licensing: Definition, Abgrenzung und Formen
- Rechtliche Aspekte von Merchandising-Lizenzverträgen
- Schutz der verschiedenen Merchandising-Objekte (fiktive und reale Personen, Namen, Logos, Designs etc.)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht den Schutz von Marken und Design im Kontext des Merchandising, ausgehend von der wachsenden Bedeutung des Immaterialgüterrechts angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und der Produktpiraterie. Der Fall des Opel-Blitz-Logos auf Spielzeugautos wird als einleitendes Beispiel für die Komplexität des Themas angeführt, wobei die Bedeutung des EU-Rechts und die hohen wirtschaftlichen Schäden durch Produktpiraterie hervorgehoben werden. Die Arbeit verspricht eine Analyse der historischen Entwicklung des Musterschutzes, eine Übersicht der Immaterialgüterrechte und eine eingehende Betrachtung des Merchandisings, einschließlich des rechtlichen Schutzes der verwendeten Objekte.
2. Historische Entwicklung des Musterschutzes: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Musterschutzes, beginnend mit den frühen Bedürfnissen der Textilindustrie im 16. Jahrhundert bis hin zur Einführung des deutschen Geschmacksmustergesetzes im Jahr 1876. Der Übergang vom zünftigen System des Mittelalters zum Privilegienwesen der frühen Neuzeit und die Herausbildung des naturrechtlichen Gedankens des geistigen Eigentums werden ausführlich dargestellt, mit Fokus auf die Entwicklungen in Italien, Schweden und England. Der deutsche Weg zu einem einheitlichen Musterschutz wird im Kontext des wirtschaftlichen Aufstiegs Deutschlands beschrieben.
3. Einteilung der Immaterialgüterrechte: Kapitel 3 bietet eine umfassende Übersicht der Immaterialgüterrechte, beginnt mit der Definition und dem Zweck dieser Rechte, besonders mit Bezug auf den technischen Fortschritt und die wirtschaftliche Verwertung von Ideen. Die Kapitel unterteilt die verschiedenen gewerblichen Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken) und das Urheberrecht sowie das UWG, und diskutiert deren individuelle Anwendungsbereiche und Anforderungen. Die Bedeutung internationaler Schutzrechtsanmeldungen wird im Kontext des globalen Handels betont.
4. Merchandising: Das Kapitel definiert Merchandising und grenzt es von Licensing ab. Es diskutiert die unterschiedlichen Formen des Merchandisings, die jeweiligen Zielsetzungen und die Herausforderungen, die sich durch Sättigungstendenzen, Überangebot, und Probleme in der Kommunikation und Partnerschaft ergeben. Der Fall „Winnie-Pooh“ illustriert die möglichen Konflikte um Rechte und Lizenzzahlungen im Merchandising-Bereich.
5. Licensing: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Licensing, von den frühen Beispielen mit Adelsnamen und Comicfiguren bis zum gegenwärtigen Boom. Der Lizenzmarkt wird sowohl quantitativ (Umsatzzahlen, Wachstum) als auch qualitativ (Differenzierung, Konsolidierung) analysiert. Es werden die verschiedenen Akteure (Lizenzgeber, Lizenznehmer, Dienstleister, Medien) und deren jeweilige Ziele und Interessen detailliert beschrieben. Die Rolle der LIMA-Studien und Marktanalysen wird hervorgehoben.
6. Merchandising-Lizenzverträge: Kapitel 6 befasst sich eingehend mit der Rechtsnatur von Merchandising-Lizenzverträgen, deren fehlende explizite gesetzliche Regelung und die entsprechende Anwendung allgemeiner zivilrechtlicher Bestimmungen. Es werden verschiedene Lizenzarten (einfache und exklusive Lizenzen) und deren Vertragsinhalte (Lizenzgebühren, räumliche und zeitliche Beschränkungen) erklärt. Das Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Vertragstypen und analysiert deren rechtliche Implikationen.
7. Rechtsübertragung/Gestattung: Kapitel 7 analysiert die verschiedenen Arten der Rechtsübertragung und Gestattung im Kontext der Lizenzvergabe für Merchandising. Es wird im Detail auf die jeweiligen Regelungen für Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, Geschmacksmusterrechte, Markenrechte, wettbewerbsrechtliche Positionen und Persönlichkeitsrechte eingegangen und ihre Bedeutung im Lizenzgeschäft erläutert.
8. Merchandising-Objekte als Vertragsgegenstand: Dieses Kapitel kategorisiert die verschiedenen Arten von Merchandising-Objekten (fiktive und reale Personen, Namen, Logos, Designs etc.) und ordnet diese systematisch den verschiedenen Rechtsgebieten zu, um ihre Schutzmöglichkeiten zu verdeutlichen.
9. Erscheinungsformen des Licensing: Kapitel 9 beschreibt die verschiedenen Erscheinungsformen des Licensing (Reinformen und Mischformen), unterteilt in Character-, Personality-, Brand- und Event-Licensing, und analysiert deren jeweilige Charakteristika, Zielgruppen, und Risiken. Der Fall der FIFA WM 2006 dient als Beispiel für Event-Licensing und die damit verbundenen markenrechtlichen Herausforderungen.
10. Rechtlicher Schutz der Merchandising-Objekte: Kapitel 10 bietet eine detaillierte Analyse der rechtlichen Schutzmöglichkeiten von Merchandising-Objekten unter verschiedenen Rechtsgebieten (Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Geschmacksmusterrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Persönlichkeitsrecht). Es werden die verschiedenen Schutzvoraussetzungen und deren Anwendung auf konkrete Merchandising-Objekte untersucht, mit zahlreichen Beispielen und Gerichtsentscheidungen.
Schlüsselwörter
Merchandising, Licensing, Immaterialgüterrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Geschmacksmusterrecht, Gebrauchsmuster, Patent, Wettbewerbsrecht, Persönlichkeitsrecht, Lizenzvertrag, Produktpiraterie, Imagetransfer, Lizenzgebühren, Rechtsübertragung, Warenkennzeichnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Schutz von Marken und Design bei Merchandising-Produkten im deutschen Recht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über den rechtlichen Schutz von Marken und Design im Kontext von Merchandising-Produkten im deutschen Recht. Sie analysiert die relevanten Rechtsgebiete, deren Anwendung in der Praxis und die Herausforderungen bei der Lizenzvergabe und -verwertung.
Welche Rechtsgebiete werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Immaterialgüterrechte, darunter Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht, Markenrecht, Urheberrecht, und Wettbewerbsrecht (UWG), sowie das Persönlichkeitsrecht. Der Fokus liegt auf deren Anwendung im Merchandising- und Lizenzbereich.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die historische Entwicklung des Musterschutzes, die Abgrenzung verschiedener gewerblicher Schutzrechte, die Definition und Abgrenzung von Merchandising und Licensing, die rechtlichen Aspekte von Merchandising-Lizenzverträgen, und der Schutz verschiedener Merchandising-Objekte (fiktive und reale Personen, Namen, Logos, Designs etc.).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zehn Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einer historischen Betrachtung des Musterschutzes. Es folgen Kapitel zur Einteilung der Immaterialgüterrechte, Merchandising, Licensing, Merchandising-Lizenzverträgen, Rechtsübertragung/Gestattung, Merchandising-Objekten als Vertragsgegenstand, Erscheinungsformen des Licensing, und schließlich dem rechtlichen Schutz der Merchandising-Objekte unter verschiedenen Rechtsgebieten.
Welche Arten von Merchandising-Objekten werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Schutz verschiedener Merchandising-Objekte, darunter fiktive und reale Personen, Namen, Titel, wörtliche Zeichen, Signets, Logos, Etiketten, bildliche Zeichen, Ausstattungselemente, Designs, Dekorationen und Bilder (Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Filmbilder).
Welche Lizenzarten werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Lizenzarten, einschließlich einfacher und exklusiver Lizenzen, und erläutert deren Vertragsinhalte wie Lizenzgebühren, räumliche und zeitliche Beschränkungen.
Welche rechtlichen Schutzmöglichkeiten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den rechtlichen Schutz von Merchandising-Objekten unter verschiedenen Rechtsgebieten: Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Geschmacksmusterrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Persönlichkeitsrecht. Sie untersucht die Schutzvoraussetzungen und deren Anwendung auf konkrete Beispiele.
Welche praktischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet praktische Herausforderungen wie Sättigungstendenzen, Überangebot, Kommunikationsprobleme in Partnerschaften, Konflikte um Rechte und Lizenzzahlungen, und die Bedeutung internationaler Schutzrechtsanmeldungen im Kontext des globalen Handels.
Welche Fallbeispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene Fallbeispiele, darunter der Opel-Blitz auf Spielzeugautos zur Veranschaulichung der Komplexität des Themas und der Fall „Winnie-Pooh“ zur Illustration von Konflikten im Merchandising-Bereich. Der Fall der FIFA WM 2006 dient als Beispiel für Event-Licensing.
Wo finde ich Schlüsselwörter zum Thema?
Schlüsselwörter zum Thema sind: Merchandising, Licensing, Immaterialgüterrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Geschmacksmusterrecht, Gebrauchsmuster, Patent, Wettbewerbsrecht, Persönlichkeitsrecht, Lizenzvertrag, Produktpiraterie, Imagetransfer, Lizenzgebühren, Rechtsübertragung, Warenkennzeichnung.
- Arbeit zitieren
- Kerstin Wiesinger (Autor:in), 2009, Schutz von Marken und Design bei Merchandisingprodukten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186684