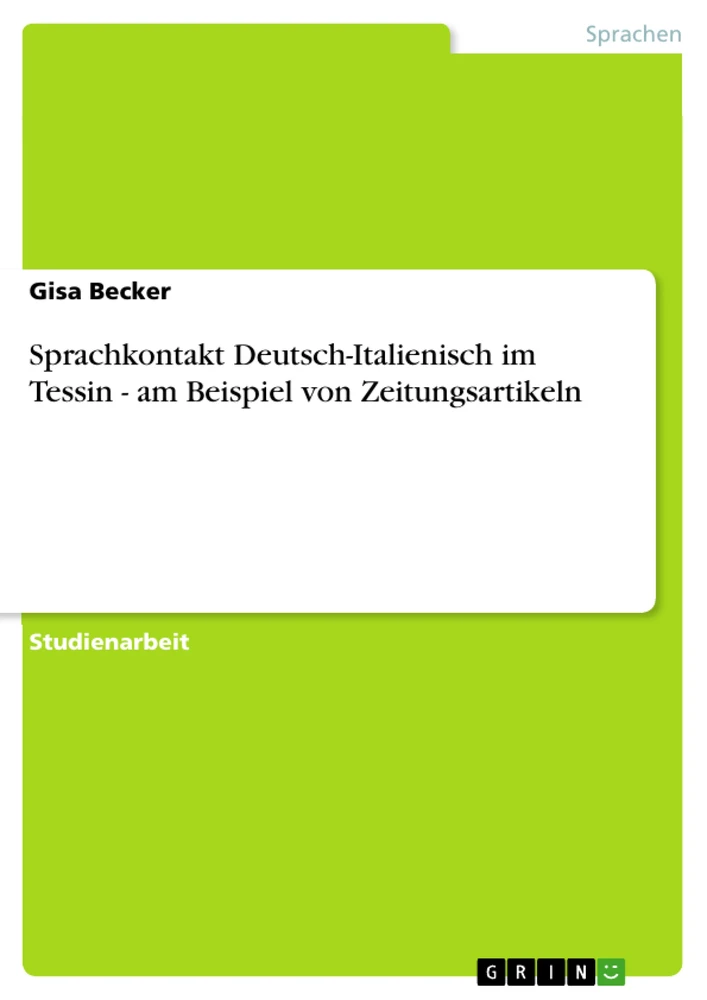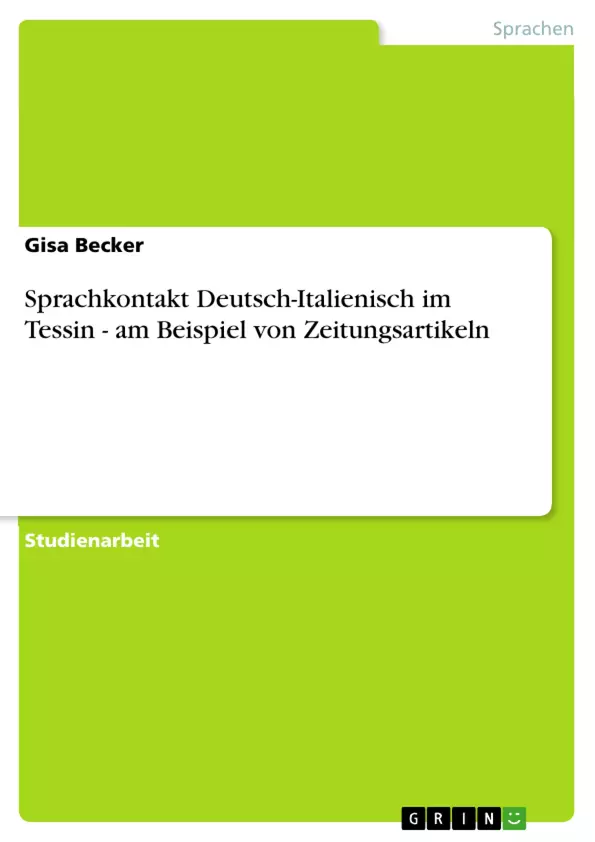Die Schweiz stellt insgesamt ein sehr interessantes Forschungsgebiet in Bezug auf Sprachen dar, da sie über vier Nationalsprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch) verfügt (vgl. Dürmüller, 1996, 11) und es dort verstärkt zu Sprachkontakten kommt. Die Sprachensituation im Tessin stellt innerhalb der Schweiz zudem ein sehr interessantes Untersuchungsgebiet dar, da es sich um eine mehrheitlich italienischsprachige Region handelt, in der jedoch auch das Deutsche als Minderheitensprache vorhanden ist und eine wichtige Rolle spielt. Deutsch und Italienisch stehen im Tessin in besonderem Maße in Kontakt, da das Deutsche in Bezug auf die Schweiz insgesamt und auch in verschiedenen Wirtschaftszweigen des Tessins sehr bedeutsam ist und andererseits das Italienische die Muttersprache der überwiegenden Mehrheit der Bewohner des Kantons darstellt (vgl. Petralli, 1991). Die beiden Sprachen stellen somit, je nachdem welches Gebiet man betrachtet (Gesamtschweiz oder Tessin), jeweils Minderheits- oder Mehrheitssprachen dar. Interessant ist, zu untersuchen, wie sich in heutiger Zeit der Sprachkontakt auf die beiden Sprachen auswirkt. In dieser Arbeit werden hierzu tessinische Zeitungen beider Sprachen anhand einer primär synchronen Vorgehensweise auf Sprachkontaktphänomene hin untersucht. Zeitungsartikel spiegeln das tägliche Leben stets recht aktuell wieder und sollten in einer Sprache verfasst sein, die korrekt jedoch nicht literarisch ist (vgl. SEM 65, 41), was Zeitungen geeignet erscheinen lässt, um sprachliche Veränderungen zu untersuchen.
Diese Arbeit zum deutsch-italienischen Sprachkontakt im Tessin ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ein Versuch, die Theorie zur Interferenz im Sprachkontakt anhand von Zeitungstexten anzuwenden. In Kapitel 2 wird zunächst etwas genauer darauf eingegangen, was Sprachkontakt bedeutet und welche sprachlichen Phänomene daraus resultieren können. Kapitel 3 dient dazu, die sprachliche Situation im Tessin etwas genauer zu beleuchten und im vierten Kapitel werden zunächst Vorgehensweise und Materialien der Untersuchung der Zeitungsartikel dargelegt und anschließend die Ergebnisse vorgestellt. Das letzte Kapitel stellt eine kurze Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachkontakt
- Sprachkontaktsituation im Tessin
- Untersuchung des Sprachkontakts anhand von Zeitungsartikeln
- Entlehnungen
- Deutsche Entlehnungen ohne erkennbare Genuszuordnung
- Deutsche Lehnwörter: semantische Kriterien der Genuszuordnung
- Deutsche Lehnwörter: semantische und morphologisch-phonologische Kriterien der Genuszuordnung
- Deutsche Lehnwörter: morphologisch-phonologische Kriterien der Genuszuordnung
- Italienische Entlehnungen ohne erkennbare Genuszuordnung
- Italienische Lehnwörter: semantische Kriterien der Genuszuordnung
- Italienische Lehnwörter: semantische und morphologisch-phonologische Kriterien der Genuszuordnung
- Italienische Lehnwörter: morphologisch-phonologische Kriterien der Genuszuordnung
- Genuszuordnung bei hybriden Zusammensetzungen in der TZ
- Voranstellung der Adjektive im CdT
- Entlehnungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den deutsch-italienischen Sprachkontakt im Tessin anhand von Zeitungsartikeln. Ziel ist es, Sprachkontaktphänomene, insbesondere lexikalische Interferenzen und deren Auswirkungen auf die Genuszuordnung von Lehnwörtern, zu analysieren. Die Untersuchung basiert auf einer primär synchronen Vorgehensweise.
- Analyse des deutsch-italienischen Sprachkontakts im Tessin.
- Untersuchung lexikalischer Interferenzen (Lehnwörter und Lehnbildungen).
- Bedeutung semantischer und morphologisch-phonologischer Kriterien bei der Genuszuordnung von Lehnwörtern.
- Einfluss des Sprachkontakts auf die grammatische Struktur der beteiligten Sprachen.
- Verwendung von Zeitungsartikeln als Korpus zur Erforschung aktueller Sprachentwicklungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Sprachsituation in der Schweiz, insbesondere im Tessin, als ein interessantes Forschungsfeld für Sprachkontaktphänomene zwischen Deutsch und Italienisch. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Zeitungsartikeln als Spiegel des täglichen Sprachgebrauchs und wählt eine primär synchrone Vorgehensweise. Die einzelnen Kapitel und ihre Ziele werden kurz vorgestellt.
Sprachkontakt: Dieses Kapitel definiert den Begriff Sprachkontakt und die daraus resultierenden Interferenzen. Es werden verschiedene Arten des lexikalischen Transfers (z.B. einfache Elemente, analysierte Zusammensetzungen, Lehnübersetzungen, hybride Zusammensetzungen) erläutert und die Integration von Lehnwörtern in die Grammatik der jeweiligen Zielsprache diskutiert. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Gebersprache und Nehmersprache und den Faktoren, die die Stärke des Transfers beeinflussen. Der Einfluss soziokultureller und struktureller Faktoren auf die Intensität des Sprachkontakts wird ebenfalls behandelt.
Sprachkontaktsituation im Tessin: Dieses Kapitel (obwohl der Text nur die Überschrift nennt) würde im vollständigen Text die spezifische sprachliche Situation im Tessin detailliert beschreiben, unter Berücksichtigung der sprachlichen und sozialen Faktoren, die den deutsch-italienischen Sprachkontakt prägen. Es legt die Grundlage für die spätere Analyse der Zeitungsartikel, indem es den Kontext und die Besonderheiten des Tessins als Untersuchungsgebiet herausarbeitet. Der Fokus liegt hier auf dem Zusammenspiel von Deutsch und Italienisch als Minderheiten- bzw. Mehrheitssprache und den daraus resultierenden Interaktionen.
Schlüsselwörter
Sprachkontakt, Deutsch-Italienisch, Tessin, Zeitungsartikel, Lexikalische Interferenz, Lehnwörter, Genuszuordnung, Semantik, Morphologie, Phonologie, Mehrsprachigkeit, Sprachvariation.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Deutsch-Italienischer Sprachkontakt im Tessin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den deutsch-italienischen Sprachkontakt im Tessin anhand von Zeitungsartikeln. Der Fokus liegt auf der Analyse lexikalischer Interferenzen und deren Auswirkungen auf die Genuszuordnung von Lehnwörtern in dieser Sprachkontaktsituation.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine primär synchrone Vorgehensweise und analysiert Zeitungsartikel als Korpus, um aktuelle Sprachentwicklungen zu untersuchen. Es werden semantische und morphologisch-phonologische Kriterien zur Analyse der Genuszuordnung von Lehnwörtern herangezogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den deutsch-italienischen Sprachkontakt im Tessin, lexikalische Interferenzen (Lehnwörter und Lehnbildungen), die Bedeutung semantischer und morphologisch-phonologischer Kriterien bei der Genuszuordnung von Lehnwörtern, den Einfluss des Sprachkontakts auf die Grammatik und die Verwendung von Zeitungsartikeln als Korpus zur Erforschung aktueller Sprachentwicklungen.
Welche Arten von Lehnwörtern werden untersucht?
Die Analyse umfasst deutsche und italienische Entlehnungen in Zeitungstexten aus dem Tessin. Es wird zwischen Lehnwörtern ohne erkennbare Genuszuordnung und solchen unterschieden, bei denen semantische und/oder morphologisch-phonologische Kriterien für die Genuszuordnung relevant sind. Auch hybride Zusammensetzungen werden betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zum Sprachkontakt allgemein und zur Sprachkontaktsituation im Tessin, eine detaillierte Untersuchung von Lehnwörtern in Zeitungsartikeln (inkl. Untersuchung der Genuszuordnung anhand verschiedener Kriterien), und eine Zusammenfassung. Die Kapitel zur Untersuchung der Lehnwörter betrachten deutsche und italienische Lehnwörter separat, unterteilt nach semantischen und morphologisch-phonologischen Kriterien für die Genuszuordnung.
Welche Rolle spielen Zeitungsartikel in dieser Studie?
Zeitungsartikel dienen als Korpus, um den aktuellen Sprachgebrauch im Tessin abzubilden und den deutsch-italienischen Sprachkontakt in einem realen Kontext zu untersuchen. Sie spiegeln den täglichen Sprachgebrauch wider und ermöglichen die Analyse aktueller Sprachentwicklungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Sprachkontakt, Deutsch-Italienisch, Tessin, Zeitungsartikel, Lexikalische Interferenz, Lehnwörter, Genuszuordnung, Semantik, Morphologie, Phonologie, Mehrsprachigkeit, Sprachvariation.
Welche Art von Sprachkontakt wird fokussiert?
Der Fokus liegt auf dem lexikalischen Transfer, d.h. der Übernahme von Wörtern aus der einen Sprache (Gebersprache) in die andere (Nehmersprache). Die Arbeit untersucht dabei insbesondere die Auswirkungen dieses Transfers auf die grammatische Struktur der Nehmersprache, speziell die Genuszuordnung von Lehnwörtern.
Welche sprachlichen Phänomene werden im Detail analysiert?
Im Detail analysiert die Arbeit die Genuszuordnung von Lehnwörtern aus dem Deutschen und Italienischen im Tessiner Kontext. Es wird untersucht, inwieweit semantische und morphologisch-phonologische Merkmale die Genuszuweisung beeinflussen.
Wo wird die spezifische Sprachsituation im Tessin beschrieben?
Die spezifische Sprachsituation im Tessin, einschließlich der relevanten sprachlichen und sozialen Faktoren, wird in einem eigenen Kapitel (Sprachkontaktsituation im Tessin) detailliert beschrieben. Dieses Kapitel bildet die Grundlage für die Analyse der Zeitungsartikel.
- Citation du texte
- Dipl.-Betriebswirtin (BA) und M.A. Gisa Becker (Auteur), 2009, Sprachkontakt Deutsch-Italienisch im Tessin - am Beispiel von Zeitungsartikeln , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186741