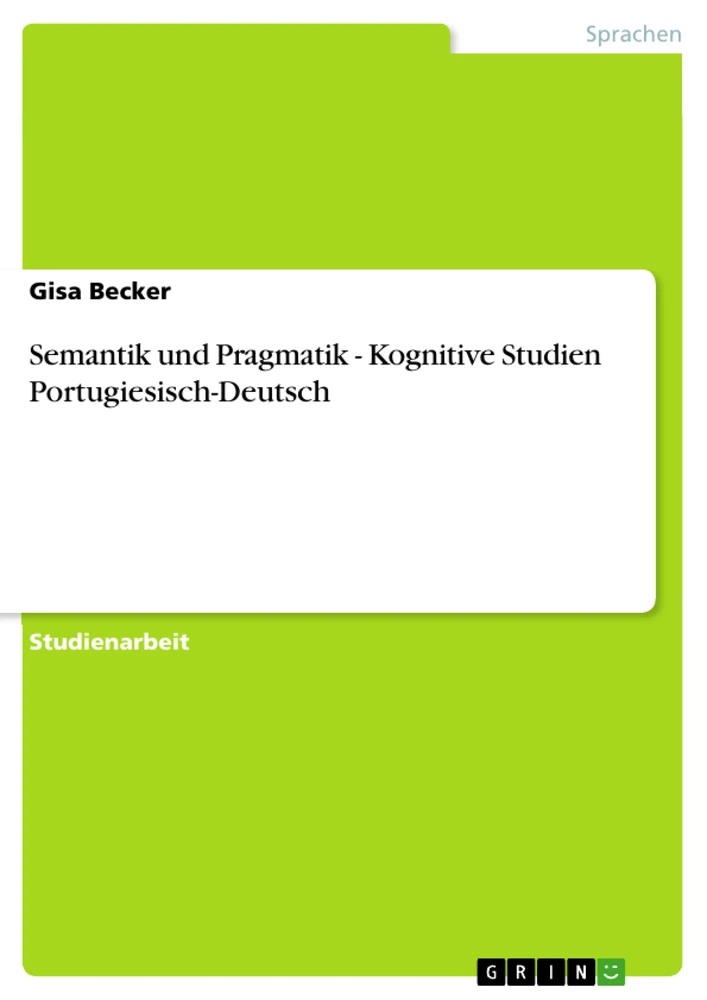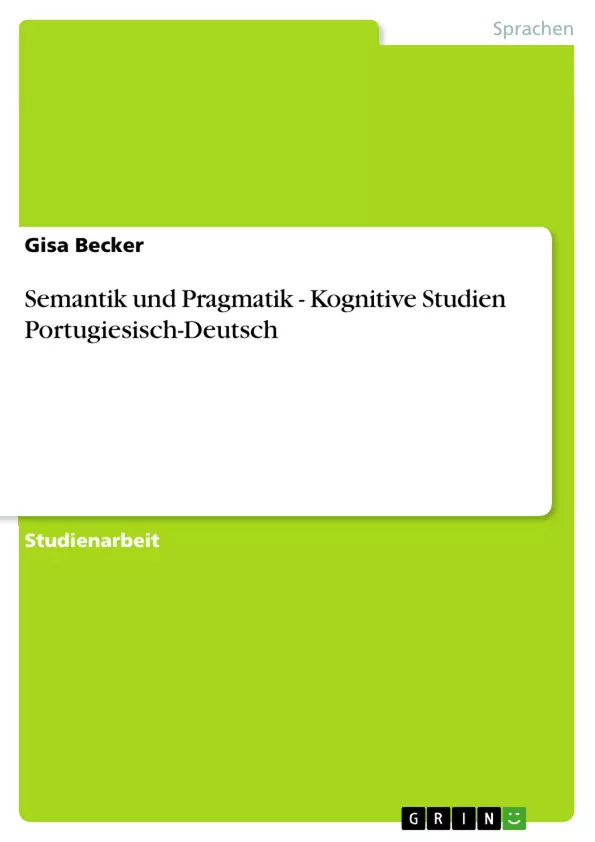Im Seminar "Wort und Bedeutung ? Aspekte der portugiesischen Semantik" haben wir uns mit sehr unterschiedlichen Aspekten der portugiesischen Semantik auseinandergesetzt. Wir haben dabei unterschiedliche Theorien kennen gelernt und verschiedene Begrifflichkeiten anhand portugiesischer Beispiele erklärt und verdeutlicht. Zunächst haben wir uns mit der Bedeutung einzelner Worte und ihren semantischen Relationen beschäftigt. Anschließend auch mit der Satzsemantik sowie Metaphern und Metonymie. In mehreren Unterrichtseinheiten haben wir uns mit der kognitiven Semantik beschäftigt, mit der sich auch diese Ausarbeitung befasst. Es wird zunächst darum gehen, die Bereiche Semantik und Pragmatik kurz vorzustellen, um anschließend kognitive Studien zum Portugiesischen vorzustellen. Anhand dieser Studien wird verdeutlicht, wie Sprecher gewisse Intentionen sprachlich ausdrücken können. Die erste Studie befasst sich mit kausal-konsekutiven Beziehungen, die mit oder ohne Konjunktionen ausgedrückt werden und die zweite Studie mit der Realisierung real und nicht real bedingter Kausalität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Semantik und Pragmatik
- Kognitive Studien
- Realisierungsmechanismen der kausal-konsekutiven Beziehungen ohne oder mit Konjunktionen
- Realisierungsmechanismen der (nicht) real bedingten Kausalität
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht Aspekte der portugiesischen Semantik und Pragmatik im Kontext kognitiver Linguistik. Sie beleuchtet die Umsetzung von Sprecherintentionen in sprachliche Äußerungen anhand von Fallstudien. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen lexikalischer Bedeutung, aktuellem Kontext und kommunikativem Sinn.
- Untersuchung der Beziehung zwischen Semantik und Pragmatik
- Analyse kognitiver Prozesse in der Sprachproduktion und -rezeption
- Beschreibung der Realisierung kausal-konsekutiver Beziehungen im Portugiesischen
- Untersuchung der sprachlichen Umsetzung von real und nicht real bedingter Kausalität
- Anwendung von Konzepten der Aussagenlogik und der Sprechakttheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Ausarbeitung im Rahmen eines Seminars zur portugiesischen Semantik. Sie gibt einen Überblick über die behandelten Themen, von der Bedeutung einzelner Wörter bis hin zur kognitiven Semantik, und kündigt die beiden Fokusstudien zur kausal-konsekutiven Beziehung und zur real und nicht real bedingten Kausalität an. Der Schwerpunkt liegt auf der Veranschaulichung, wie Sprecher ihre Intentionen sprachlich ausdrücken.
Semantik und Pragmatik: Dieses Kapitel differenziert zwischen Semantik (kontextunabhängige Bedeutungen) und Pragmatik (kontextabhängige Aspekte). Es beschreibt den Bezug zur Semiotik von Peirce und Morris und beleuchtet die Unterscheidung zwischen lexikalischen Bedeutungen (im mentalen Lexikon gespeichert) und aktuellen Bedeutungen (kontextabhängig). Der Begriff der konversationellen Implikatur wird eingeführt, um die pragmatische Bedeutung zu erklären, die sich aus der Situation und den Sprecherintentionen ergibt. Das Kapitel betont den fließenden Übergang zwischen Semantik und Pragmatik und die Bedeutung der prozeduralen Perspektive semantischer Kompetenz. Es wird die Rolle des Weltwissens des Hörers im Verständnis verdeckter sprachlicher Handlungen hervorgehoben.
Kognitive Studien: Dieses Kapitel führt in die kognitiven Studien ein, die die sprachliche Umsetzung von Konzepten im Kopf des Sprechers untersuchen. Es betont die Verbindung von Sprache mit anderen kognitiven Fähigkeiten und erklärt, dass die Bedeutung eines Satzes nicht nur die Summe der Bedeutung der einzelnen Wörter ist. Es werden die Konzepte der Aussagenlogik (Satzvariablen, Junktoren) und der Sprechakttheorie (Teilakte) als analytische Werkzeuge eingeführt. Die primäre Frage ist, wie Konzepte sprachlich umgesetzt werden können, um die Intentionen des Sprechers auszudrücken.
Schlüsselwörter
Portugiesische Semantik, Pragmatik, Kognitive Linguistik, Sprachproduktion, Sprachrezeption, Kausalität, Konjunktionen, Sprechakte, Aussagenlogik, Sprecherintention, lexikalische Bedeutung, aktuelle Bedeutung, konversationelle Implikatur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Ausarbeitung: Aspekte der portugiesischen Semantik und Pragmatik im Kontext kognitiver Linguistik
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht Aspekte der portugiesischen Semantik und Pragmatik im Kontext der kognitiven Linguistik. Sie konzentriert sich auf die Umsetzung von Sprecherintentionen in sprachliche Äußerungen, insbesondere im Hinblick auf kausal-konsekutive Beziehungen und real bzw. nicht real bedingte Kausalität.
Welche Themen werden behandelt?
Die Ausarbeitung behandelt die Beziehung zwischen Semantik und Pragmatik, analysiert kognitive Prozesse in der Sprachproduktion und -rezeption, beschreibt die Realisierung kausal-konsekutiver Beziehungen im Portugiesischen, untersucht die sprachliche Umsetzung von real und nicht real bedingter Kausalität und wendet Konzepte der Aussagenlogik und der Sprechakttheorie an.
Welche Kapitel umfasst die Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Semantik und Pragmatik, ein Kapitel zu kognitiven Studien (mit Fokus auf kausal-konsekutiven Beziehungen und (nicht) real bedingter Kausalität) und eine Zusammenfassung. Die Einleitung bietet einen Überblick über die behandelten Themen und die beiden Fokusstudien. Das Kapitel "Semantik und Pragmatik" differenziert zwischen kontextunabhängiger und kontextabhängiger Bedeutung und führt den Begriff der konversationellen Implikatur ein. Das Kapitel "Kognitive Studien" untersucht die sprachliche Umsetzung von Konzepten und verwendet Konzepte der Aussagenlogik und Sprechakttheorie als analytische Werkzeuge.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Ausarbeitung verwendet Konzepte der Aussagenlogik und der Sprechakttheorie als analytische Werkzeuge zur Untersuchung der sprachlichen Umsetzung von Sprecherintentionen. Sie basiert auf Fallstudien und analysiert die Interaktion zwischen lexikalischer Bedeutung, aktuellem Kontext und kommunikativem Sinn.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Portugiesische Semantik, Pragmatik, Kognitive Linguistik, Sprachproduktion, Sprachrezeption, Kausalität, Konjunktionen, Sprechakte, Aussagenlogik, Sprecherintention, lexikalische Bedeutung, aktuelle Bedeutung, konversationelle Implikatur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung zielt darauf ab, Aspekte der portugiesischen Semantik und Pragmatik im Kontext der kognitiven Linguistik zu untersuchen und die Umsetzung von Sprecherintentionen in sprachliche Äußerungen anhand von Fallstudien zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen lexikalischer Bedeutung, aktuellem Kontext und kommunikativem Sinn.
- Quote paper
- Dipl.-Betriebswirtin (BA) und M.A. Gisa Becker (Author), 2009, Semantik und Pragmatik - Kognitive Studien Portugiesisch-Deutsch , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186743