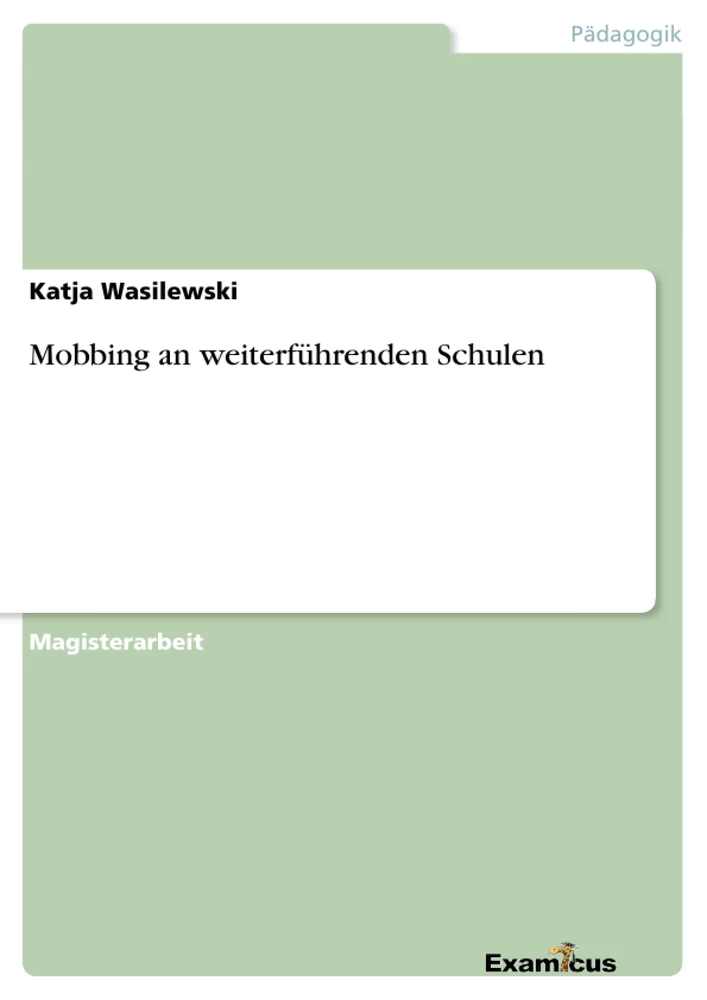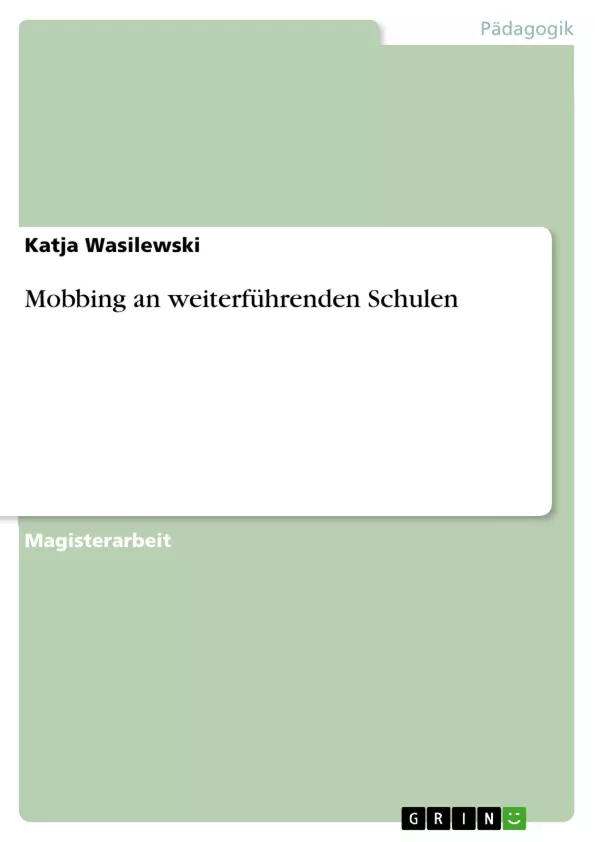Im Rahmen dieser Magisterarbeit wird das Thema Mobbing und dessen Prävention sowie der Umgang damit im Alltag der Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien erörtert.
Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen wird bei der Nennung von Personen und Gruppen nicht nach Geschlecht differenziert. Es wird die männliche Form verwendet, wobei die weibliche ausdrücklich eingeschlossen ist.
Der Begriff ?Täter? im Mobbingkontext beinhaltet immer auch eine Opferrolle, da vor allem Kinder noch nicht in vollem Umfang für ihre Taten verantwortlich sind und diese nicht selbstständig reflektieren können, bzw. durch Erziehung und ihr soziales Umfeld in diese Rolle gedrängt wurden (vgl. Jannan 2008).
Das Schikanieren von einzelnen innerhalb einer festen Gemeinschaft, wie z.B. in Arbeitsgruppen, ist hinlänglich bekannt und schon viele Jahrzehnte Gegenstand der Sozialpsychologie. Doch wurde bei den Untersuchungen das Augenmerk anfänglich nur auf Erwachsene gelegt, da man den Kindern und Jugendlichen solch psychosoziales ?Geschick? nicht zutraute. Schikanen in der Schule wurden als normales Phänomen der kindlichen Entwicklung betrachtet, als Vorbereitung auf das Leben. Machtkämpfe und Raufereien gehörten nach Ansicht der Gesellschaft zum Schulalltag. Die langfristigen Folgen täglichen Psychoterrors in der Kindheit und Pubertät wurden erst in den 80er Jahren von dem schwedischen Persönlichkeitspsychologen Dan Olweus von der Erwachsenenwelt auf die Schule übertragen. Nachdem in Schweden drei 10 bis 14 jährige Schüler auf Grund langwieriger Mobbingattacken Selbstmord begangen hatten, bekam das Thema weltweite Medienaufmerksamkeit und auch in Deutschland begann man sich mit den psychosozialen Bedingungen in der Schule zu befassen. Doch sind es immer noch nur meist die Fälle körperlicher Gewalt, die in den Schulen beobachtet werden und an die Öffentlichkeit kommen. Wie es in einem Kind aussieht, das täglich niedergemacht wird, kann man oft erst erkennen, wenn es schon zu spät ist, dessen Persönlichkeit völlig zerstört ist oder es mit auffälligem Verhalten auf seine Situation aufmerksam machen will. Der lange Leidensweg, den ein Kind während eines Mobbingprozesses durchläuft, ist oft für Außenstehende nicht sichtbar und für Menschen, die nicht selbst schon Mobbing erlebt haben, nicht leicht nachzuvollziehen. Aber stellt man sich vor, jede einzelne Mobbingattacke ist wie ein kleiner Nadelstich und man wird täglich von vielleicht über 20 anderen ständig gestochen, wird klar, dass so etwas zermürbt. Es wirkt wie eine unendliche Folter. ?
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Aufbau der Magisterarbeit
- Begriffsdefinitionen
- Gewalt
- Aggression
- Bullying/Mobbing
- Mobbing
- Mobbing aus pädagogischer Sicht
- Mobbingformen
- Die Dynamik und die Stadien eines Mobbingprozesses
- Mobbingrollen - Mobbing als kollektiver Prozess
- Mobbingstrukturen in einer Schulklasse
- Die Psychologischen Grundlagen des Mobbings
- Mobbing aus individualpsychologischer Sicht
- Mobbing aus sozialpsychologischer Sicht
- Auswirkungen von Erziehung und Familie auf Mobbing
- Opferprofil
- Die Sichtweise des betroffenen Kindes
- Täterprofil
- Folgen von Mobbing
- Physische Folgen
- Psychische Folgen
- Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung
- Unterbrechung der Kontinuität des Seins - Winnicott
- Auswirkungen auf die Klassenatmosphäre
- Prävention von und Intervention bei Mobbing
- Rechtliche Grundlagen
- Grundsätzliche Maßnahmen
- Maßnahmen auf Schulebene
- Maßnahmen auf Klassenebene
- Maßnahmen auf persönlicher Ebene
- Programme und Konzepte gegen Mobbing
- Das Streitschlichterprogramm
- Das Anti-Bullying -Konzept nach Olweus
- Die Mobbing AG
- Der „No Blame Approach“
- Die Buddys
- Die Trainingsraummethode
- Wirkung
- Schülerumfrage zum Thema Mobbing
- Aufbau und Auswahl der Fragen
- Die Schulen
- Verlauf
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Ursachen von Mobbing an weiterführenden Schulen, die ablaufenden Prozesse und mögliche Reaktionen der Schulen darauf. Die Arbeit betrachtet das Thema aus pädagogischer, psychologischer und soziologischer Perspektive und integriert empirische Befunde.
- Definition und Abgrenzung von Gewalt, Aggression und Mobbing
- Analyse der psychologischen und sozialen Grundlagen von Mobbingprozessen
- Untersuchung der Opfer- und Täterprofile
- Beschreibung der Folgen von Mobbing für Individuum und Schulklima
- Evaluierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen an Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort erläutert die Relevanz des Themas Mobbing und die persönliche Motivation der Autorin. Die Einleitung beschreibt den Aufbau der Arbeit. Die Begriffsdefinitionen klären die zentralen Begriffe. Die Kapitel zu Mobbing analysieren das Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln und beleuchten Dynamik, Rollen und Strukturen. Die Kapitel zu Opfer- und Täterprofilen skizzieren die jeweiligen Charakteristika. Die Folgen von Mobbing werden im Hinblick auf physische, psychische und soziale Auswirkungen betrachtet. Die Kapitel zur Prävention und Intervention stellen verschiedene Ansätze und Programme vor, ohne deren Wirksamkeit abschließend zu bewerten.
Schlüsselwörter
Mobbing, Schule, Gewaltprävention, Opfer, Täter, Sozialpsychologie, Pädagogik, Intervention, Prävention, Schülerumfrage, Trainingsraummethode.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Mobbing in der Arbeit definiert?
Mobbing (oder Bullying) beschreibt das systematische Schikanieren einzelner Personen innerhalb einer festen Gemeinschaft über einen längeren Zeitraum.
Wer leistete Pionierarbeit in der Mobbingforschung?
Der schwedische Psychologe Dan Olweus übertrug in den 80er Jahren Mobbing-Untersuchungen von der Erwachsenenwelt auf den Schulalltag.
Was sind typische psychische Folgen für Mobbingopfer?
Die Folgen reichen von zerstörtem Selbstbewusstsein über Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu schweren psychischen Störungen und Suizidgedanken.
Welche Interventionsmethoden werden vorgestellt?
Vorgestellt werden unter anderem der „No Blame Approach“, das Olweus-Konzept, Streitschlichterprogramme und die Trainingsraummethode.
Warum wird der Begriff „Täter“ kritisch betrachtet?
Da Kinder oft nicht voll verantwortlich sind und selbst durch Umfeld oder Erziehung in diese Rolle gedrängt wurden, beinhalten Täterprofile oft auch Aspekte einer Opferrolle.
- Citar trabajo
- Katja Wasilewski (Autor), 2010, Mobbing an weiterführenden Schulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186770