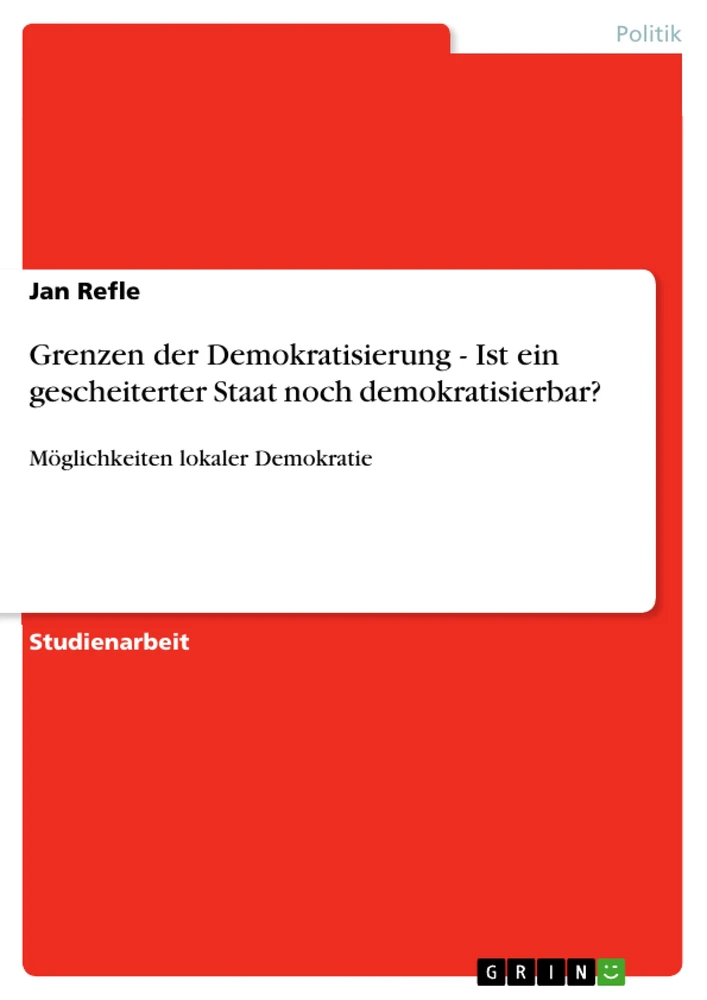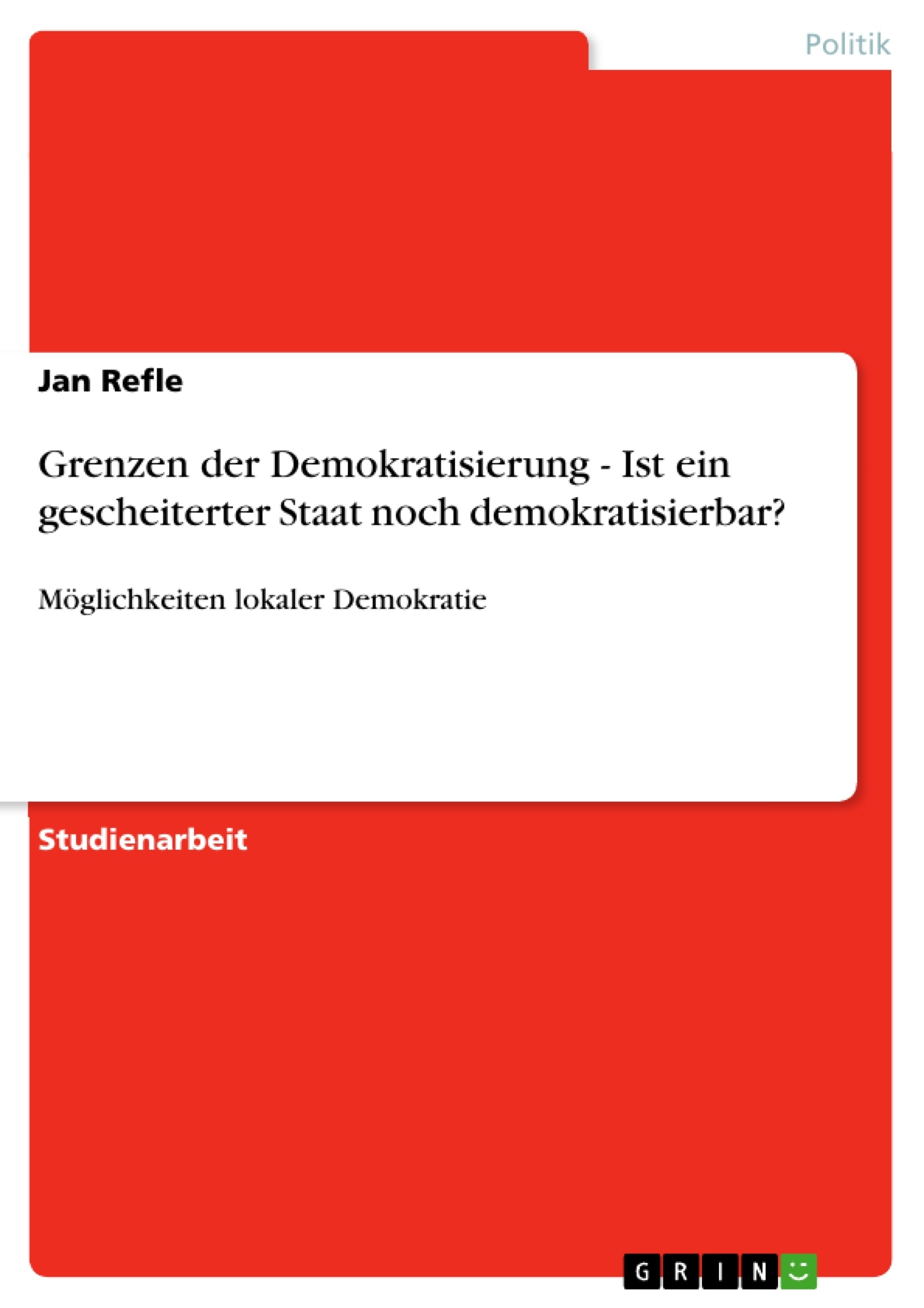Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten lokaler Demokratie in gescheiterten Staaten als Möglichkeit der Demokratisierung.
[...]
Demokratie gilt mittlerweile als universelles Konzept und wird gemeinhin als bestmögliche Regierungsform angesehen, weshalb eine globale Verbreitung als wünschenswert erscheint1. Besonders westliche Mächte wie die USA haben sich in ihrer durch Demokratie geprägter Geschichte um eine Verbreitung der demokratischen Grundsätze eingesetzt, nicht zuletzt durch herausragende Staatslenker wie Woodrow Wilson. Auch heutzutage erheben demokratische Staaten den Anspruch auf eine Expansion des demokratischen Lagers2.
Nun ist Demokratie nicht gleich Demokratie, da jedes Land unterschiedliche Voraussetzungen aufzuweisen hat. Ebenso wenig ist Demokratisierung überall gleich erfolgreich, womit die Frage nach den Grenzen der effektiven Demokratisierung aufgeworfen wird. Diese Grenzen einer Demokratisierung treten heutzutage beispielsweise im Irak deutlich zu Tage. Die vorliegende Arbeit greift diese Punkt auf, indem sie die Grenzen einer Demokratisierung ausleuchtet. Dabei sollen besonders so genannte „failed states“ und fragile Staaten fokussiert werden3. Dies sind Staaten, die sich scheinbar einer Demokratisierung widersetzen.
[...]
1 Insbesondere liberale Demokratie, Vgl. Bauzon, Kenneth E.: Introduction. Democratization in the Third World – Myth or Reality?, in: Ders. (Hrsg.): Development and Democratization in the Third World. Myths, Hopes, and Realities, Washington 1992, S. 3; Geis, Anna; Brock, Lothar und Mueller, Harald: From Democratic Peace to Democratic War?, in: Peace Review: A journal of social justice, Jg. 19, H.2, 2007, S.157.
2 und versuchen dabei auch schwache Staaten zu demokratisieren: Ottaway, Marina: Demokratieexport in prekäre Staaten: ein vorsichtiger Schritt vorwärts, in: Weiss, Stefani und Joscha Schmierer (Hrsg.), Prekäre Staatlichkeit und internationale Ordnung. Wiesbaden 2007, S. 367.
3 Zur Definition wird auf den entsprechenden Unterpunkt verwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Demokratie
- Demokratischer Frieden
- Demokratisierung
- failed states
- Methodik
- Analyse
- Demokratie und gescheiterte Staaten
- lokale Demokratie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Grenzen der Demokratisierung, insbesondere im Kontext von „failed states“ und fragilen Staaten. Sie befasst sich mit der Frage, ob eine Demokratisierung in solchen Staaten möglich ist, insbesondere auf lokaler Ebene. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Demokratie und gescheiterten Staaten, beleuchtet Konzepte der lokalen Demokratie und hinterfragt, ob „lokale Demokratie“ einen Bottom-up-Ansatz für den Demokratieaufbau in gescheiterten Staaten bieten kann.
- Grenzen der Demokratisierung in „failed states“
- Möglichkeiten und Herausforderungen der lokalen Demokratie
- Bedeutung von „governance“ im Kontext gescheiterter Staaten
- Analyse von Faktoren und Zuständen in fragilen Staaten im Hinblick auf die Demokratisierung
- Bewertung von Demokratieexport und dessen Einfluss auf die Demokratisierung in instabilen Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: Sind gescheiterte Staaten auf lokaler Ebene demokratisierbar? Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen, indem es den Begriff der Demokratie, den demokratischen Frieden, Demokratisierung und „failed states“ definiert. Kapitel drei erläutert die Methodik der Arbeit. Kapitel vier analysiert den Zusammenhang zwischen Demokratie und gescheiterten Staaten und untersucht die Möglichkeiten der lokalen Demokratie. Abschließend zieht das Fazit zusammen und diskutiert die Ergebnisse der Analyse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themenbereiche Demokratisierung, „failed states“, lokale Demokratie, Governance, und Demokratieexport. Die Analyse basiert auf empirischen Forschungsarbeiten und theoretischen Konzepten zu den genannten Themen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem „gescheiterten Staat“ (Failed State)?
Es handelt sich um Staaten, in denen die Zentralregierung die Kontrolle über das Territorium verloren hat und grundlegende staatliche Funktionen nicht mehr erfüllen kann.
Ist eine Demokratisierung in failed states überhaupt möglich?
Die Arbeit untersucht, ob lokale Demokratie als „Bottom-up“-Ansatz eine Möglichkeit zur Demokratisierung in solchen fragilen Kontexten bietet.
Welche Rolle spielt der „Demokratieexport“?
Westliche Mächte versuchen oft, demokratische Grundsätze in schwache Staaten zu exportieren, stoßen dabei jedoch häufig auf effektive Grenzen.
Was ist das Konzept der „lokalen Demokratie“?
Es fokussiert auf demokratische Strukturen auf Gemeinde- oder Regionalebene, anstatt nur auf die nationale Regierungsebene zu blicken.
Welche Faktoren erschweren die Demokratisierung im Irak?
Die Arbeit nutzt den Irak als Beispiel, um die Grenzen der effektiven Demokratisierung unter schwierigen nationalen Voraussetzungen aufzuzeigen.
- Quote paper
- Jan Refle (Author), 2008, Grenzen der Demokratisierung - Ist ein gescheiterter Staat noch demokratisierbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186819