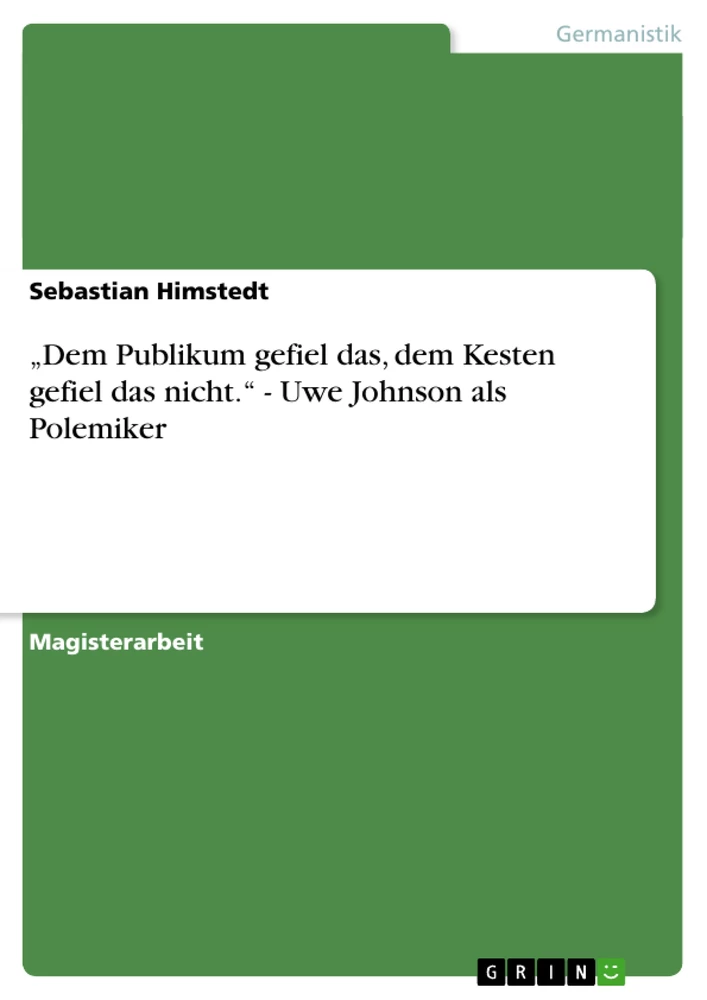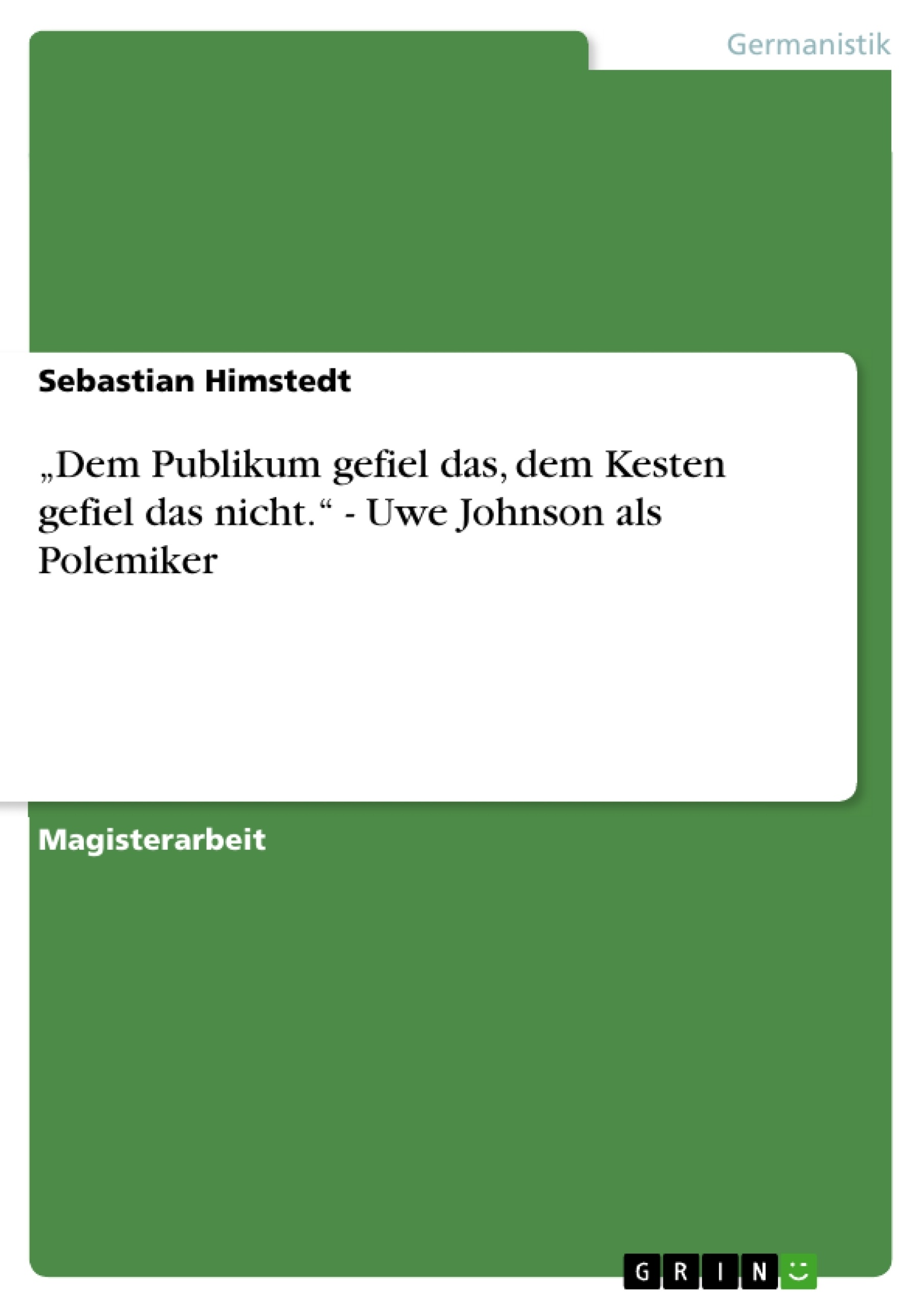Die vorliegende Arbeit möchte eine bisher wenig beachtete Seite des Schriftstellers Uwe
Johnson zeigen: Anhand der Analyse verschiedener öffentlicher Kontroversen wird das
Agieren Uwe Johnsons als Polemiker beschrieben. Dabei ist besonders auf die Verwendung
polemischer Strukturen, rhetorischer Fähigkeiten und sprachlicher Codes eingegangen
worden, jedoch stets unter Verweis auf biographische Umstände, weil sie Teil der
polemischen Angriffe waren. Eingebettet in das Modell von Jürgen Stenzel, steht im
Mittelpunkt der Untersuchung die Polemik Hermann Kesten vs. Uwe Johnson, an welcher
sich am umfassendsten die polemischen Praktiken Uwe Johnsons darstellen lassen. In der
Analyse der Kontroversen um die Berliner S-Bahn, dem Vergleich der Gruppe 47 mit der
Reichsschrifttumskammer und Johnsons Fehde mit Heinrich von Brentano (Außenminister
a.D., CDU) zeigt sich, dass der versierte Polemiker Johnson das Maß der rhetorischen und
polemischen Mittel sehr genau abwägt und seinem Gegenstand anpasst. Darüberhinaus
werden die Frankfurter Vorlesungen Begleitumstände hier erstmals als polemischer Text und
in seinen retrospektiven Passagen als „Polemik zweiter Ordnung“ gelesen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Exkurs Polemik
- 2. „Dem Publikum gefiel das, dem Kesten gefiel das nicht“. Die Rhetorik Johnsons in der Affäre Kesten
- 2.1. Die Situation
- 2.2. Der Angriff
- 2.3. Die Reaktion
- 2.4. Exkurs DDR-Vokabular
- 2.5. Noch nicht das Ende
- 3. „Denn an diesem Tag ging die Hetz erst gründlich los, und wer hatte da ins Horn geblasen? Der erfahrene Literatenjäger Heinrich von Brentano war’s.“ Untersuchung polemischer Begleitumstände
- 3.1. Noch einmal Kesten
- 3.2. Gruppe 47 als Reichsschriftumskammer: Ein fiktiver Brief Johnsons
- 3.3. Die Berliner Stadtbahn
- 3.4. Exkurs DDR-Vokabular in Johnsons Stadtbahnschriften
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die bisher wenig beachtete Seite Uwe Johnsons als Polemiker. Anhand öffentlicher Kontroversen wird sein Agieren analysiert, wobei rhetorische Mittel, sprachliche Codes und biographische Umstände berücksichtigt werden. Die Polemik zwischen Johnson und Hermann Kesten steht im Mittelpunkt.
- Analyse der rhetorischen Strategien Uwe Johnsons in verschiedenen öffentlichen Auseinandersetzungen.
- Untersuchung der sprachlichen Codes und ihrer Anpassung an die jeweilige Diskurssituation.
- Einordnung der „Frankfurter Vorlesungen“ als polemischen Text und „Polemik zweiter Ordnung“.
- Kontextualisierung der Kontroversen um die Berliner S-Bahn und den Vergleich der Gruppe 47 mit der Reichsschrifttumskammer.
- Verknüpfung von Johnsons Persönlichkeit und seinem polemischen Schreiben.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung in das Thema und Definition des Begriffs „Polemik“. Vorstellung des Projekts und der Methodik.
Kapitel 2: Detaillierte Analyse der Kontroverse zwischen Uwe Johnson und Hermann Kesten, unter Einbezug der jeweiligen rhetorischen Strategien und des historischen Kontextes.
Kapitel 3: Untersuchung weiterer polemischer Auseinandersetzungen Johnsons, darunter seine Auseinandersetzung mit Heinrich von Brentano und seine kritischen Äußerungen zur Gruppe 47. Analyse der S-Bahn-Schriften.
Schlüsselwörter
Uwe Johnson, Polemik, Rhetorik, Sprachliche Codes, Kontroversen, Hermann Kesten, Gruppe 47, Berliner S-Bahn, DDR-Vokabular, „Polemik zweiter Ordnung“, Argumentationsmuster.
- Citation du texte
- Sebastian Himstedt (Auteur), 2008, „Dem Publikum gefiel das, dem Kesten gefiel das nicht.“ - Uwe Johnson als Polemiker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186835