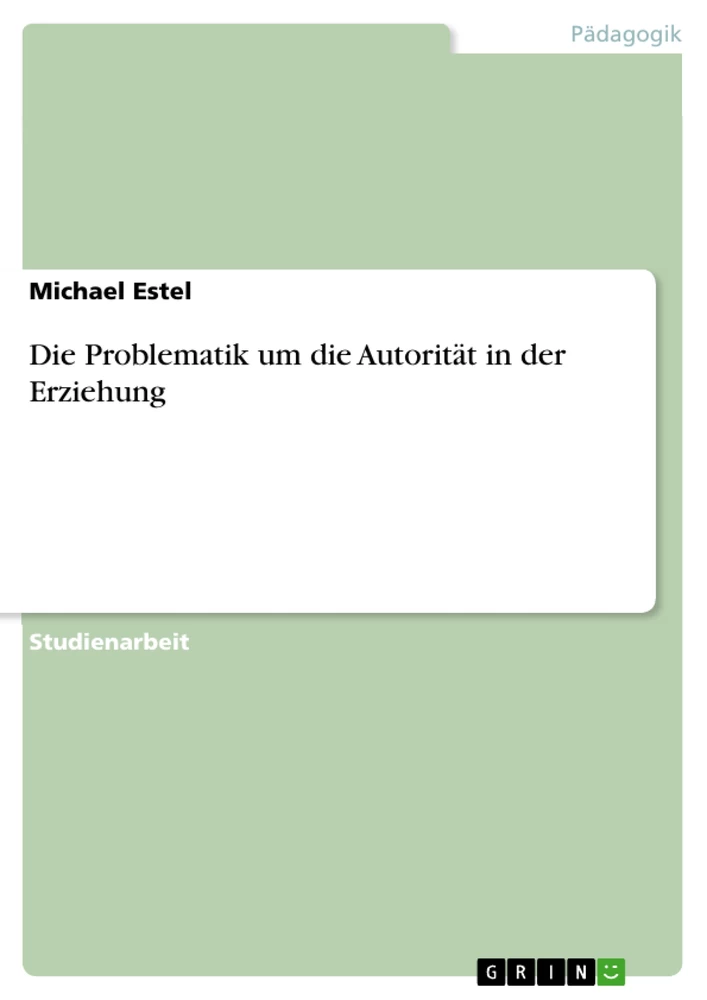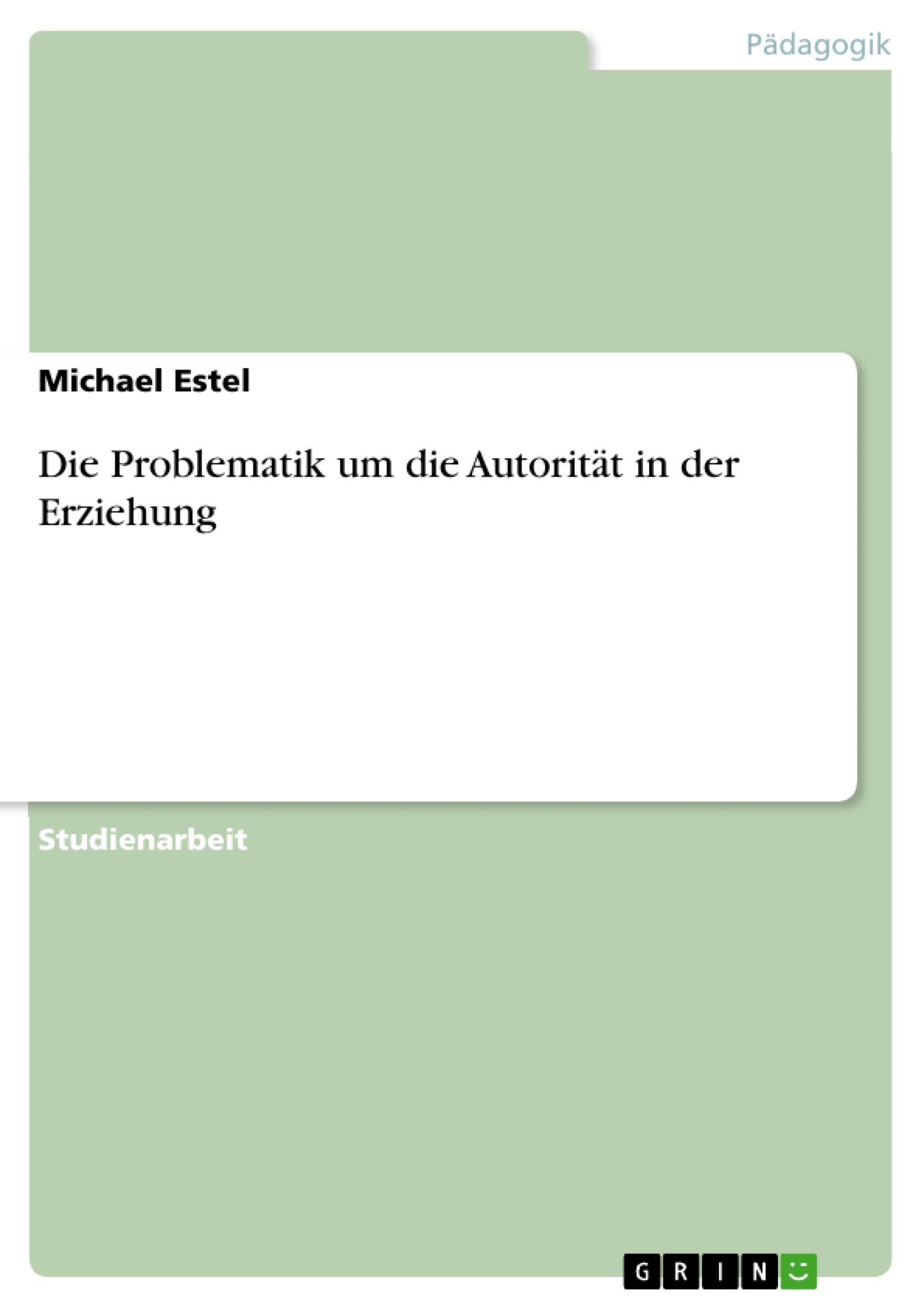Inahlt:
Einleitung
Der Mythos
Der Nachweis des Mythos
Geschichtliche Gründe für die Entstehung des Mythos
Das Problem der Begrifflichkeiten
Autorität - Bedeutung und Wirkung
Autoritäre Erziehung
Antiautoritäre Erziehung
Autoritativer Erziehungsstil
Autorität in der Praxis
Die Suche nach Autorität
Autorität durch Verständnis, Freiheit und Strafe
Empirische Beweise
Fazit
Literaturverzeichnis und Internetquellen
Einleitung:
Ziel der Wissenschaft sollte es sein, den Menschen durch Wissensvermittlung aufzuklären und mündig zu machen. Denn ein mündiger Bürger ist in der Lage sich selbst zu reflektieren und scheut nicht die Auseinandersetzung mit belastenden Themen. Im Erziehungsalltag führt mangelndes Wissen und Vorurteile zu Erziehungsmythen. Einige dieser Mythen wurden im Seminar "Erziehungswissenschaftliche Analysen von Alltagsmythen der Erziehungswirklichkeit" diskutiert.
In dieser Hausarbeit fasse ich den diskutierten Mythos "Die 68er haben Disziplin und Autorität zerstört. Erziehung muss zurück zur Disziplin" auf und beziehe mich explizit auf die Autorität. Fragt man im Bekanntenkreis, recherchiert in Büchern oder im Internet, liest man schnell, dass sich die Eltern und Pädagogen von der Autorität in der Erziehung distanzieren oder sehr kontrovers diskutieren. Vielleicht weil der Missbrauch von Autorität in der Vergangenheit entweder zu Unterdrückung oder zu Anarchie geführt hat. Ein anderer Grund könnte aber auch sein, dass niemand genau weiß, was "Autorität" oder "autoritär" bedeutet.
Somit soll diese Hausarbeit klären, inwiefern und warum, eine Problematik um die Autorität in der Erziehung existiert. Ebenso werden Begriffe zum Thema Autorität wie "autoritär", "autoritativ" und "antiautoritär" aufgefasst und erklärt. Das Ergebnis wird Klarheit zur Thematik und Vorschläge zum richtigen Umgang mit Autorität sein. Zusätzlich sollen im Zusammenhang stehende Irrtümer wie "Nur strenge Eltern besitzen Autorität" (Bischoff, 2005, S.28) und der Irrtum, dass es in der antiautoritären Erziehung keine Regeln gibt, (vgl. Bischoff, 2005, S.23) aufgeklärt werden.
Um die öffentliche Meinung zum Mythos zu analysieren, bietet es sich an, die entsprechenden Meinungen und Diskussionen in Internet-Artikeln nachzulesen. Aber um die möglichst Thematik objektiv einzuschätzen, ist es anzustreben, möglichst unabhängige Quellen wie empirische Untersuchungen von Gerda Volmer, Bernadette Frei oder Experimente von Milgrams zu verwenden. Wie angedeutet, kann man die Unwissenhei..
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mythos
- Der Nachweis des Mythos
- Geschichtliche Gründe für die Entstehung des Mythos
- Das Problem der Begrifflichkeiten
- Autorität - Bedeutung und Wirkung
- Autoritäre Erziehung
- Antiautoritäre Erziehung
- Autoritativer Erziehungsstil
- Autorität in der Praxis
- Die Suche nach Autorität
- Autorität durch Verständnis, Freiheit und Strafe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Mythos, dass die 68er-Bewegung Disziplin und Autorität zerstört hat und plädiert für eine Rückkehr zur Disziplin in der Erziehung. Das Hauptziel ist es, die Problematik um Autorität in der Erziehung zu klären, verschiedene Begriffsverständnisse zu erläutern und einen konstruktiven Umgang mit Autorität zu empfehlen. Zusätzlich sollen verbreitete Irrtümer über Autorität in der Erziehung aufgeklärt werden.
- Der Mythos der Zerstörung von Autorität durch die 68er-Bewegung
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Autorität, autoritärer, antiautoritärer und autoritativer Erziehung
- Historische Entwicklung des Verständnisses von Autorität in der Erziehung
- Praktische Anwendung und Herausforderungen im Umgang mit Autorität
- Auflösung von Irrtümern bezüglich strenger Erziehung und antiautoritärer Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Motivation der Arbeit, ausgehend von der These, dass mangelndes Wissen über Autorität zu Erziehungsmythen führt. Kapitel 2 beleuchtet den Mythos der Zerstörung von Autorität durch die 68er und analysiert historische Gründe für dessen Entstehung. Es werden verschiedene Meinungen und Positionen zu Autorität in der Erziehung dargestellt, gezeigt an Zitaten aus der Literatur.
Kapitel 3 untersucht das Problem der Begrifflichkeiten. Die Bedeutung und Wirkung von Autorität wird beleuchtet, ebenso die unterschiedlichen Erziehungsformen (autoritär, antiautoritär, autoritativ). Kapitel 4 behandelt die Autorität in der Praxis, die Suche nach Autorität sowie den Umgang mit ihr durch Verständnis, Freiheit und Strafe.
Schlüsselwörter
Autorität, Erziehung, Mythos, 68er-Bewegung, Disziplin, autoritär, antiautoritär, autoritativ, Erziehungsmythen, empirische Forschung, gesellschaftlicher Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Haben die 68er die Disziplin und Autorität in der Erziehung zerstört?
Dies ist ein weit verbreiteter Erziehungsmythos. Die Arbeit untersucht kritisch, inwiefern dieser Vorwurf historisch und empirisch haltbar ist.
Was ist der Unterschied zwischen autoritärer und autoritativer Erziehung?
Autoritäre Erziehung setzt auf strikten Gehorsam und Unterdrückung, während der autoritative Erziehungsstil auf klaren Regeln basiert, die mit Wärme, Verständnis und Mündigkeit kombiniert werden.
Gibt es in der antiautoritären Erziehung wirklich keine Regeln?
Nein, das ist ein häufiger Irrtum. Auch die antiautoritäre Erziehung kennt Strukturen, distanziert sich jedoch von willkürlicher Machtausübung.
Besitzen nur strenge Eltern Autorität?
Nein. Wahre Autorität in der Erziehung erwächst oft aus Verständnis, Vorbildfunktion und einer gesunden Balance zwischen Freiheit und notwendigen Grenzen.
Warum distanzieren sich heute viele Eltern vom Begriff „Autorität“?
Oft liegt dies an einer Unklarheit über die Begrifflichkeit oder an der historischen Erfahrung von Autoritätsmissbrauch, der entweder zu Unterdrückung oder Anarchie führte.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Michael Estel (Autor:in), 2010, Die Problematik um die Autorität in der Erziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186876