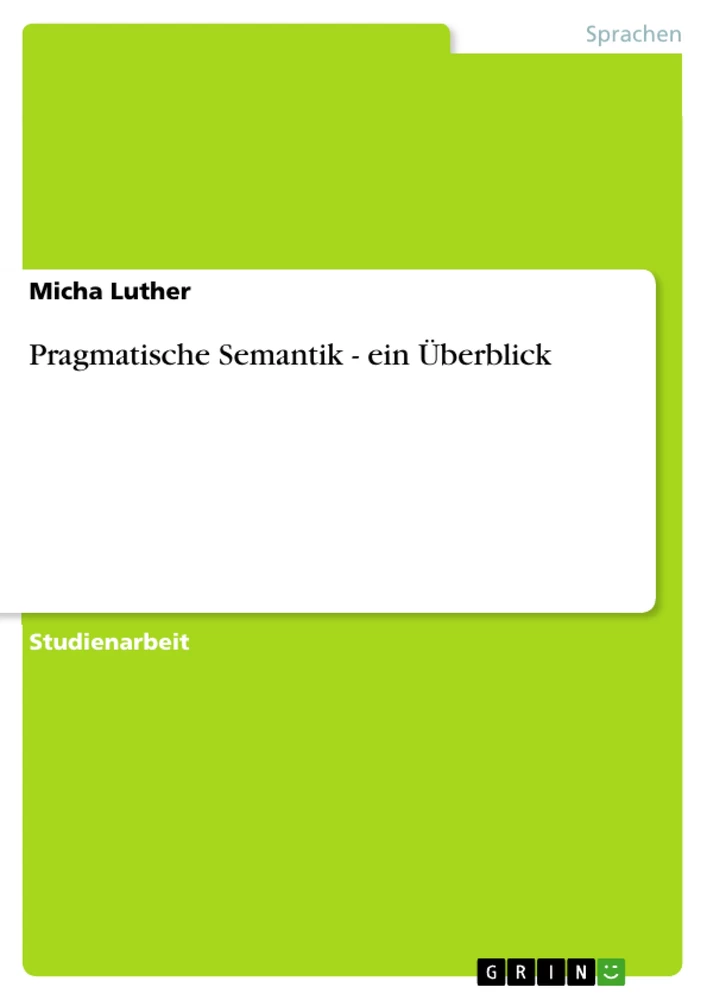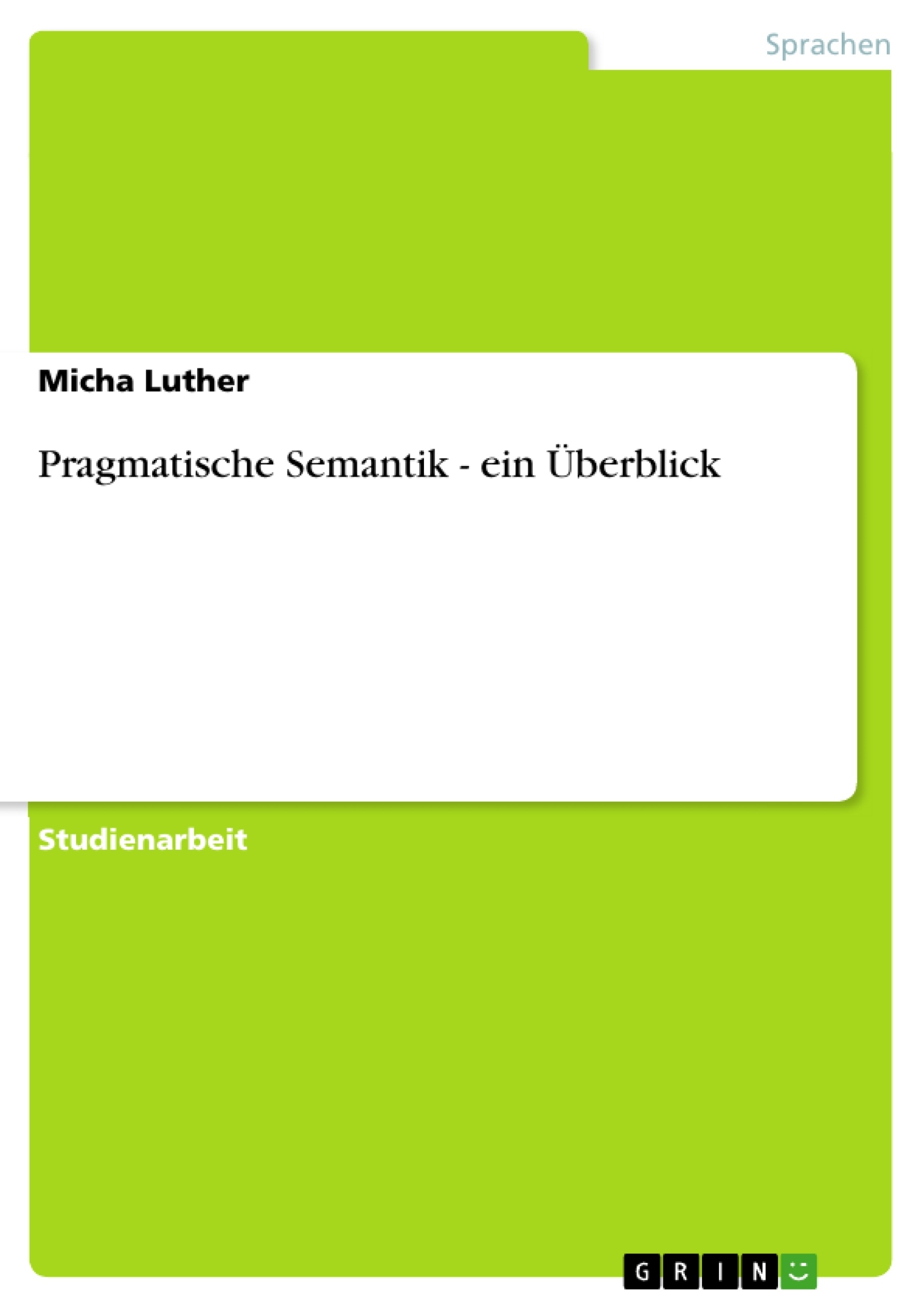Die Abeit beschäftigt sich mit der Überschneidung der linguistischen Teilbereiche Pragmatik und Semantik und gibt eine Übersicht der für beide Bereiche relevanten Sprachphänomene.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung und Sprachgebrauch
- Bedeutung und Intentionalität
- Implikaturen und Konversationsmaximen
- Präsuppositionen
- Sprechakttheorie
- Deixis
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die pragmatische Semantik als Forschungsfeld näher zu erläutern. Sie beleuchtet die Entwicklung des Begriffs und untersucht bedeutungsrelevante Teilbereiche und Forschungsansätze, die sowohl der Semantik als auch der Pragmatik zugeordnet werden können.
- Entwicklung des Begriffs der Pragmatik
- Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung
- Bedeutung und Kontextualität
- Sprachspiel als grundlegender Bestandteil von Sprache
- Unterschiede in der Anwendung von Sprachspielen in verschiedenen sozialen Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Entstehung der Pragmatik und die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zu Syntax und Semantik. Sie begründet die Fokussierung auf bedeutungsrelevante Bereiche, die sowohl der Semantik als auch der Pragmatik zugeordnet werden können.
Bedeutung und Sprachgebrauch: Dieses Kapitel behandelt Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung und deren Einfluss auf die linguistische Pragmatik. Es wird argumentiert, dass die Bedeutung eines Wortes von seinem Gebrauch in der Sprache abhängt und nicht von einer einheitlichen, kontextunabhängigen Bedeutung. Der Kontext und die Verwendungsmöglichkeiten eines Wortes spielen eine wesentliche Rolle bei der Verständigung. Der Begriff „Sprachspiel“ wird eingeführt.
Schlüsselwörter
Pragmatische Semantik, Gebrauchstheorie der Bedeutung, Wittgenstein, Kontext, Sprachspiel, Bedeutung, Kommunikation, Sprachgebrauch, Konversationsmaximen, Präsuppositionen, Sprechakttheorie, Deixis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist pragmatische Semantik?
Es ist ein Forschungsfeld an der Schnittstelle von Semantik (Bedeutung) und Pragmatik (Sprachgebrauch), das untersucht, wie Bedeutung durch den Kontext entsteht.
Was besagt Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung?
Nach Wittgenstein liegt die Bedeutung eines Wortes in seinem Gebrauch innerhalb der Sprache und nicht in einer festen, kontextunabhängigen Definition.
Was ist ein „Sprachspiel“?
Ein Sprachspiel ist eine Tätigkeit, bei der Sprache und Handeln fest miteinander verwoben sind, wobei Regeln je nach sozialem Kontext variieren.
Welche Rolle spielen Präsuppositionen?
Präsuppositionen sind Voraussetzungen, die als gegeben hingenommen werden müssen, damit eine Aussage in einem Gespräch sinnvoll oder wahrheitsgemäß ist.
Was untersucht die Sprechakttheorie?
Sie untersucht, wie wir durch das Sprechen Handlungen vollziehen (z.B. Versprechen, Warnen, Bitten) und welche Bedingungen für das Gelingen dieser Akte nötig sind.
- Citar trabajo
- Micha Luther (Autor), 2011, Pragmatische Semantik - ein Überblick, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186996