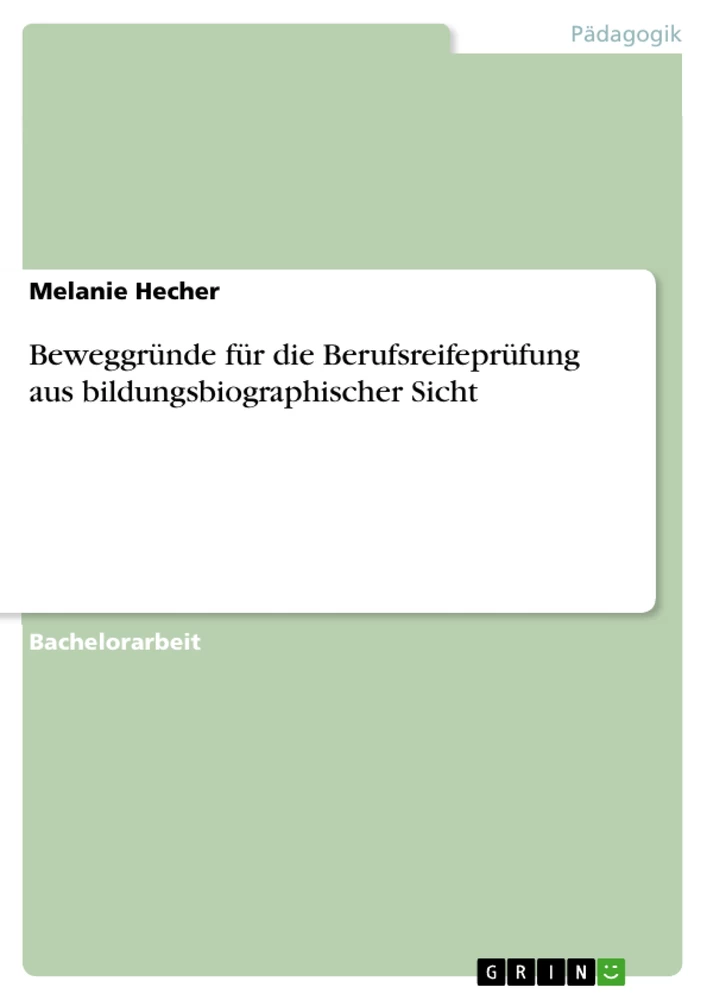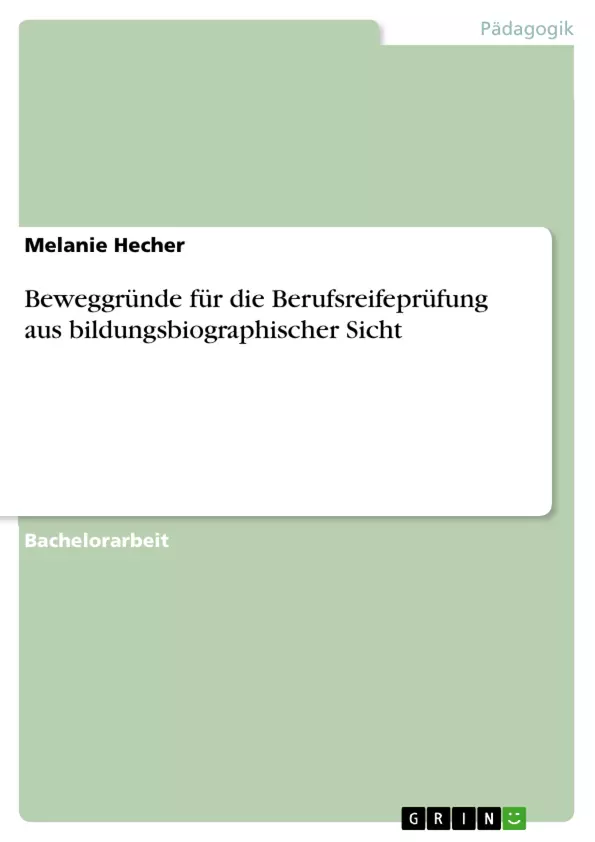Diese Forschungsarbeit setzt sich mit der Berufsreifeprüfung, einer speziellen Form der Erwachsenenbildung zum Erreichen eines Hochschulzugangs, auseinander. Durch die Betrachtung aus sozialisationstheoretischer Perspektive werden Beweggründe für die Absolvierung der Berufsreifeprüfung herausgearbeitet. Das Erkenntnisinteresse besteht darin, herauszufinden, inwiefern sich familiäre, schichtspezifische, schulische und berufliche Sozialisation auf den Entschluss, die Berufsreifeprüfung zu absolvieren, auswirken. Anhand von zwei Fallanalysen wird den Beweggründen für diese Bildungsentscheidung nachgegangen und der Versuch gemacht, Aussagen über Entscheidungsmuster all jener Personen zu machen, die die Berufsreifeprüfung absolvieren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Fragestellung und Relevanz des Untersuchungsansatzes
- Forschungsstand
- Theoretischer Teil
- Bildungsbiographie und Sozialisation
- Sozialisation in der Familie & schichtspezifische Sozialisation
- Geschlechtsspezifische Sozialisation
- Schulische Sozialisation
- Berufliche Sozialisation
- Erwachsenenbildung
- Die Berufsreifeprüfung – eine Form der Erwachsenenbildung
- Voraussetzungen, Zulassungen und Anrechnungen für die Berufsreifeprüfung
- Prüfungsfächer und Prüfungsablauf
- Erfolgreich mit der Berufsreifeprüfung – Zahlen, Daten und Fakten aus dem Bundesland Salzburg
- Bildungsbiographie und Sozialisation
- Untersuchungsmethode
- Die dokumentarische Methode - theoretische Eckpunkte
- Die dokumentarische Methode und ihre Anwendung in der vorliegenden Untersuchung
- Anmerkungen zur Auswahl der Interviewpartner/innen und zur Interviewsituation
- Fallanalyse: Frau Auer
- Portrait
- Relevante Aspekte aus dem biographischen Hintergrund Frau Auers
- Gegenwärtige Lebenssituation
- Familiäre Situation in Kindheit und Jugend
- Schulische Laufbahn
- Zukunftsausblick
- Resümee
- Fallanalyse: Herr Wagner
- Portrait
- Relevante Aspekte aus dem biographischen Hintergrund Herrn Wagners
- Gegenwärtige Lebenssituation
- Familiäre Situation in Kindheit und Jugend
- Schulische Laufbahn
- Zukunftsausblick
- Resümee
- Entscheidungsmuster für die Berufsreifeprüfung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beweggründe für die Absolvierung der Berufsreifeprüfung aus sozialisationstheoretischer Perspektive. Das Hauptziel besteht darin, den Einfluss familiärer, schichtspezifischer, schulischer und beruflicher Sozialisation auf die Entscheidung für die Berufsreifeprüfung zu erforschen. Die Analyse zweier Fallstudien soll Aufschluss über Entscheidungsmuster geben.
- Einfluss der familiären Sozialisation auf die Entscheidung für die Berufsreifeprüfung
- Der Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und dem Wunsch nach einer Berufsreifeprüfung
- Die Rolle der schulischen Sozialisation bei der Berufswahl und der Entscheidung für Weiterbildung
- Der Einfluss beruflicher Erfahrungen auf die Entscheidung für die Berufsreifeprüfung
- Herausarbeitung von Entscheidungsmustern bei Personen, die die Berufsreifeprüfung absolvieren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz des Untersuchungsansatzes vor. Der theoretische Teil behandelt Bildungsbiographie, Sozialisation und die Berufsreifeprüfung als Form der Erwachsenenbildung. Die Untersuchungsmethode beschreibt die Anwendung der dokumentarischen Methode. Die Fallanalysen von Frau Auer und Herrn Wagner präsentieren detaillierte biographische Informationen und beleuchten ihre jeweiligen Beweggründe für die Absolvierung der Berufsreifeprüfung. Die Kapitel fokussieren auf die individuellen Lebensläufe und deren Einfluss auf die Bildungsentscheidung.
Schlüsselwörter
Berufsreifeprüfung, Erwachsenenbildung, zweiter Bildungsweg, Sozialisation, Bildungsbiographie, Fallstudie, Entscheidungsmuster.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Berufsreifeprüfung?
Die Berufsreifeprüfung ist eine Form der Erwachsenenbildung auf dem zweiten Bildungsweg, die Personen mit Berufsausbildung den uneingeschränkten Hochschulzugang ermöglicht.
Welchen Einfluss hat die familiäre Sozialisation auf die Bildungsentscheidung?
Die Arbeit untersucht, wie familiäre Hintergründe und die schichtspezifische Erziehung den Entschluss prägen, im Erwachsenenalter eine höhere Qualifikation anzustreben.
Was sind typische Entscheidungsmuster für die Berufsreifeprüfung?
Anhand von Fallstudien werden Muster herausgearbeitet, die zeigen, wie berufliche Erfahrungen und schulische Vorbiographien zur Entscheidung für die Matura führen.
Welche Rolle spielt die soziale Schicht bei der Weiterbildung?
Es wird analysiert, inwiefern die soziale Herkunft Barrieren schafft oder als Motivator für den sozialen Aufstieg durch Bildung fungiert.
Wie wirkt sich die berufliche Sozialisation aus?
Berufliche Erfahrungen können den Wunsch nach beruflicher Veränderung oder höherer Anerkennung verstärken, was oft den Anstoß für die Berufsreifeprüfung gibt.
- Arbeit zitieren
- Melanie Hecher (Autor:in), 2011, Beweggründe für die Berufsreifeprüfung aus bildungsbiographischer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187032