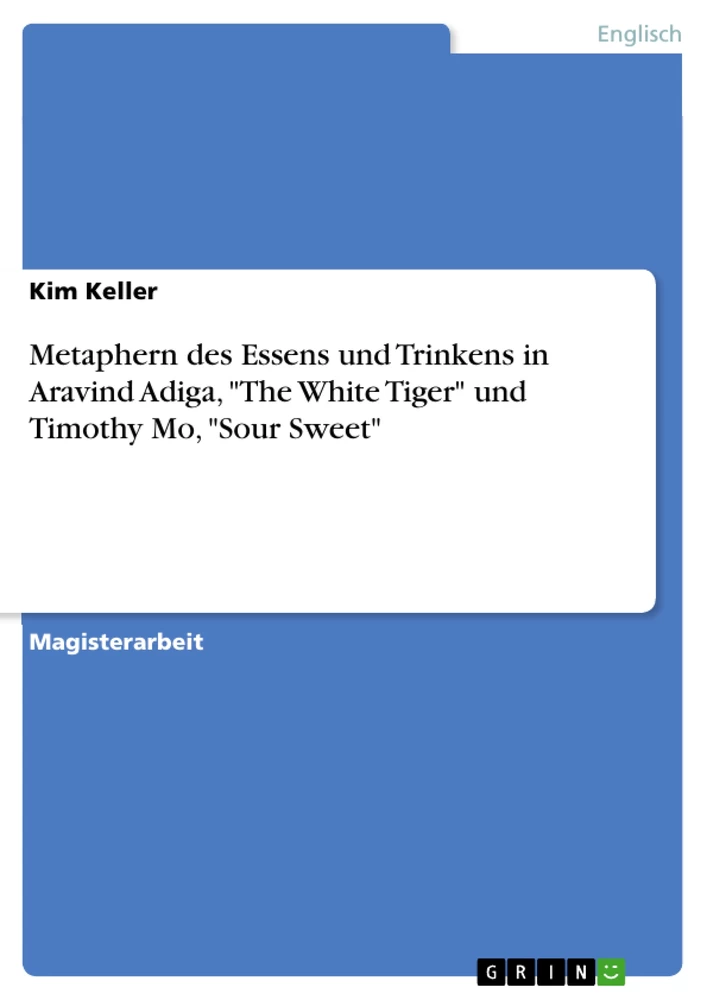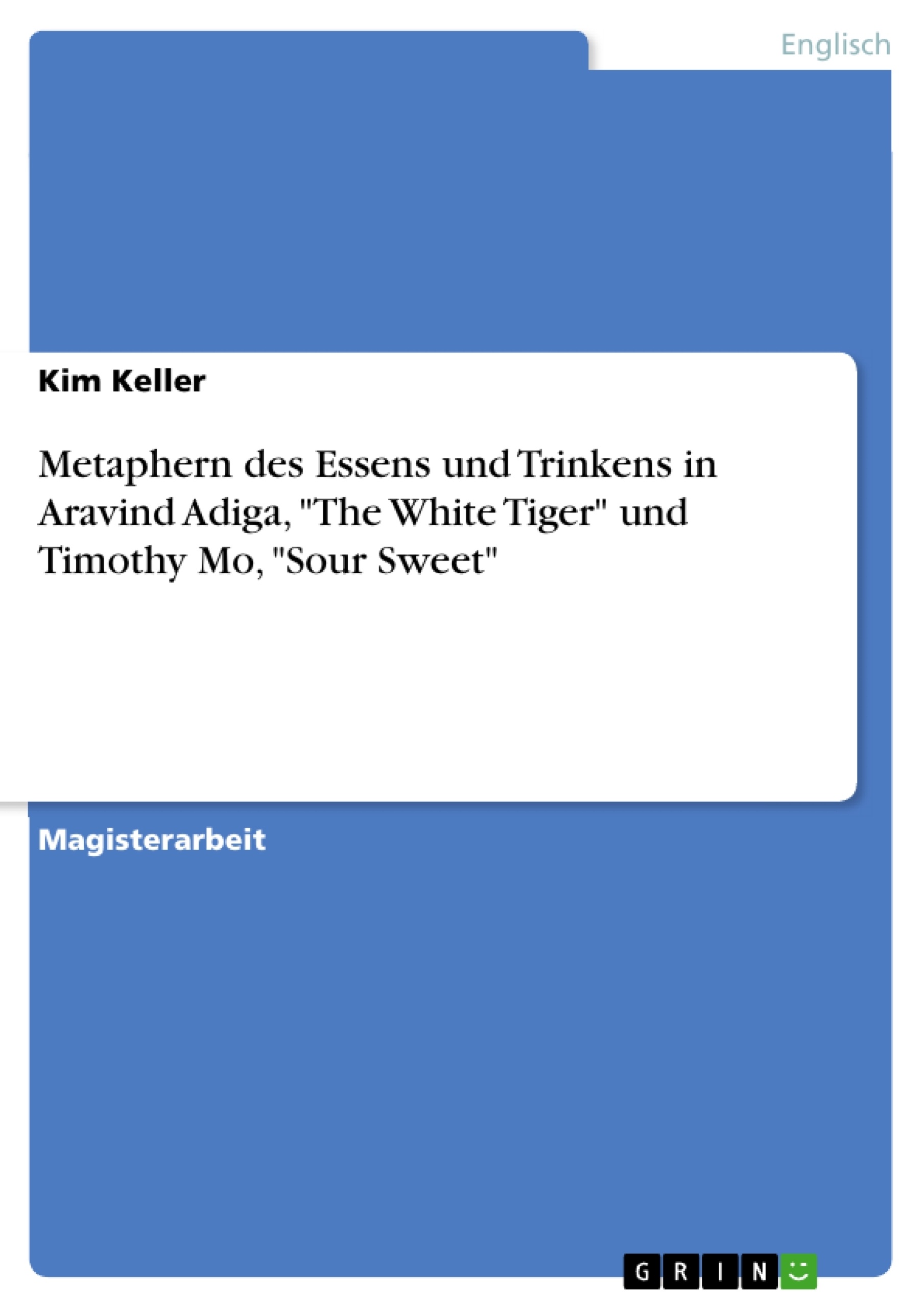Verkürzte Einleitung
Essen und Trinken konstituieren identitätsstiftende Prozesse. Dabei dienen sie sowohl dazu, die Identität einzelner Personen zu definieren, als auch diejenige, bestimmter Personengruppen. Solche Personengruppen können beispielsweise Religionsgemeinschaften sein, Nationalitäten oder einfach Familien. Durch ihre Kraft, In – und Exklusion von Personen abzubilden, stellen Essen und Trinken einen wichtigen Faktor bei der Bildung von Gemeinschaften dar.
Literatur ist ein akkurates Mittel, unterschiedliche Esskulturen abzubilden und näher zu bringen. Insbesondere die postkoloniale Literatur bietet, mit ihrer Darstellung unterschiedlichster Kulturkreise und deren Interaktion miteinander, einen Quell vielfältiger Interpretationsansätze. So gab die Literatur postkolonialer Autoren diesen schon immer die Möglichkeit, mithilfe des Themas des Essens und Trinkens Orte der Abgrenzung zu schaffen, Missstände anzuprangern und generell Kritik zu üben. Traditionelle Speisen einzelner Nationen in einem fremden Kontext eröffnen vielerlei Gelegenheiten, Interaktion zwischen verschiedenen Kulturen zu artikulieren und zu repräsentieren.
Die beiden in dieser Arbeit behandelten Romane Sour Sweet und The White Tiger erscheinen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich. Der eine spielt im London der 1960er, der andere im heutigen Indien. Beides sind postkoloniale Texte, wobei Sour Sweet die Diaspora im Blickfeld hat, derweil The White Tiger die Geschichte eines Inders erzählt, der in Indien lebt. Eine vergleichende Analyse beider Texte scheint demnach zunächst wenig naheliegend. Doch in einem Punkt ähneln sich die Romane: beide legen starke Betonung auf Essen und Trinken und deren Einfluss auf die Identitätsbildung und - erhaltung ihrer Protagonisten.
Ziel dieser Arbeit ist es, der Frage nachzugehen, inwieweit Metaphern des Essens und Trinkens innerhalb der Romane Sour Sweet von Timothy Mo und The White Tiger von Aravind Adiga eingebunden wurden, diese zu identifizieren und sie bezüglich ihrer Bedeutung bei der Frage nach einer Identitätsbildung der Protagonisten zu analysieren, um anschließend einen Vergleich ziehen zu können und eine Aussage über die Verwendung von Metaphern des Essens und Trinkens in postkolonialer Literatur machen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Bedeutung des Essens und Trinkens im Hinblick auf Identitätsbildung
- 3 Chinesisches Essen
- a Ursprünge, Entwicklung, Charakteristika
- b Chinesisches Essen in der Diaspora – Die Bedeutung chinesischer Restaurants
- c Chinesische Takeaways in Großbritannien
- 4 Indisches Essen
- a Ursprünge und Entwicklung
- b Indisches Kastensystem und Essen
- c Religion und Essen
- 5 Essen und Trinken in Timothy Mos Sour Sweet
- 6 Essen und Trinken in Aravind Adigas The White Tiger
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Metaphern des Essens und Trinkens in den Romanen "Sour Sweet" von Timothy Mo und "The White Tiger" von Aravind Adiga. Das Hauptziel ist die Identifizierung dieser Metaphern und die Analyse ihrer Bedeutung für die Identitätsbildung der Protagonisten. Ein Vergleich beider Romane soll Aufschluss über die Verwendung solcher Metaphern in der postkolonialen Literatur geben.
- Die Bedeutung von Essen und Trinken für die Identitätsbildung
- Der Einfluss von Kultur und Tradition auf Essgewohnheiten
- Metaphorische Verwendung von Essen und Trinken in der Literatur
- Interkultureller Austausch und seine Darstellung in Bezug auf Essen
- Soziale Hierarchien und ihre Reflexion in Esspraktiken
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt das wachsende Interesse an der Erforschung von Essen und Trinken in den Kulturwissenschaften und führt in die zentrale Rolle der Identitätsbildung ein, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht wird. Die beiden Romane "Sour Sweet" und "The White Tiger" werden als Fallstudien vorgestellt.
Kapitel 2 (Die Bedeutung des Essens und Trinkens im Hinblick auf Identitätsbildung): Dieses Kapitel analysiert die identitätsstiftende Kraft von Essen und Trinken auf individueller und kollektiver Ebene, mit Blick auf regionale, religiöse und kulturelle Einflüsse. Der Einfluss der Globalisierung auf die Wahrnehmung kultureller Grenzen im Kontext von Essen wird thematisiert.
Kapitel 3 (Chinesisches Essen): Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Geschichte und die Charakteristika der chinesischen Küche, inklusive der Bedeutung chinesischer Restaurants und Takeaways in der Diaspora. Es beleuchtet den Einfluss von Tradition, Regionalität und der Balance von Yin und Yang auf die chinesische Esskultur.
Kapitel 4 (Indisches Essen): Dieses Kapitel behandelt die Ursprünge und Entwicklung der indischen Küche, sowie den starken Einfluss des Kastensystems und religiöser Praktiken auf Essgewohnheiten und soziale Hierarchien in Indien.
Kapitel 5 (Essen und Trinken in Timothy Mos Sour Sweet): Eine Zusammenfassung der Darstellung von Essen und Trinken im Roman "Sour Sweet", mit Fokus auf die Familie Chen und deren Herausforderungen in der britischen Diaspora. Die Kapitel bis zum Verschwinden von Chen werden zusammengefasst.
Kapitel 6 (Essen und Trinken in Aravind Adigas The White Tiger): Zusammenfassung der Darstellung von Essen und Trinken in "The White Tiger", mit Fokus auf die sozialen Hierarchien und den Aufstieg Balrams. Die Analyse beinhaltet die Metaphorik und den sozialen Kommentar, der durch die Beschreibungen von Essen und Trinken vermittelt wird.
Schlüsselwörter
Identitätsbildung, Essen, Trinken, Metapher, Postkoloniale Literatur, Kultur, Tradition, Diaspora, Globalisierung, Kastensystem, China, Indien, "Sour Sweet", "The White Tiger", Yin und Yang, Küche, Restaurants, Takeaways.
- Quote paper
- Kim Keller (Author), 2011, Metaphern des Essens und Trinkens in Aravind Adiga, "The White Tiger" und Timothy Mo, "Sour Sweet", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187034