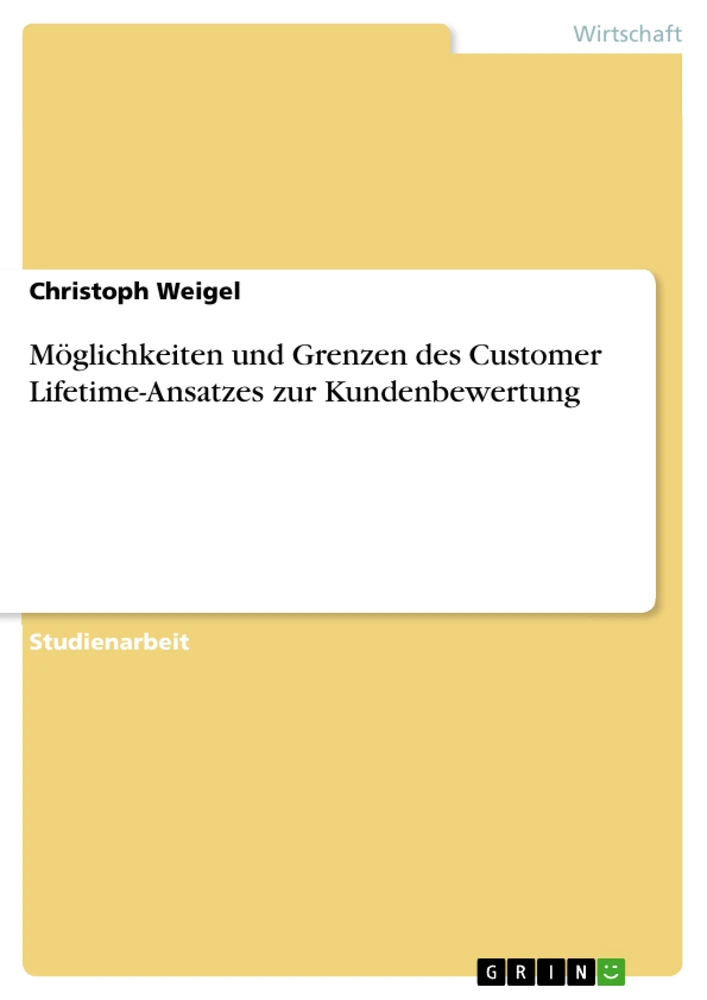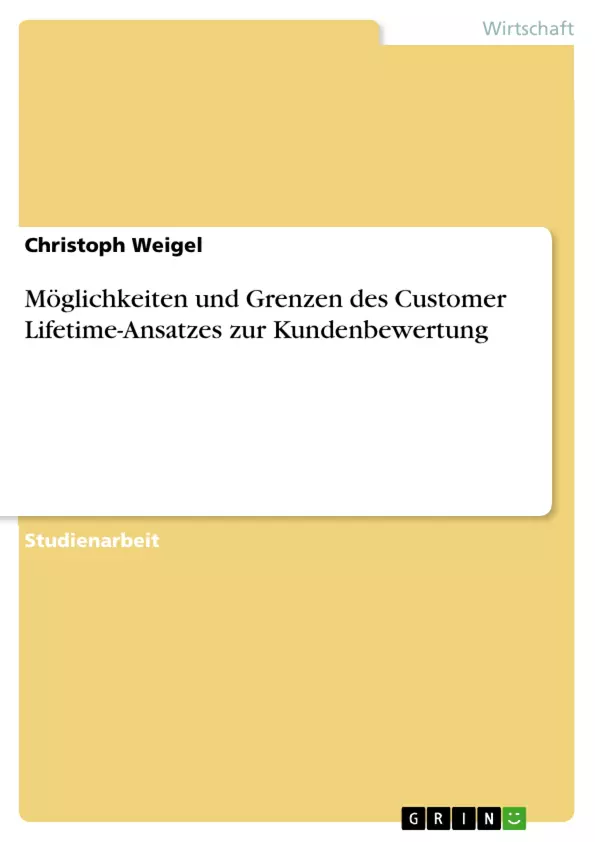In den letzen 10 Jahre hat einen Wandel in dem Grundgedanken der Unternehmensführung
stattgefunden. War es vorher das Produkt, welches im Fokus der Unternehmensausrichtung
stand, wird nun vielmehr der Kunde als wertsteigender Faktor für ein Unternehmens
wahrgenommen. Die logische Folgerung hieraus ist ein Verdrängen des Produktmanagements
durch das Kundenmanagement zur Findung einer effektiven Unternehmensstrategie. Somit
wurden auch neue Ansätze entworfen, die das Kundenmanagement fördern. Ansätze, die eine
Bewertung der Kunden ermöglichen, um daraus Entscheidungen über Kunden und die
Kundenstruktur ableiten zu können. Einer der Ansätze ist das Kundenwertmanagement,
welches die Frage nach dem Kundenwert beantworten will. Um diesen Kundenwert zu
bestimmen, wurden verschiedene Instrumente entwickelt. Ein Instrument, das eine monetäre
Zukunftsbetrachtung eines Kunden durchführt, ist der Customer Lifetime-Ansatz. Durch diese
Zukunftsbetrachtung beinhaltet der Customer Lifetime-Ansatz neue Möglichkeiten, aber auch
Grenzen, um den Kundenwert abzubilden und um daraus eine objektive
Entscheidungsgrundlage zu finden.
Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, aufgrund der vorhandenen Literatur, eine kritische
Auseinandersetzung mit dem Customer Lifetime-Ansatzes vorzunehmen. Hierfür soll geklärt
werden, welche Rolle der Customer Lifetime-Ansatz im Rahmen der Kundenwertanalyse spielt
und wie umfassend dieser den Kundenwert darstellen kann.
Weiterhin sollen auf der einen Seite die Möglichkeiten herausgearbeitet werden, die einem
Unternehmen durch die Verwendung des Customer Lifetime-Ansatzes entstehen, um den
Kundenwerd darzustellen. Da der Customer Lifetime-Ansatz eine Zukunftsbetrachtung
durchführt, sollen sich die Möglichkeiten an den strategischen Entscheidungen der
Unternehmensführung orientieren.
Neben den Möglichkeiten, die der Customer Lifetime-Ansatz bietet, stehen auf der anderen
Seite diesem auch Grenzen gegenüber. Diese Arbeit soll aufzeigen, dass die Anwendung des
Customer Lifetime-Ansatzes an Grenzen gebunden ist, die vor allem bei der Errechnung von
kundenspezifischen Kennzahlen Unsicherheiten hervorrufen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung und Abgrenzung
- 2. Grundlagen des Customer Lifetime-Ansatzes
- 2.1. Der Kundenlebenszykluskonzept
- 2.2. Der Kundenwert
- 2.3. Der Customer Lifetime-Ansatz
- 3. Möglichkeiten des Customer Lifetime-Ansatzes
- 4. Grenzen des Customer Lifetime-Ansatzes
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Customer Lifetime-Ansatz im Rahmen der Kundenwertanalyse. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes, um den Kundenwert zu bestimmen und daraus strategische Entscheidungen für das Unternehmen abzuleiten.
- Die Bedeutung des Kundenmanagements in der modernen Unternehmensführung
- Das Kundenlebenszykluskonzept und seine Anwendung in der Praxis
- Der Customer Lifetime-Ansatz als Instrument zur monetären Zukunftsbetrachtung von Kunden
- Die Möglichkeiten des Customer Lifetime-Ansatzes zur Gestaltung von Kundenbeziehungen
- Die Grenzen des Customer Lifetime-Ansatzes in Bezug auf die Errechnung von kundenspezifischen Kennzahlen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit. Es wird der Wandel in der Unternehmensführung hin zu einer kundenorientierten Perspektive beleuchtet und der Customer Lifetime-Ansatz als ein Instrument zur Kundenbewertung eingeführt.
Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen des Customer Lifetime-Ansatzes erläutert. Die Begriffe Kundenlebenszyklus, Kundenwert und Customer Lifetime Value werden definiert und ihre Bedeutung für das Verständnis der Arbeit erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Customer Lifetime-Ansatz, Kundenwertmanagement, Kundenlebenszyklus, Kundenbeziehung, Kundenwertanalyse, strategische Entscheidungen, Zukunftsbetrachtung und Kundenkennzahlen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Customer Lifetime Value (CLV)?
Ein Instrument zur Kundenbewertung, das den monetären Wert eines Kunden über die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung in die Zukunft projiziert.
Wie unterscheidet sich Kundenmanagement von Produktmanagement?
Kundenmanagement fokussiert auf den Kunden als wertsteigernden Faktor, statt nur auf den Absatz einzelner Produkte zu schauen.
Welche strategischen Entscheidungen unterstützt der CLV-Ansatz?
Er hilft zu entscheiden, in welche Kunden investiert werden sollte und welche Kundenstrukturen langfristig profitabel sind.
Wo liegen die Grenzen des Customer Lifetime-Ansatzes?
Grenzen liegen vor allem in der Unsicherheit bei der Errechnung zukünftiger Kennzahlen und der Prognose des Kundenverhaltens.
Was ist das Kundenlebenszykluskonzept?
Es beschreibt die verschiedenen Phasen, die ein Kunde durchläuft – von der Akquise über die Bindung bis hin zur potenziellen Abwanderung.
- Arbeit zitieren
- Christoph Weigel (Autor:in), 2012, Möglichkeiten und Grenzen des Customer Lifetime-Ansatzes zur Kundenbewertung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187071