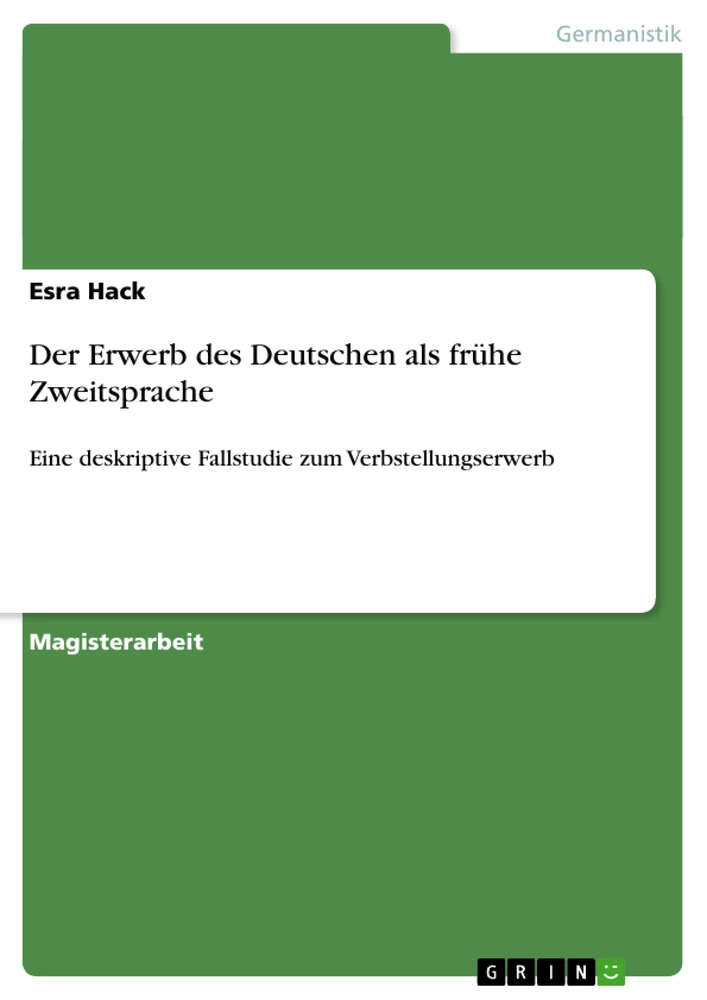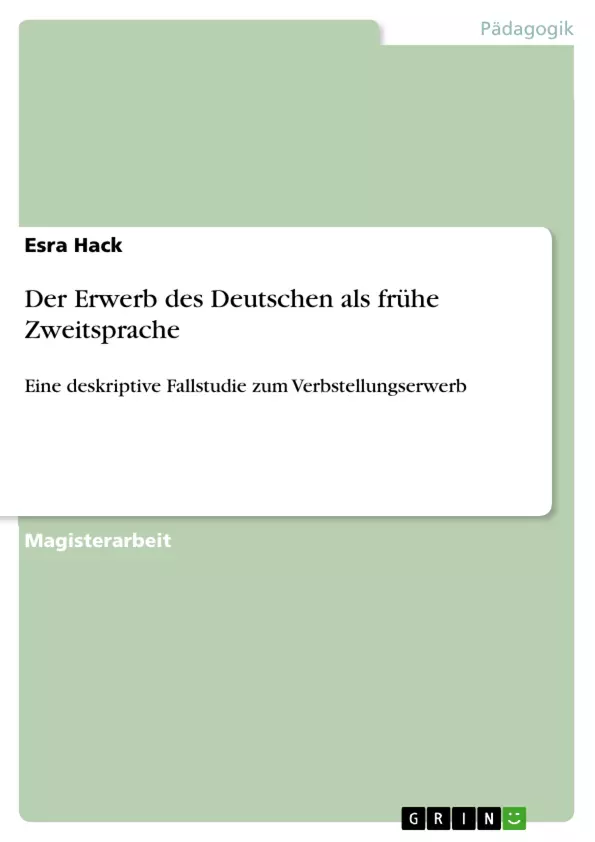1. Einleitung
„Sprache ist der Papagei des Gedankens, und ein schwer gelehriger, nichts weiter.“
Friedrich Hebbel (1813 – 1863)
Es ist immer erstaunlich, einem heranwachsenden Kind zuzuschauen, wenn es seine ersten Worte spricht. Umso erstaunlicher ist es, einem Kind zuzuschauen, dessen Eltern verschiedene Sprachen sprechen. Welches Wort aus welcher Sprache wird es denn wohl als erstes aussprechen? Nicht immer entfalten sich die Sprachen aus der Familiensituation. Es ist genauso bemerkenswert, wenn Kinder, die sehr früh eine andere Sprache lernen, als die ihrer Familie, sie rasch und mühelos erwerben. Die Leistung, die diese Kinder beim Erlernen der Sprache hervorbringen, ist lobenswert. Die Gedanken sind zwar „schwer gelehrig“, die zunächst noch „fremde“ Sprache können sich die Kinder jedoch wie ihre Muttersprache erarbeiten. Auf dem (unbewussten) Weg zur kompetenten Beherrschung der Sprache hinterlassen sie eine Spur, die von Wissenschaftlern genau beobachtet, rekonstruiert und interpretiert werden kann. Die vorliegende Arbeit widmet sich einer solchen Beobachtung der Sprachentwicklung eines Grundschulkindes, das die deutsche Sprache erwirbt, nachdem es ihre Muttersprache, das Türkische, in Grundzügen erworben hat.
Es gibt insgesamt drei Typen des Erwerbs einer Sprache: Das Kind, das zum ersten Mal eine Sprache erwirbt, d. h. nach seiner Geburt, erwirbt es als eine Erstsprache. Beim Erwerb zweier Sprachen gleichzeitig, das sich meistens aus der Familienkonstellation ergibt, handelt es sich um den doppelten bzw. bilingualen Erstspracherwerb. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf dem Erwerb des Deutschen als frühe Zweitsprache. Dies bedeutet, der Erwerb des Deutschen beginnt, nachdem die Erstsprache im Wesentlichen abgeschlossen ist, jedoch im kindlichen Alter.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Die Spracherwerbstypen
- 2.2 Der frühe Zweitspracherwerb
- 2.2.1 Die Lernersprache
- 2.2.2 Die Entwicklungssequenzen
- 3. Der Lerngegenstand
- 3.1 Das Verbstellungsmuster des Deutschen
- 3.2 Die Verbstellung im Türkischen
- 3.3 Annahmen zum L1-Einfluss
- 4. Die Verbstellung im ESE und im frühen ZSE
- 5. Die Analyse
- 5.1 Die Probandin
- 5.2 Die Methode
- 5.2.1 Verfahren zur Datengewinnung
- 5.2.2 Transkriptionsverfahren
- 5.2.3 Die Beschreibungskategorien
- 5.3 Silas Lernersprache: Die Analyse
- 5.3.1 Verbzweitstellung und Vorfeldbesetzung
- 5.3.2 Verb-Erst-Sätze
- 5.3.3 Verb-End in Nebensätzen
- 6. Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Erwerb der deutschen Verbstellung als frühe Zweitsprache anhand einer deskriptiven Fallstudie. Ziel ist die Beschreibung des Verbstellungserwerbs bei einer türkischsprachigen Probandin und die Analyse des Einflusses der Erstsprache auf den Zweitspracherwerbsprozess.
- Beschreibung des Verbstellungsmusters im Deutschen und im Türkischen
- Analyse der Entwicklungssequenzen im frühen Zweitspracherwerb des Deutschen
- Untersuchung des Einflusses der Erstsprache (Türkisch) auf den Erwerb der deutschen Verbstellung
- Deskriptive Analyse der Lernersprache der Probandin
- Diskussion der Ergebnisse und Ausblick auf weitere Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient als Einleitung. Kapitel 2 bietet einen theoretischen Hintergrund zum Spracherwerb, insbesondere zum frühen Zweitspracherwerb und den relevanten Entwicklungssequenzen. Kapitel 3 beschreibt den Lerngegenstand, die deutsche und türkische Verbstellung, und stellt Annahmen zum L1-Einfluss vor. Kapitel 4 diskutiert die Verbstellung im Erst- und Zweitspracherwerb. Kapitel 5 präsentiert die Analysemethode und die Ergebnisse der Fallstudie, fokussiert auf die Verbzweitstellung, Verb-Erst-Sätze und Verb-Endstellung in Nebensätzen.
Schlüsselwörter
Früher Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache, Verbstellung, Erstsprache (Türkisch), Lernersprache, Entwicklungssequenzen, L1-Einfluss, deskriptive Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „frühem Zweitspracherwerb“?
Es beschreibt den Erwerb einer zweiten Sprache im Kindesalter, nachdem die Erstsprache in ihren Grundzügen bereits abgeschlossen ist.
Wie unterscheidet sich die Verbstellung im Deutschen und Türkischen?
Das Deutsche nutzt meist die Verbzweitstellung im Hauptsatz, während das Türkische eine klassische Verbendstellung (SOV-Struktur) aufweist.
Welchen Einfluss hat die Erstsprache auf das Lernen von Deutsch?
Die Arbeit analysiert den sogenannten L1-Einfluss, bei dem Strukturen der Muttersprache (wie die türkische Verbstellung) anfangs auf die Zielsprache übertragen werden.
Was sind typische Entwicklungssequenzen beim Spracherwerb?
Kinder durchlaufen feste Phasen, z. B. von Einwortsätzen über die fehlerhafte Verbstellung bis hin zur korrekten Beherrschung von Haupt- und Nebensätzen.
Was wurde in der Fallstudie mit der Probandin „Sila“ untersucht?
Es wurde detailliert beobachtet, wie Sila die deutsche Verbzweitstellung, Verb-Erst-Sätze und die Endstellung in Nebensätzen im Zeitverlauf erlernt.
Ist bilingualer Erstspracherwerb dasselbe wie früher Zweitspracherwerb?
Nein, beim bilingualen Erstspracherwerb lernt das Kind zwei Sprachen gleichzeitig ab der Geburt, während der Zweitspracherwerb zeitlich versetzt stattfindet.
- Citar trabajo
- Esra Hack (Autor), 2010, Der Erwerb des Deutschen als frühe Zweitsprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187116