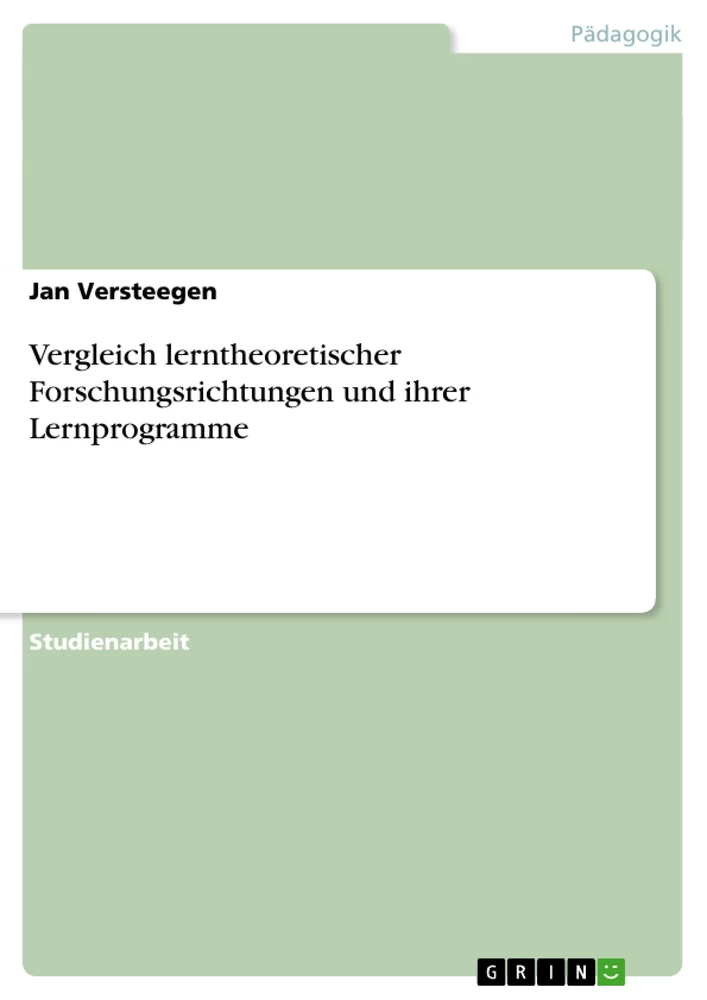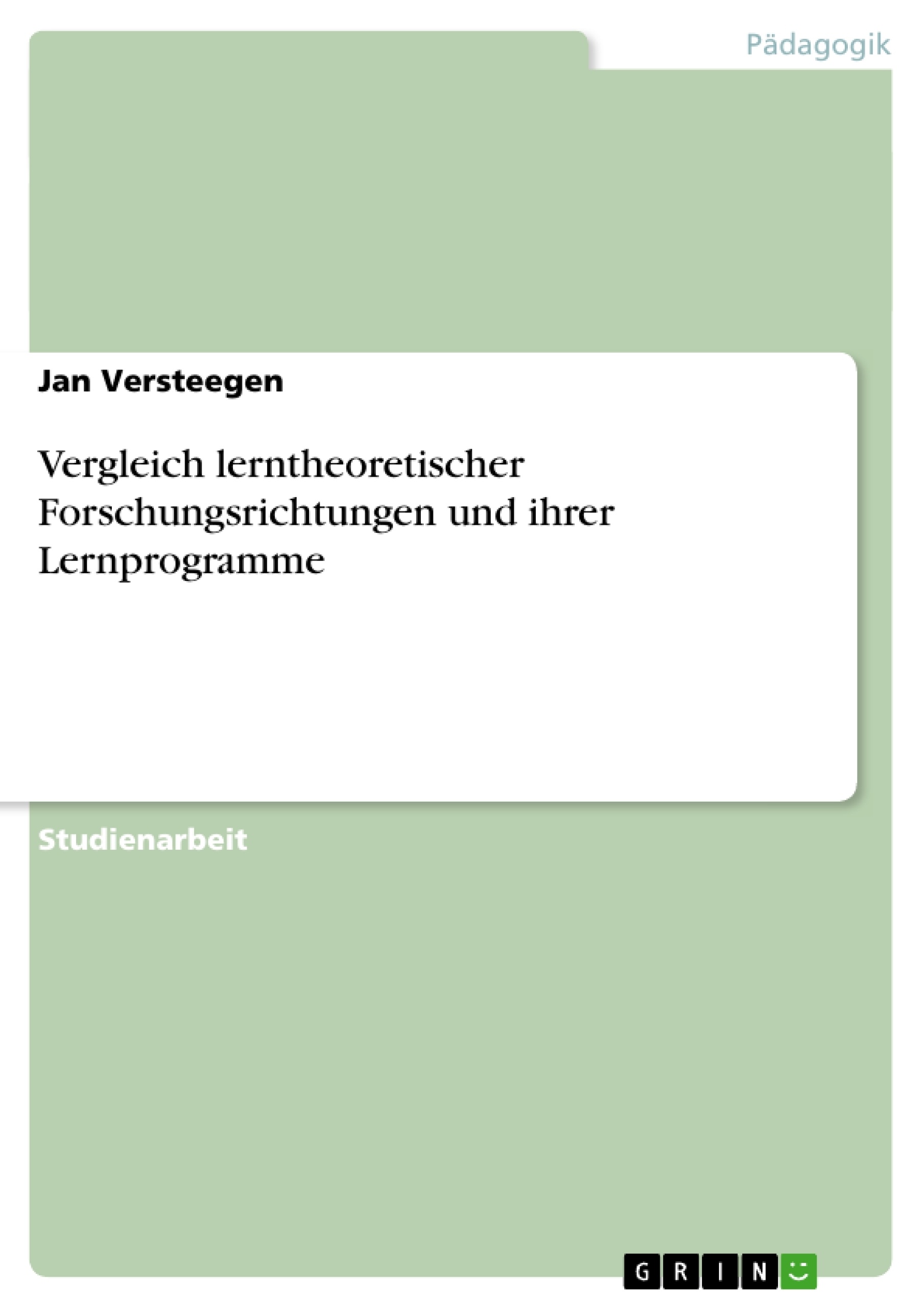Computerunterstütztes Lernen ist weit verbreitet. Nahezu zu jedem Thema gibt es
inzwischen Software, die dem interessierten Nutzer das jeweils spezifische
Themengebiet nahe bringen soll. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob es reicht, den
zu lernenden Stoff lediglich in eine elektronische Form zu bringen, oder ob es mehr
braucht, damit ein computerunterstützes Lernprogramm dem Lernenden von Nutzen
ist.
Ich werde mich im Rahmen dieser Arbeit mit drei unterschiedlichen lerntheoretischen
Forschungsrichtungen beschäftigen, die jeweils für sich spezifische Lernprogramme
entwickelt haben.
Um die Unterschiede deutlich zu machen, werde ich erst auf die allgemeinen
Annahmen der Forschungsrichtungen eingehen und im Anschluss daran
verschiedene Software-Entwicklungen der unterschiedlichen Richtungen vorstellen,
die meiner Meinung nach zu den wichtigsten Vertreten der jeweiligen
wissenschaftlichen Richtung gehören.
Da es wie bereits erwähnt nicht nur darum gehen kann, Übungsmaterial in
elektronische Form zu bringen, gehe ich im dritten Kapitel auf didaktische
Gesichtspunkte ein, die ein Computer-Lernprogramm erfüllen sollte, damit der
Lernende sinnvoll damit lernen kann. An den hier dargestellten didaktischen
Gesichtspunkten werde ich mich bei der Beschreibung dreier verschiedener
Lernprogramme im vierten Kapitel orientieren.
Bei diesen drei Lernprogrammen handelt es sich um aktuelle Software. Im speziellen
handelt es sich um ein Mathematik-Lernprogramm für die Klassenstufen fünf bis
zehn, um einen Online-Tutor, der an der Universität Trier zur Vorbereitung der
Studierenden auf die Klausur des Seminars „Psychologie für Pädagogen“ eingesetzt
wird. Als drittes Programm stelle ich die interaktive CD-ROM „Eine kurze Geschichte
der Zeit“ vor, die auf dem gleichnamigen Buch von Stephen Hawking aufbaut und
dieses Buch um einige Elemente erweitert. Diese drei Lernprogramme untersuche
ich anhand der in Kapitel drei erarbeiteten didaktischen Gesichtspunkte und versuche, die Lernprogramme einer der in Kapitel zwei vorgestellten
Forschungsrichtungen zuzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Drei Forschungsrichtungen und ihre Lernprogramme
- Der Behaviorismus
- Programmierte Instruktion
- Drillprogramme
- Autorensysteme
- Exkurs: Die Bedeutung von Feedback
- Die Bedingungen menschlichen Lernens - GAGNÉ
- Kognitivismus
- Tutorielle Lernprogramme
- Parallelen zur Phänomenologie
- Konstruktivismus
- Hypertext-Anwendungen
- Probleme von Hypertext-Anwendungen
- Der Behaviorismus
- Didaktische Gesichtspunkte
- Vorstellung verschiedener computerbasierter Lernumgebungen
- HEUREKA ALI - Algebra-Lernprogramm von Klett (Version 1.0)
- Allgemeiner Aufbau
- Was soll vermittelt werden?
- Wie wird das zu Lernende vermittelt?
- Einordnung
- PSYCHOPAED - Online-Tutor für Pädagogen
- Allgemeiner Aufbau
- Was soll vermittelt werden?
- Wie wird das zu Lernende vermittelt?
- Einordnung
- Stephen Hawking – Eine kurze Geschichte der Zeit
- Allgemeiner Aufbau
- Was soll vermittelt werden?
- Wie wird das zu Lernende vermittelt?
- Einordnung
- HEUREKA ALI - Algebra-Lernprogramm von Klett (Version 1.0)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene Lerntheorien und ihre entsprechenden Lernprogramme im Kontext computergestützten Lernens zu vergleichen. Der Fokus liegt dabei auf den drei Hauptströmungen Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus.
- Vergleich unterschiedlicher lerntheoretischer Forschungsrichtungen
- Analyse und Darstellung von Lernprogrammen, die auf den verschiedenen Lerntheorien basieren
- Diskussion didaktischer Gesichtspunkte, die für effektives computergestütztes Lernen relevant sind
- Bewertung von Beispielen für computerbasierte Lernumgebungen anhand der zuvor erarbeiteten didaktischen Kriterien
- Einordnung der Lernprogramme in die jeweiligen lerntheoretischen Forschungsrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des computergestützten Lernens und die Relevanz des Themas vor. Sie führt die drei zentralen lerntheoretischen Forschungsrichtungen (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus) ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 befasst sich mit den drei Forschungsrichtungen Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus und ihren jeweiligen Lernprogrammen. Es werden die grundlegenden Annahmen der einzelnen Richtungen dargestellt sowie Beispiele für Software-Entwicklungen vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich didaktischen Gesichtspunkten, die für die Gestaltung von effektiven Computer-Lernprogrammen relevant sind. Es werden Kriterien für die Gestaltung von Lernsoftware erarbeitet, die den Lernprozess optimieren sollen.
In Kapitel 4 werden drei aktuelle Lernprogramme vorgestellt und anhand der in Kapitel 3 erarbeiteten didaktischen Kriterien analysiert. Ziel ist es, die Lernprogramme den einzelnen Forschungsrichtungen zuzuordnen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lerntheorie, Computergestütztes Lernen, Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus, Lernprogramme, Didaktik, Software-Entwicklung, Lernumgebungen. Die vorgestellten Lernprogramme illustrieren die verschiedenen Ansätze in der Praxis und verdeutlichen die Bedeutung der didaktischen Kriterien für die Gestaltung effektiver Lernsoftware.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Unterschiede zwischen Behaviorismus und Kognitivismus beim Lernen?
Der Behaviorismus setzt auf Reiz-Reaktions-Muster und Drill, während der Kognitivismus die internen Verarbeitungsprozesse und tutorielles Lernen in den Vordergrund stellt.
Wie definiert der Konstruktivismus computergestütztes Lernen?
Im Konstruktivismus ist Lernen ein aktiver Aufbau von Wissen; Programme nutzen hier oft Hypertext-Anwendungen, die dem Lernenden explorative Freiräume lassen.
Welche didaktischen Kriterien sollte Lernsoftware erfüllen?
Software sollte klare Lernziele verfolgen, sinnvolles Feedback geben, das Vorwissen einbeziehen und eine intuitive Benutzeroberfläche bieten.
Was ist das Lernprogramm PSYCHOPAED?
Es handelt sich um einen Online-Tutor der Universität Trier, der Studierende auf Prüfungen im Bereich Psychologie für Pädagogen vorbereitet.
Reicht es, Stoff einfach in elektronische Form zu bringen?
Nein, für effektives Lernen muss die Software didaktisch aufbereitet sein und den lerntheoretischen Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe entsprechen.
- Citation du texte
- Jan Versteegen (Auteur), 2003, Vergleich lerntheoretischer Forschungsrichtungen und ihrer Lernprogramme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18711