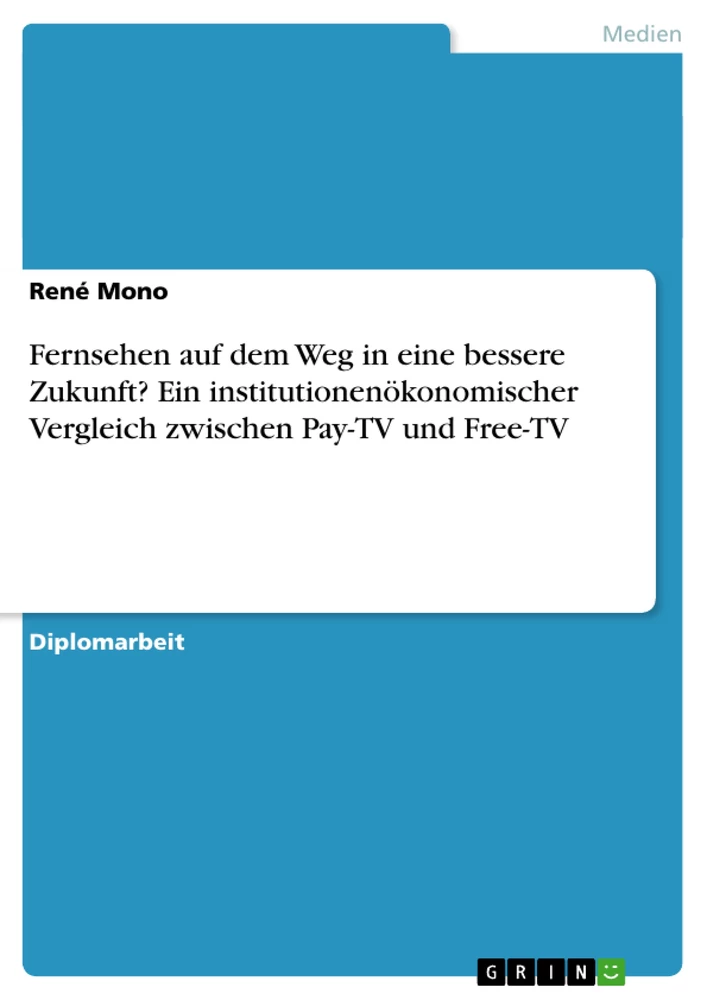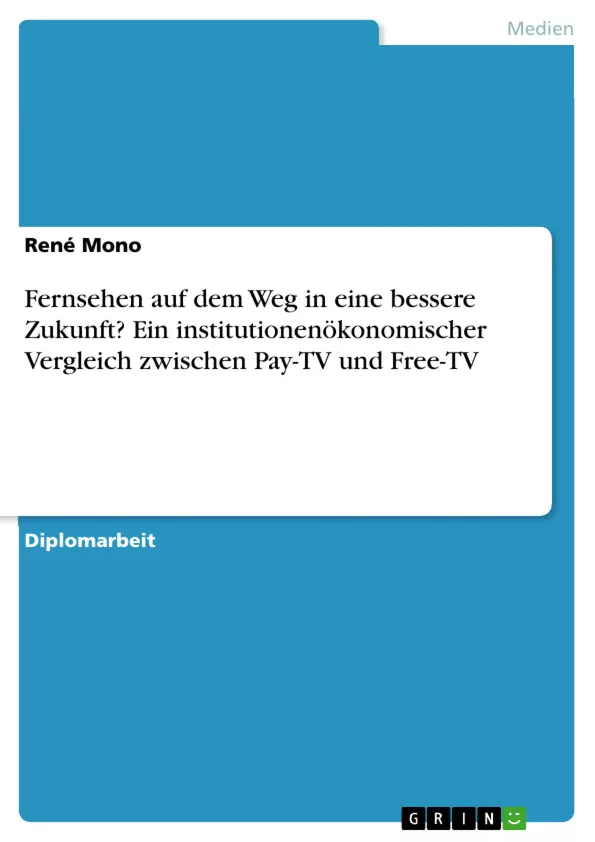Diese Arbeit untersucht, welche Unterschiede Pay-TV im Vergleich zu Free-TV auf dem
Fernsehmarkt bewirkt und wie dies ökonomisch zu bewerten ist.
Zunächst wird aufgezeigt, dass die klassische Ökonomik diese Frage nicht entscheiden kann.
Stattdessen ist ein Dilemma festzustellen: Einerseits sorgt Pay-TV für eine bessere Allokation
zwischen Angebot und Nachfrage, andererseits tritt bei Pay-TV stets ein Wohlfahrtsverlust auf. Aus
Sicht der klassischen Ökonomik ist es daher nicht unmittelbar einsichtig, welche
Fernsehfinanzierungsform zu bevorzugen ist. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Annahmen
der klassischen ökonomischen Theorie der Realität auf dem Fernsehmarkt nicht gerecht werden.
Diese Arbeit wendet als alternativen Lösungsansatz die Neue Institutionenökonomik an, die einen
besseren Blick auf die Realität verspricht.
Zunächst werden die Transaktionskosten, die bei Pay-TV auftreten, mit denen verglichen, die bei
Free-TV anfallen. Anschließend werden die Besonderheiten von Pay-TV gegenüber Free-TV aus der
Perspektive der Prinzipal-Agent-Theorie herausgestellt. Ergänzend wird untersucht, inwiefern
Strategien der Informationsökonomik hilfreich sind, Informationsdefizite auf dem Pay-TV- und Free-
TV-Markt zu überwinden.
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass aus der Perspektive der Transaktionskostenökonomik, der
Prinzipal-Agent-Theorie und der Informationsökonomik Pay-TV Free-TV vorzuziehen ist, solange
man die Prämisse der Konsumentensouveränität als Basiskonzept moderner Marktwirtschaften
anerkennt.
Aus dieser Erkenntnis werden zum Ende dieser Arbeit, die auf eine empirische Überprüfung ihrer
Ergebnisse verzichten muss, Handlungsempfehlungen abgeleitet: Pay-TV ist rundfunkpolitisch zu
fördern; neue Aufgabe für die öffentlich-rechtlichen Sender sind zu definieren.
Inhaltsverzeichnis
- 0. EINLEITUNG
- 1. AUFBAU DER ARBEIT UND METHODISCHES VORGEHEN
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 1.2 Methodisches Vorgehen
- 1.3 Definition zentraler Begriffe
- 2. FINANZIERUNGSFORMEN VON FERNSEHEN
- 2.1 Drei Finanzierungsmodelle und deren ökonomische Bedeutung in Europa
- 2.2 Finanzierung durch öffentliche Gelder (Gebühren oder Steuern)
- 2.3 Finanzierung durch Werbung
- 2.4 Entgeltfinanziertes Fernsehen
- 2.5 Exkurs: Normen und Qualitätskriterien im Vergleich
- 2.5.1 Die normativen Kriterien der klassischen ökonomischen Theorie: Wohlfahrtsökonomik und Pareto-Effizienz
- 2.5.2 Der ökonomische Qualitätsbegriff und das Primat der Konsumentensouveränität
- 2.5.3 Normative Kriterien der Institutionenökonomik und der Kommunikationswissenschaft
- 3. PRO FREE-TV ODER PRO PAY-TV? ARGUMENTE DER KLASSISCHEN ÖKONOMIK
- 3.1 Einführung in die Grundpositionen einer ungelösten Streitfrage
- 3.2 Die Bedeutung des Preises für ein Marktsystem
- 3.2.1 Allokationsleistung des Preises
- 3.2.2 Bekundete Präferenzen, Zahlungsbereitschaft und Reservationspreis
- 3.3 Fernsehen als öffentliches Gut
- 3.3.1 Nicht-Ausschließbarkeit und Non-Rivalität im Konsum beim Fernsehen
- 3.3.2 Die Preisbildung bei Fernsehen als öffentlichem Gut mit Grenzkosten von Null
- 3.3.3 Wohlfahrtsverlust durch Pay-TV
- 3.4 Die economics of television Forschung um Owen
- 3.4.1 Das Dilemma des Pay-TV
- 3.4.2 Das Spence-Owen Modell
- 3.4.3 Der Nutzen des Fernsehzuschauers aus Werbung
- 3.4.4 Das Owen-Wildman-Modell
- 3.4.5 Individuelle Preisdifferenzierung bei Pay-TV
- 3.4.6 Vielfalt im Pay-TV und das Problem der program duplication
- 3.4.7 Wer hat Recht - Samuelson oder Minasian? Vorschlag eines alternativen Lösungsansatzes
- 4. DIE NEUE INSTITUTIONENÖKONOMIK ALS LÖSUNGSALTERNATIVE
- 4.1 Grundannahmen der Neuen Institutionenökonomik
- 4.1.1 Die Neue Institutionenökonomik und die Klassische Theorie
- 4.1.2 Unvollkommene Information und bounded rationality
- 4.2 Anwendung der NIÖ auf den Fernsehbereich
- 4.2.1 Adverse selection und moral hazard im Fernsehmarkt
- 4.2.2 Fernsehnutzung aus einer ökonomischen Perspektive
- 4.2.3 Fernsehnutzung als nicht-vollständig rationales Verhalten
- 4.1 Grundannahmen der Neuen Institutionenökonomik
- 5. BEWERTUNG DES PAY-TV AUS INSTITUTIONENÖKONOMISCHER SICHT
- 5.0 Auswahl institutionenökonomischer Ansätze
- 5.1 Mediennutzung als Transaktion
- 5.2 Transaktionskostenökonomischer Vergleich zwischen Pay-TV und Free-TV
- 5.2.1 Kernideen der Transaktionskostenökonomik
- 5.2.2 Transaktionskosten auf dem Fernsehmarkt
- 5.2.3 Transaktionskosten der Anbieter bei Free- und Pay-TV
- 5.2.4 Transaktionskosten der Zuschauer
- 5.2.5 Versuch einer transaktionskostenrechnerischer Gesamtdarstellung
- 5.3 Die Prinzipal-Agent-Theorie und ihre Anwendung auf den Fernsehmarkt
- 5.3.1 Kernaussagen der Prinzipal-Agent-Theorie
- 5.3.2 Fernsehnutzung als Agency-Beziehung
- 5.3.3 Anreizschemata bei Free-TV und Pay-TV
- 5.3.4 Prinzipal-Agent-theoretische Bewertung von Pay-TV
- 5.4 Informationsökonomische Betrachtung des Pay-TV-Marktes
- 5.4.1 Adverse selection und Marktversagen bei Pay-TV?
- 5.4.2 Agency Costs als Strategien gegen Marktversagen
- 5.4.3 Screening und signalling auf dem Pay-TV-Markt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen Pay-TV und Free-TV im Hinblick auf ihre ökonomische Bewertung. Sie hinterfragt die Grenzen der klassischen Ökonomik bei der Beantwortung dieser Frage und wendet die Neue Institutionenökonomik als alternatives Modell an. Die Arbeit zielt darauf ab, Handlungsempfehlungen für die Rundfunkpolitik abzuleiten.
- Vergleich der ökonomischen Bewertung von Pay-TV und Free-TV
- Anwendung der Neuen Institutionenökonomik auf den Fernsehmarkt
- Analyse von Transaktionskosten, Prinzipal-Agent-Theorie und Informationsökonomik im Kontext von Pay-TV und Free-TV
- Ableitung rundfunkpolitischer Implikationen
- Bewertung der Konsumentensouveränität als Basiskonzept
Zusammenfassung der Kapitel
0. EINLEITUNG: Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der ökonomischen Bewertung von Pay-TV im Vergleich zu Free-TV und die Notwendigkeit eines institutionenökonomischen Ansatzes heraus, da die klassische Ökonomik keine eindeutige Antwort liefert.
1. AUFBAU DER ARBEIT UND METHODISCHES VORGEHEN: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau der Arbeit und das methodische Vorgehen, das auf der Anwendung der Neuen Institutionenökonomik basiert. Es definiert zudem zentrale Begriffe, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.
2. FINANZIERUNGSFORMEN VON FERNSEHEN: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Finanzierungsmodelle des Fernsehens (öffentlich, werbefinanziert, Pay-TV) und deren ökonomische Bedeutung in Europa. Es analysiert die jeweiligen Vor- und Nachteile und stellt unterschiedliche normative Kriterien im Vergleich gegenüber.
3. PRO FREE-TV ODER PRO PAY-TV? ARGUMENTE DER KLASSISCHEN ÖKONOMIK: Dieses Kapitel präsentiert die Argumente der klassischen Ökonomik zur Frage, ob Free-TV oder Pay-TV zu bevorzugen ist. Es beleuchtet die Rolle des Preises, das Problem des Fernsehens als öffentliches Gut, die Problematik des Wohlfahrtsverlusts bei Pay-TV und verschiedene ökonomische Modelle, die diese Thematik behandeln (z.B. Spence-Owen-Modell).
4. DIE NEUE INSTITUTIONENÖKONOMIK ALS LÖSUNGSALTERNATIVE: Dieses Kapitel begründet die Verwendung der Neuen Institutionenökonomik als alternatives analytisches Modell. Es erläutert die Grundannahmen der Neuen Institutionenökonomik, insbesondere die Berücksichtigung unvollständiger Informationen und beschränkter Rationalität, und deren Anwendung auf den Fernsehmarkt.
5. BEWERTUNG DES PAY-TV AUS INSTITUTIONENÖKONOMISCHER SICHT: Dieses Kapitel analysiert Pay-TV aus der Perspektive der Transaktionskostenökonomik, der Prinzipal-Agent-Theorie und der Informationsökonomik. Es vergleicht die Transaktionskosten von Pay-TV und Free-TV für Anbieter und Zuschauer, analysiert die Prinzipal-Agent-Beziehung im Fernsehsektor und betrachtet Informationsasymmetrien und Strategien zur Bewältigung von Marktversagen.
Schlüsselwörter
Pay-TV, Free-TV, Neue Institutionenökonomik, Transaktionskosten, Prinzipal-Agent-Theorie, Informationsökonomik, Wohlfahrtsverlust, Konsumentensouveränität, Rundfunkpolitik, Marktversagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Ökonomische Bewertung von Pay-TV und Free-TV
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ökonomische Bewertung von Pay-TV im Vergleich zu Free-TV. Sie beleuchtet die Grenzen der klassischen ökonomischen Theorie bei der Beantwortung dieser Frage und verwendet die Neue Institutionenökonomik als alternatives Modell, um Handlungsempfehlungen für die Rundfunkpolitik abzuleiten. Ein zentraler Aspekt ist die Bewertung der Konsumentensouveränität.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Neue Institutionenökonomik. Konkret werden die Transaktionskostenökonomik, die Prinzipal-Agent-Theorie und die Informationsökonomik angewendet, um Pay-TV und Free-TV zu analysieren und zu vergleichen.
Welche Finanzierungsmodelle werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Finanzierungsmodelle des Fernsehens, darunter öffentlich finanzierte Sender (durch Gebühren oder Steuern), werbefinanziertes Fernsehen und Pay-TV. Die ökonomische Bedeutung dieser Modelle in Europa wird analysiert.
Welche Argumente der klassischen Ökonomik werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Rolle des Preises, das Problem des Fernsehens als öffentliches Gut (Nicht-Ausschließbarkeit und Nicht-Rivalität), den potentiellen Wohlfahrtsverlust durch Pay-TV und relevante ökonomische Modelle wie das Spence-Owen-Modell.
Warum wird die Neue Institutionenökonomik verwendet?
Die klassische Ökonomik liefert keine eindeutige Antwort auf die Frage, welches Modell (Pay-TV oder Free-TV) vorzuziehen ist. Daher wird die Neue Institutionenökonomik mit ihren Annahmen zu unvollständiger Information und beschränkter Rationalität als alternatives analytisches Modell eingesetzt.
Wie wird Pay-TV aus institutionenökonomischer Sicht bewertet?
Pay-TV wird anhand der Transaktionskosten (für Anbieter und Zuschauer), der Prinzipal-Agent-Beziehung (zwischen Sender und Zuschauer) und unter Berücksichtigung von Informationsasymmetrien und Strategien zur Bewältigung von Marktversagen (Adverse Selection, Moral Hazard) analysiert.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie Pay-TV, Free-TV, Transaktionskosten, Prinzipal-Agent-Theorie, Informationsökonomik, Wohlfahrtsverlust und Konsumentensouveränität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Aufbau und methodisches Vorgehen, Finanzierungsformen von Fernsehen, Argumente der klassischen Ökonomik und Bewertung des Pay-TV aus institutionenökonomischer Sicht. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeschlüsselt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt auf die Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Rundfunkpolitik ab, basierend auf dem institutionenökonomischen Vergleich von Pay-TV und Free-TV. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Text der Arbeit selbst zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pay-TV, Free-TV, Neue Institutionenökonomik, Transaktionskosten, Prinzipal-Agent-Theorie, Informationsökonomik, Wohlfahrtsverlust, Konsumentensouveränität, Rundfunkpolitik, Marktversagen.
- Citar trabajo
- René Mono (Autor), 2003, Fernsehen auf dem Weg in eine bessere Zukunft? Ein institutionenökonomischer Vergleich zwischen Pay-TV und Free-TV, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18723