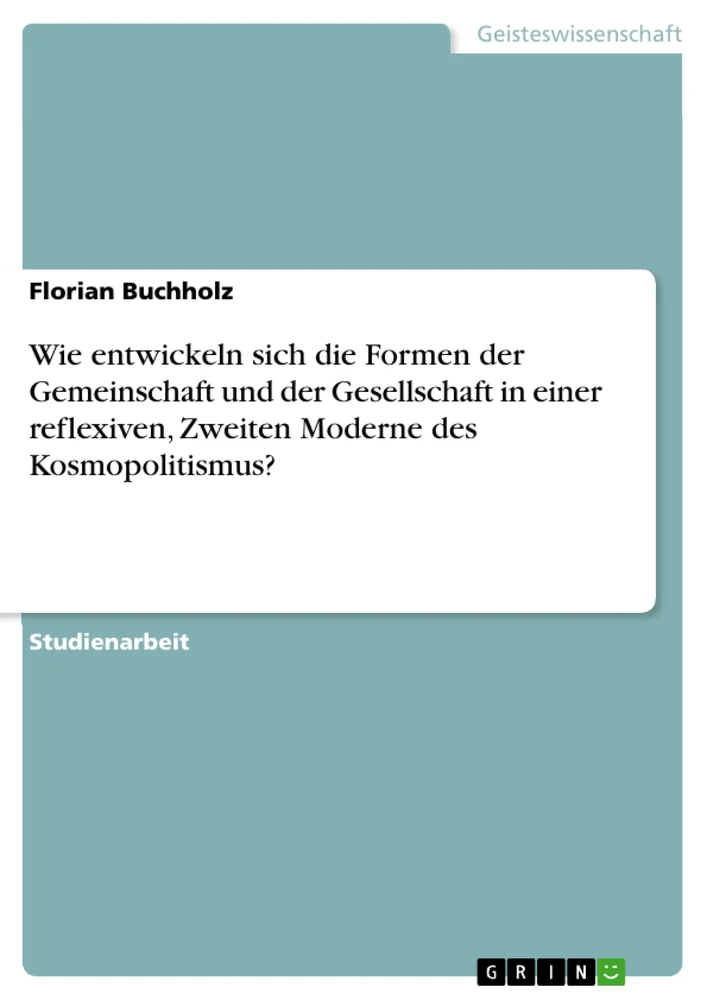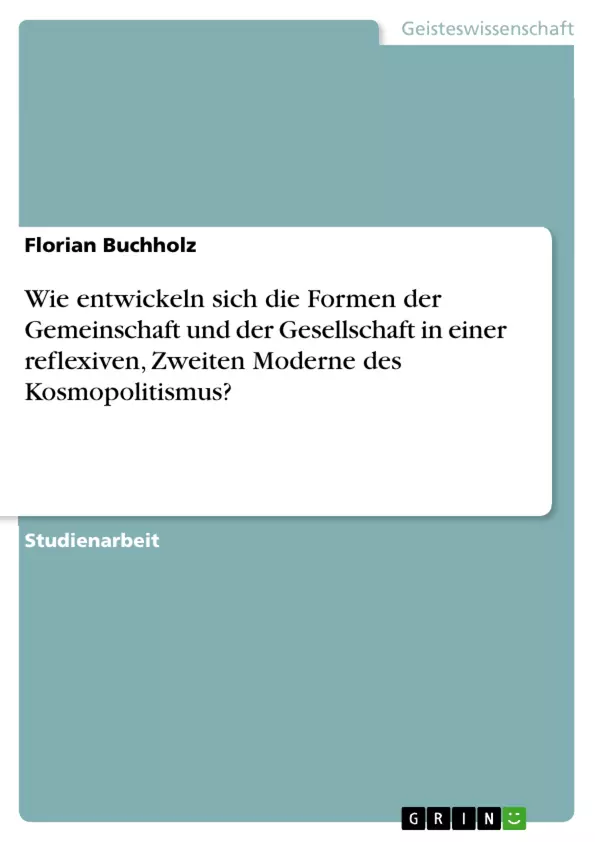Die Frage nach der Entwicklung der gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Formen des sozialen Zusammenlebens in einer reflexiven, Zweiten Moderne des Kosmopolitismus, setzt voraus, dass es sich dabei nicht um ein starres Gefüge des Zusammenlebens handelt. In der vorliegenden Hausarbeit werden die Zusammenhänge und die Entwicklung von Gemeinschaft, Gesellschaft und Kosmopolitismus näher betrachtet. Kosmopolitismus wird in der als reflexiv bezeichneten Epoche der Zweiten Moderne ermöglicht. Um die Frage zu erörtern, wird zunächst die Sichtweise von Tönnies und Plessner auf die Begrifflichkeiten Gemeinschaft und Gesellschaft dargelegt. Weiterhin wird darauf eingegangen, durch was die Formen der Gemeinschaft und der Gesellschaft begrenzt sind. Anschließend werden die im Kontext der Hausarbeit wichtigen Erkenntnisse aus diesem Teil zusammengefasst. Der folgende Abschnitt behandelt die Idee des Kosmopolitismus, orientiert an Luhmann und in diesem Kontext wird explizit auf Luhmanns Systemtheorie eingegangen. Danach wird erörtert, wie sich die Formen Gemeinschaft, Gesellschaft und Kosmopolitismus im Zusammenspiel entwickeln und der Gedanke einer möglichen Begrenzung der Gesellschaft wird angedeutet. Dieser Gedanke wird im Verlauf der Hausarbeit erneut aufgenommen. Im Anschluss wird der Begriff der Zweiten Moderne nach Beck eingeführt, weiter wird darauf eingegangen warum Beck die Moderne als reflexiv betrachtet und was unter Reflexivität zu verstehen ist. Über die Reflexivität der Zweiten Moderne wird bei Becks Vorstellung einer Weltrisikogesellschaft eingegangen. In diesem Kontext werden seine Idee der Risikoverteilung und die damit verbundenen Konfliktsituationen erläutert. Unter der Vorstellung, dass Gesellschaft und Institutionen im Zusammenhang stehen wird aufgezeigt, wieso die Entwicklung eines Kosmopolitismus in der Verantwortung aller Individuen gesehen werden kann. Danach werden zwei Sichtweisen auf den Kosmopolitismus vorgestellt, zum Einen im Sinne einer Weltgesellschaft und zum Anderen als Weltbürgertum. Im folgenden Abschnitt wird unter Zuhilfenahme von Luhmanns Systemtheorie die Vorstellung von einem Kosmopolitismus im Sinne eines Weltbürgertums erläutert. Abschließend folgt eine Zusammenfassung aller Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Thema
- Gemeinschaft und Gesellschaft
- Gemeinschaft
- Gesellschaft
- Abriss der Gemeinschaft und der Gesellschaft
- Kosmopolitismus
- Einführung in die Idee der Entwicklung von Gemeinschaft, Gesellschaft und Kosmopolitismus
- Die Weltrisikogesellschaft in der zweiten Moderne
- Die Zweite Moderne
- Reflexivität der Modernisierung
- Risikogesellschaft
- Entwicklung der Gesellschaft zum Weltbürgertum
- Grenzen der Gesellschaft
- Kosmopolitismus - eine andere, globale Form der Gesellschaft?
- Die Überlagerung der Gesellschaft durch den Kosmopolitismus
- Resümee
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung von Gemeinschaft und Gesellschaft in einer reflexiven Zweiten Moderne des Kosmopolitismus. Ziel ist es, die Zusammenhänge und die Entwicklung dieser drei Konzepte zu beleuchten und zu analysieren, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und möglicherweise begrenzen.
- Die Konzepte von Gemeinschaft und Gesellschaft nach Tönnies und Plessner
- Die Rolle des Kosmopolitismus in der Zweiten Moderne
- Die Grenzen der Gesellschaft und die Entstehung einer globalen Gesellschaft
- Reflexivität der Modernisierung und die Weltrisikogesellschaft
- Die Entwicklung des Weltbürgertums
Zusammenfassung der Kapitel
Thema: Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Gemeinschaft und Gesellschaft im Kontext des Kosmopolitismus in der reflexiven Zweiten Moderne. Sie skizziert den Ansatz und die Struktur der Argumentation, die auf den Theorien von Tönnies, Plessner, Luhmann und Beck basiert. Die Arbeit betont den dynamischen Charakter der sozialen Strukturen und kündigt eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Konzepte an.
Gemeinschaft und Gesellschaft: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden die Perspektiven von Tönnies und Plessner auf Gemeinschaft und Gesellschaft vorgestellt. Tönnies' Unterscheidung zwischen organischer und mechanischer Solidarität und seine Typologie von Gemeinschaften (Blut, Ort, Geist) wird erläutert. Plessners philosophischer Zugang zur Gemeinschaft als Ethos im sozialen Zusammenleben wird ebenfalls betrachtet. Das Kapitel bildet die Basis für das Verständnis der Entwicklung dieser sozialen Formen im Kontext der Zweiten Moderne.
Kosmopolitismus: Dieses Kapitel erörtert den Begriff des Kosmopolitismus, wobei Luhmanns Systemtheorie eine wichtige Rolle spielt. Es wird die Entstehung und Bedeutung von Kosmopolitismus in einer globalisierten Welt beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Kosmopolitismus als ein soziales Phänomen, das sowohl mit dem Konzept der Gemeinschaft als auch der Gesellschaft interagiert.
Einführung in die Idee der Entwicklung von Gemeinschaft, Gesellschaft und Kosmopolitismus: Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über die Argumentationslinie der Arbeit und die Wechselwirkungen zwischen den drei zentralen Konzepten. Es bereitet den Leser auf die detaillierten Analysen in den folgenden Kapiteln vor und verdeutlicht die Forschungsfrage der Hausarbeit. Es werden hier die einzelnen Teile der Arbeit und deren Bedeutung für die Fragestellung der Hausarbeit zusammengefasst.
Die Weltrisikogesellschaft in der zweiten Moderne: Dieses Kapitel führt den Begriff der Zweiten Moderne nach Beck ein und beschreibt die Reflexivität der Modernisierung. Die Risikogesellschaft und die damit verbundenen Konfliktsituationen werden im Detail analysiert, unter Berücksichtigung von Becks Ideen zur Risikoverteilung. Die Verknüpfung von Gesellschaft, Institutionen und individueller Verantwortung im Kontext des Kosmopolitismus wird hier hervorgehoben. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Zweiten Moderne, der Risikogesellschaft und der Herausbildung kosmopolitischer Strukturen.
Entwicklung der Gesellschaft zum Weltbürgertum: Dieses Kapitel diskutiert die Grenzen der Gesellschaft und die Idee des Kosmopolitismus als eine globale Form der Gesellschaft. Es wird die Überlagerung der Gesellschaft durch den Kosmopolitismus analysiert, wobei Luhmanns Systemtheorie erneut herangezogen wird. Das Kapitel erkundet das Verhältnis von nationalstaatlicher Gesellschaft und globalem Weltbürgertum. Die unterschiedlichen Perspektiven auf Kosmopolitismus, nämlich als Weltgesellschaft und als Weltbürgertum, werden verglichen und die Überlappung der beiden Konzepte diskutiert.
Schlüsselwörter
Gemeinschaft, Gesellschaft, Kosmopolitismus, Zweite Moderne, Reflexivität, Risikogesellschaft, Weltbürgertum, Luhmann, Tönnies, Plessner, Beck.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Entwicklung von Gemeinschaft, Gesellschaft und Kosmopolitismus
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung von Gemeinschaft und Gesellschaft im Kontext des Kosmopolitismus in der reflexiven Zweiten Moderne. Sie analysiert die Zusammenhänge und die gegenseitige Beeinflussung dieser drei Konzepte und deren mögliche Grenzen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den Theorien von Ferdinand Tönnies, Helmuth Plessner, Niklas Luhmann und Ulrich Beck. Tönnies' Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, Plessners philosophischer Zugang zur Gemeinschaft, Luhmanns Systemtheorie und Becks Konzept der Risikogesellschaft bilden die theoretischen Grundlagen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit enthält Kapitel zu Gemeinschaft und Gesellschaft (inkl. der Ansätze von Tönnies und Plessner), Kosmopolitismus (mit Fokus auf Luhmanns Systemtheorie), einer Einführung in die Entwicklung der drei Kernkonzepte, der Weltrisikogesellschaft in der Zweiten Moderne (nach Beck), und der Entwicklung der Gesellschaft zum Weltbürgertum (inkl. einer Analyse der Überlagerung von Gesellschaft und Kosmopolitismus nach Luhmann).
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Ziel ist es, die Entwicklung von Gemeinschaft, Gesellschaft und Kosmopolitismus zu beleuchten und zu analysieren, wie diese Konzepte sich gegenseitig beeinflussen und möglicherweise begrenzen. Der dynamische Charakter sozialer Strukturen steht im Mittelpunkt der Untersuchung.
Welche Rolle spielt der Kosmopolitismus?
Der Kosmopolitismus wird als soziales Phänomen betrachtet, das mit den Konzepten von Gemeinschaft und Gesellschaft interagiert. Die Arbeit untersucht seine Entstehung und Bedeutung in einer globalisierten Welt und analysiert sein Verhältnis zu einer nationalstaatlich geprägten Gesellschaft und dem Weltbürgertum.
Wie wird die Zweite Moderne behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die Zweite Moderne im Kontext von Becks Risikogesellschaft. Die Reflexivität der Modernisierung und die damit verbundenen Konfliktsituationen sowie die Verteilung von Risiken werden analysiert. Der Zusammenhang zwischen der Zweiten Moderne, der Risikogesellschaft und der Herausbildung kosmopolitischer Strukturen wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Gemeinschaft, Gesellschaft, Kosmopolitismus, Zweite Moderne, Reflexivität, Risikogesellschaft, Weltbürgertum, sowie die Namen der relevanten Theoretiker: Luhmann, Tönnies, Plessner und Beck.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit folgt einem klaren Aufbau mit einem Inhaltsverzeichnis, einer Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und einem Schluss mit Schlüsselwörtern. Die Argumentationslinie wird klar dargestellt und die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf.
Welche Grenzen der Gesellschaft werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Grenzen der Gesellschaft im Kontext der Globalisierung und der Entstehung einer globalen Gesellschaft. Das Verhältnis von nationalstaatlicher Gesellschaft und globalem Weltbürgertum sowie die Überlagerung von Gesellschaft und Kosmopolitismus werden analysiert.
- Quote paper
- Florian Buchholz (Author), 2011, Wie entwickeln sich die Formen der Gemeinschaft und der Gesellschaft in einer reflexiven, Zweiten Moderne des Kosmopolitismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187437