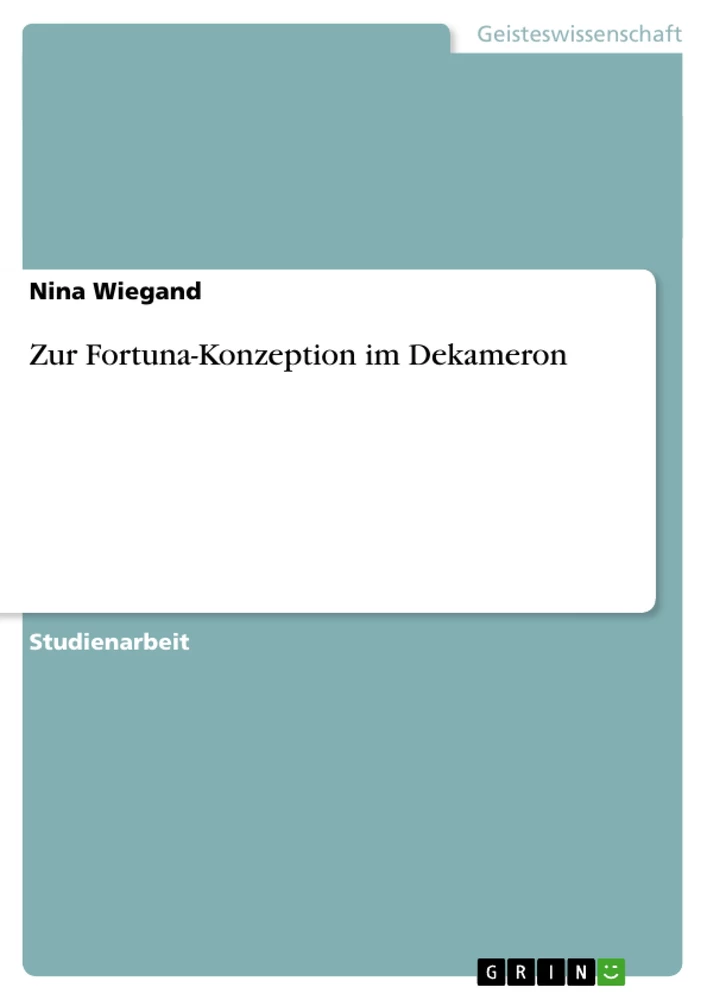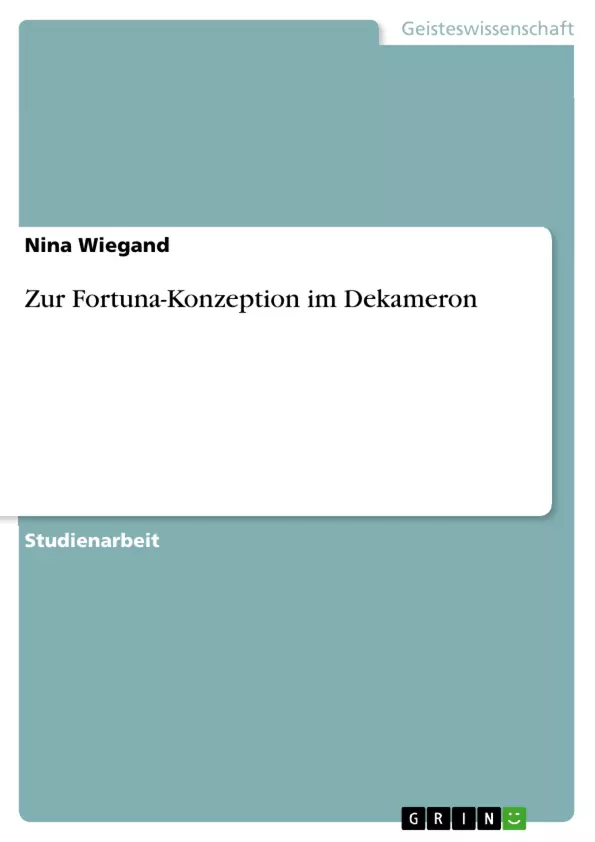Der Topos des Glücks und der daraus abgeleiteten
Thematik der Schicksalsgöttin Fortuna, spielt bereits seit
Jahrhunderten eine prominente Rolle in den Kultur-und
Geisteswissenschaften. Schon in der Antike haben sich
Kirchenväter, wie Augustinus und Philosophenkreise, wie
beispielsweise die Stoa mit dem Fortuna- Begriff
auseinander gesetzt. Auch bei römischen Dichtern und
Schriftstellern, wie zum Beispiel Virgil und Cicero war
die Fortuna beliebter Gegenstand vielfältiger Diskurse.
In meiner Arbeit möchte ich mich auf jene Konzeption
der Fortuna fokussieren, die im Dekameron präsent ist und
anhand ausgewählter Novellen beweisen, dass es im
Dekameron keine einheitliche Fortuna- Konzeption gibt
und vielmehr von einer Koexistenz verschiedener
Konzeptionen ausgegangen werden muss.
Eingangs beschreibe ich das Bild der Fortuna im Zeitalter
der Antike,wobei zwischen einer Lateinischen und
Griechischen Fortuna unterschieden werden muss. Die
Altgriechische Vorstellung einer Fortuna, die das Bild
einer zwielichtigen Schicksalsinstanz aufwirft, bildet die
Grundlage für jene neuzeitliche Fortuna-Konzeption im
Dekameron.
Aber auch die von Dante im siebten Inferno-Gesang der
Divina Commedia entwickelten Fortuna,fließt in das
Dekameron mit ein. Dante stellt die Fortuna komplett in
den Dienst des Schöpfers, als dessen Verwalter sie die
Geschicke der Menschen auf der Erde steuert. Die
Ähnlichkeiten der Fortuna-Konzeptionen, die zwischen
der Divina Commedia und dem Dekameron existieren,
stelle ich anhand des Inferno-Gesangs der dritten Novelle
des zweiten Tages dar.
Um den Zuständigkeitsbereich und die Wirkungsweise der
Fortuna besser darzustellen, grenze ich die beiden
Wirkungsmächte der Natur und der Fortuna
gegeneinander ab. Als Grundlage dafür, werde ich die
zweite Novelle des sechsten Tages heranziehen, in der die
beiden „ministre del mondo“ (Kablitz 1990:22)
gegensätzlicher nicht wirken können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.1 Die Fortuna-Konzeption in der Antike
- 2.1.1 Lateinische Fortuna
- 2.1.2 Griechische Fortuna
- 2.2 Vergleich der Fortuna-Konzeption mit Dantes Divina Commedia (Inf. VII, 70-96)
- 2.2.1 Dantes Divina Commedia (Inf. VII, 61-96)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption der Fortuna im Dekameron von Boccaccio. Ziel ist es zu zeigen, dass es keine einheitliche Vorstellung von Fortuna im Werk gibt, sondern vielmehr eine Koexistenz verschiedener Konzeptionen. Die Analyse stützt sich auf ausgewählte Novellen.
- Die Fortuna-Konzeptionen in der Antike (lateinisch und griechisch).
- Vergleich der Fortuna-Konzeption im Dekameron mit der Darstellung bei Dante in der Divina Commedia.
- Abgrenzung der Wirkungsweisen von Fortuna und Natur.
- Epochenübergreifende Betrachtung der Fortuna-Konzeptionen (Mittelalter und Neuzeit).
- Analyse ausgewählter Novellen zur Illustration der verschiedenen Fortuna-Konzeptionen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt die Bedeutung des Fortuna-Topos in der Geistesgeschichte und benennt die Forschungsfrage: die Existenz verschiedener Fortuna-Konzeptionen im Dekameron. Es wird ein Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben.
Kapitel 2.1 (Die Fortuna-Konzeption in der Antike): Dieses Kapitel unterscheidet zwischen der lateinischen und griechischen Vorstellung von Fortuna. Die lateinische Fortuna wird als glücksbringende Göttin beschrieben, während die griechische Fortuna (τύχη) als unberechenbare Schicksalsmacht dargestellt wird.
Kapitel 2.2 (Vergleich der Fortuna-Konzeption mit Dantes Divina Commedia): Hier wird die Fortuna-Konzeption im 7. Gesang des Inferno der Divina Commedia vorgestellt und mit der im Dekameron verglichen, wobei Parallelen herausgearbeitet werden. Dantes Fortuna wird als Dienerin Gottes dargestellt, die die irdischen Güter verteilt.
Schlüsselwörter
Fortuna, Boccaccio, Dekameron, Divina Commedia, Dante, Antike, Mittelalter, Neuzeit, lateinische Fortuna, griechische Fortuna (τύχη), Schicksal, Glück, Zufall, Novellenanalyse, Literaturvergleich.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Fortuna im "Dekameron" dargestellt?
Es gibt keine einheitliche Konzeption; vielmehr koexistieren verschiedene Vorstellungen von einer göttlichen Dienerin bis zur unberechenbaren Schicksalsmacht.
Was ist der Unterschied zwischen der griechischen und lateinischen Fortuna?
Die lateinische Fortuna ist oft glücksbringend, während die griechische Tyche eher als zwielichtige, unberechenbare Instanz gilt.
Wie unterscheidet sich Boccaccios Fortuna von der Dantes?
Dante stellt Fortuna im 7. Inferno-Gesang ganz in den Dienst Gottes als Verwalterin irdischer Güter, was Boccaccio teilweise übernimmt.
Was ist das Verhältnis zwischen Fortuna und Natur?
Beide werden als "ministre del mondo" (Dienerinnen der Welt) bezeichnet, wirken aber oft gegensätzlich auf das Schicksal der Menschen ein.
In welchen Novellen wird Fortuna besonders thematisiert?
Besonders die zweite Novelle des sechsten Tages und die dritte Novelle des zweiten Tages dienen als Analysebeispiele.
- Quote paper
- Nina Wiegand (Author), 2011, Zur Fortuna-Konzeption im Dekameron, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187445