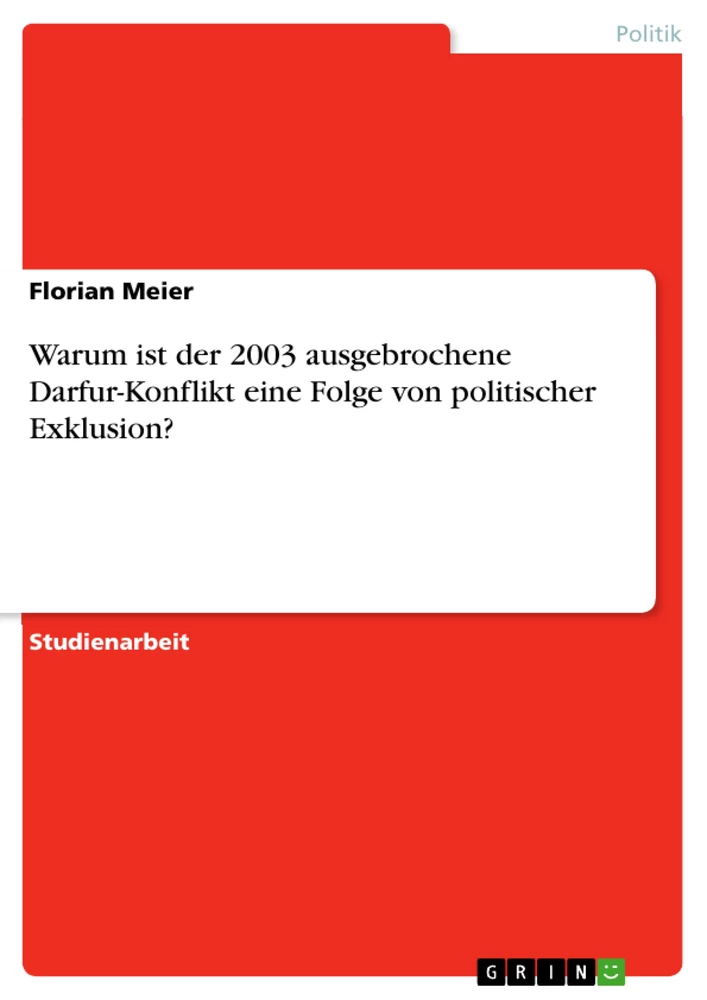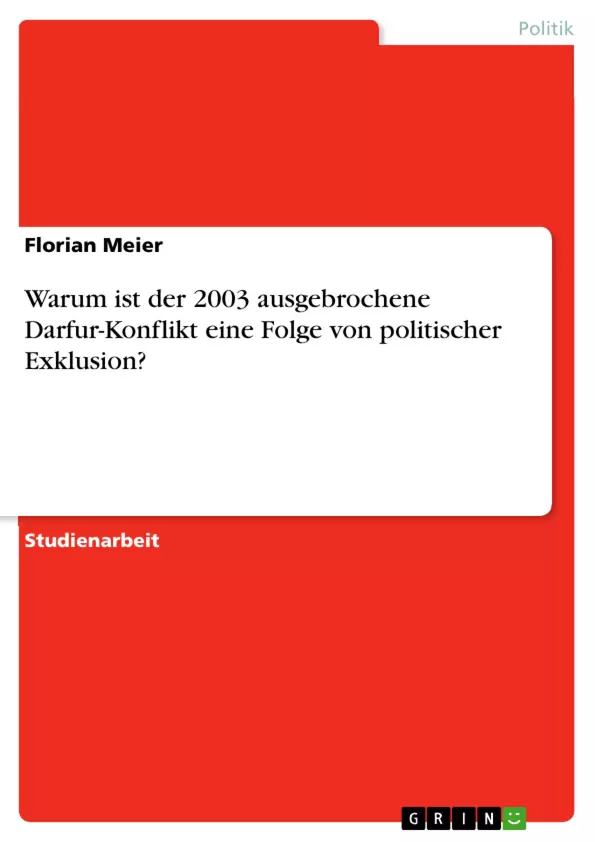Der Darfur-Konflikt ist im Frühjahr 2003 international in das Blickfeld der Medien geraten. Als Beginn der Auseinandersetzungen wird oftmals der Überfall von Rebellenorganisationen auf den Militärflughafen Al-Fashir im April 2003 genannt (vgl. Khalafalla 2005: 44, vgl. Agence France Presse 2003a). Andere Berichte sehen mit der Besetzung der Stadt Gulu durch die Rebellenorgansation „Darfur Liberation Front“ im Februar 2003 bereits den Startpunkt des Konfliktes (vgl. www.rp-online.de 2009, Agence France Presse 2003b).
[...] Folgend wird gezeigt werden, dass die Hauptursache des Darfur-Konflikts in der anhaltenden politischen Exklusion bestimmter ethnischer Gruppen der Region von der Regierungsmacht liegt. Dies wird anhand der Theorie des „Ethno-Nationalismus“ von Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer und Brian Min dargelegt werden, die sie aus dem „Ethnic-Power-Relations-Datensatz“ entwickelt haben.
Unter Ethnizität selbst verstehen die Autoren dabei jede Art von subjektiv wahrgenommener Gemeinschaft, die auf dem Glauben einer geteilten Kultur und Herkunft basiert, wie eine gemeinsame Sprache, gleiche phänotypische Eigenschaften, gemeinsames Schicksal, etc. (vgl. Cederman et al. 2010: 98, bez. auf. Weber 1978: 385-398).
Die folgend vorgestellte Theorie des „Ethno-Nationalismus“ wurde auf Grundlage von Aggregatdaten von 124 ethnischen Konflikten zwischen 1946 und 2005 entwickelt (Cederman et al. 2010: 101). Andere Erklärungsansätze und Daten sind nach Ansicht der Autoren aufgrund verschiedener Umstände kritikwürdig. Diese Kritik wird im nächsten Gliederungsabschnitt kurz zusammengefasst dargelegt, bevor sich dann das eigentliche theoretische Konstrukt anschließt. Relevant für die Anwendung auf den Darfur-Konflikt sind dabei insbesondere die von Cederman et al. entwickelten Hypothesen des „Ethno-Nationalismus“.
In der eigentlichen Analyse des Konflikts wird dann geprüft, ob die Vermutungen der Forscher auch in diesem Einzelfall zutreffen, beziehungsweise ob die Theorie von Cederman als Erklärungsmuster insgesamt dienen kann oder nicht. Das Forschungsdesign ist darauf ausgerichtet, die in der Theorie von den Autoren angenommenen Kausalitäten in Form von „Process Tracing“ zu analysieren. Am Ende wird dann nochmal ein zusammenfassendes Fazit gezogen, inwieweit die Theorie des „Ethno-Nationalismus“ im Falle des Darfur-Konflikts eine gute Erklärungsgrundlage bietet oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie des „Ethno-Nationalismus“ nach Cederman et al.
- Die Grundlagen des „Ethno-Nationalismus“
- Die Hypothesen des „Ethnischen Nationalismus“
- Der Darfur-Konflikt in der Analyse
- „Included and Excluded Groups“ und ihre geographische Verbreitung im Sudan
- Testung der Hypothesen zur Motivation der marginalisierten Bevölkerung im Darfur-Konflikt
- Testung der Hypothese zum Mobilisierungspotenzial der Rebellenorganisationen im Darfur-Konflikt
- Testung der Hypothese zur Konfliktvergangenheit im Sudan und der Darfur-Region
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hauptursachen des Darfur-Konflikts, der im Frühjahr 2003 begann. Die zentrale These ist, dass anhaltende politische Exklusion bestimmter ethnischer Gruppen die Hauptursache des Konflikts darstellt. Dies wird anhand der Theorie des „Ethno-Nationalismus“ von Cederman et al. analysiert.
- Politische Exklusion ethnischer Gruppen im Sudan
- Anwendung der „Ethno-Nationalismus“-Theorie auf den Darfur-Konflikt
- Analyse der Motivation marginalisierter Bevölkerungsgruppen
- Rolle der Rebellenorganisationen
- Bedeutung der Konfliktvergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt den Darfur-Konflikt vor, skizziert den Kontext des internationalen Haftbefehls gegen Omar al-Bashir und hebt die Bedeutung langfristiger Ursachen für den Konflikt hervor. Der Fokus liegt auf der politischen Exklusion als Hauptursache.
Kapitel 2 (Theorie des „Ethno-Nationalismus“): Dieses Kapitel präsentiert die Theorie des „Ethno-Nationalismus“ von Cederman et al., kritisiert bestehende Erklärungsansätze und definiert zentrale Begriffe wie „Included Groups“ und „Excluded Groups“.
Kapitel 3 (Der Darfur-Konflikt in der Analyse): Dieses Kapitel analysiert den Darfur-Konflikt anhand der zuvor vorgestellten Theorie. Es untersucht die geographische Verteilung von „Included“ und „Excluded Groups“, die Motivation der marginalisierten Bevölkerung und das Mobilisierungspotenzial der Rebellenorganisationen. Die Rolle der Konfliktvergangenheit wird ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Darfur-Konflikt, Ethno-Nationalismus, Politische Exklusion, „Included Groups“, „Excluded Groups“, Cederman et al., Sudan, ethnische Konflikte, Bürgerkrieg, Rebellenorganisationen, marginalisierte Bevölkerung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptursache des Darfur-Konflikts laut dieser Arbeit?
Die Hauptursache liegt in der anhaltenden politischen Exklusion (Ausschluss) bestimmter ethnischer Gruppen der Region von der zentralen Regierungsmacht.
Welche Theorie wird zur Erklärung des Konflikts herangezogen?
Die Arbeit verwendet die Theorie des „Ethno-Nationalismus“ von Cederman, Wimmer und Min, die auf dem „Ethnic-Power-Relations-Datensatz“ basiert.
Wann begann der Darfur-Konflikt offiziell?
Obwohl oft der April 2003 (Überfall auf Al-Fashir) genannt wird, sehen andere Berichte bereits im Februar 2003 mit der Besetzung von Gulu den Startpunkt.
Was versteht die Theorie unter "Ethnizität"?
Ethnizität wird als subjektiv wahrgenommene Gemeinschaft definiert, die auf dem Glauben an eine geteilte Kultur, Herkunft, Sprache oder phänotypische Merkmale basiert.
Welche Rolle spielen Rebellenorganisationen in der Analyse?
Die Arbeit testet Hypothesen zum Mobilisierungspotenzial dieser Organisationen und untersucht, wie sie die marginalisierte Bevölkerung für den bewaffneten Konflikt gewinnen konnten.
Was ist "Process Tracing" in diesem Forschungsdesign?
Process Tracing ist eine Methode, um die in der Theorie angenommenen Kausalitäten im konkreten Einzelfall des Darfur-Konflikts Schritt für Schritt nachzuvollziehen.
- Quote paper
- Florian Meier (Author), 2011, Warum ist der 2003 ausgebrochene Darfur-Konflikt eine Folge von politischer Exklusion?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187528