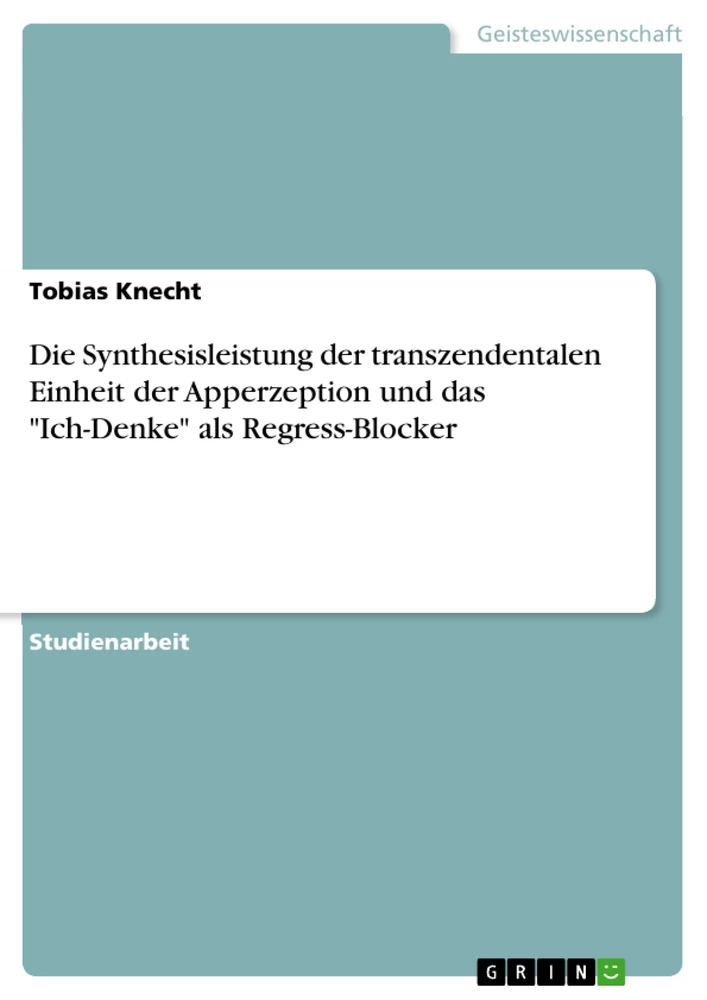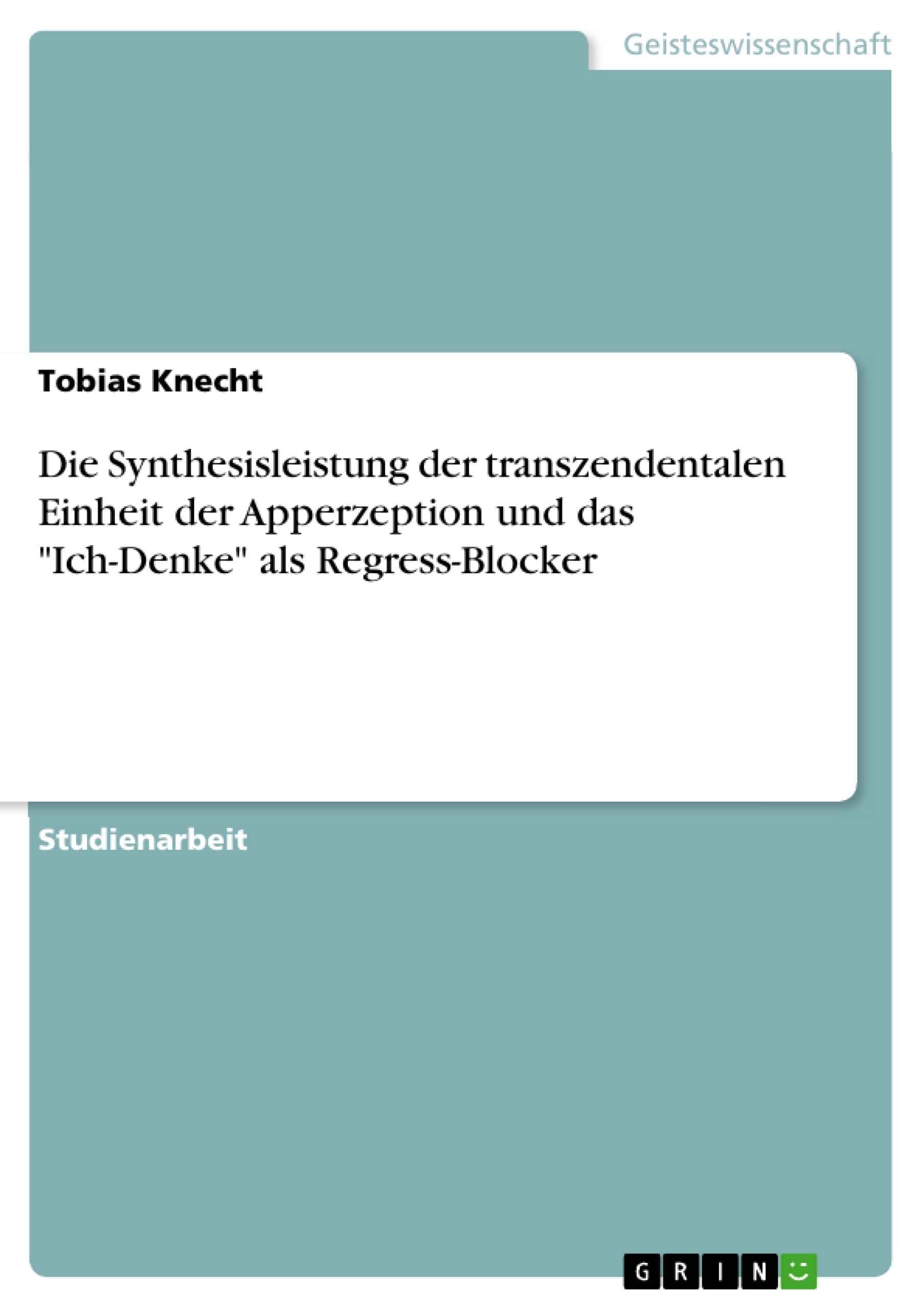Die vorliegende Seminararbeit knüpft zunächst an der von Kant in der „Kritik der reinen Vernunft“ gestellten Aufgabe an, „die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis unabhängig der Erfahrung“ aufzusuchen, um in einen weiteren Schritt die Metaphysik als Wissenschaft zu begründen.
Dabei wird vorab mit Hilfe der von Kant aufgestellten, Kopernikanischen Wende erörtert, dass die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis im Subjekt gesucht werden müssen.
Anschließend soll aufgezeigt werden, dass Erkenntnis durch das
Vermögen der produktiven Einbildungskraft zustande kommt. Im Einzelnen soll die Einbildungskraft als jenes Vermögen herausgearbeitet werden, welches zwischen Sinnlichkeit und Verstand vermittelt, indem die gegebenen Vorstellungen der Sinnlichkeit mit Hilfe der Verstandesbegriffe verbunden werden.
Die Leistung der produktiven Einbildungskraft das Mannigfaltige der Sinnlichkeit dem Verstande beizufügen, um daraus eine Erkenntnis zu formen, wird darauf folgend unter dem von Kant gebrauchten Begriff der Synthesis zusammengefasst.
Im nächsten Schritt dieser Arbeit soll mit Hilfe der transzendentalen Deduktion der Ursprung der Verstandsbegriffe, der Kategorien, aufgezeigt werden.
In der Deduktion arbeitet Kant heraus, dass der Ausgangspunkt der Verstandsbegriffe in einem obersten und ursprünglichen Prinzip liegen muss, auf dem alle Art empirischer und kategorialer Synthesis(-leistung) aufbaut.
Da jene Ursprungsform der Einheit der kategorialen Form, somit einem a priori, vorausgeht, kann sie folglich nur eine höher liegende Einheitsstufe im Subjekt sein, sie muss laut Kant eine transzendentale Form einnehmen.
Nachfolgend wird erläutert, dass Kant die letzte Quelle allen Verbindens in die transzendentale Einheit der Apperzeption, respektive das Selbstbewusstsein, legt.
Es ist laut Kant das so genannte „Ich-denke“, welches das oberste und ursprünglichste Prinzip darstellt, auf dem sowohl die Vielfalt der sinnlichen Anschauungen und Begriffe als auch die Kategorien stützen. Das „Ich-denke“ stellt daher eine konstante Vorstellung dar, die nicht weiter zurückgeführt werden kann.
Jenes „Ich denke“ kann abschließend als das oben beschriebene Bewusstsein C herausgestellt werden, welches als ein externer transzendentaler Vereiniger fungiert und die Kraft der Selbstbestimmung besitzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Verbindung der Vielfalt von Vorstellungen durch Synthesis
- Die transzendentale Deduktion und die synthetische Einheit der Apperzeption
- Das Ich-Denke als Regress-Blocker
- Das verbindende Prinzip liegt im Sachverhalt
- Das verbindende Prinzip ist der Sachverhalt selbst
- Das verbindende Prinzip liegt außerhalb des Sachverhaltes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht Kants Kritik der reinen Vernunft und zielt darauf ab, Kants Erkenntnistheorie zu beleuchten und seine Antwort auf die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Wissen zu verstehen. Die Arbeit verfolgt den von Kant eingeschlagenen Weg zwischen Rationalismus und Empirismus.
- Kants kopernikanische Wende in der Metaphysik
- Die Rolle der Synthesis und der Einbildungskraft bei der Erkenntnisbildung
- Die transzendentale Deduktion und die Einheit der Apperzeption
- Das „Ich denke“ als Regress-Blocker
- Die Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt Kants grundlegendes philosophisches Problem vor: die Auseinandersetzung in der Metaphysik und die Schwierigkeit, die durch die Natur der Vernunft aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Kants Ziel, eine umfassende Kritik des menschlichen Erkenntnisvermögens zu erstellen, wird vorgestellt, sowie sein Ansatz, der zwischen Rationalismus und Empirismus vermittelt.
Kapitel 2 (Die Verbindung der Vielfalt von Vorstellungen durch Synthesis): Dieses Kapitel beschreibt Kants Ansatz, der von der sinnlichen Erfahrung ausgeht, aber zusätzlich eine nicht-sinnliche Struktur des Geistes postuliert. Die Rolle der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Einbildungskraft bei der Erkenntnisbildung wird erläutert, mit besonderem Fokus auf der Syntheseleistung der Einbildungskraft, die verschiedene Sinneseindrücke zu einer Erkenntnis verbindet.
Kapitel 3 (Die transzendentale Deduktion und die synthetische Einheit der Apperzeption): Eine kurze Erklärung der transzendentalen Deduktion und der Einheit der Apperzeption wird gegeben. (Details werden hier ausgelassen, um den Umfang des Vorschautextes zu begrenzen.)
Kapitel 4 (Das Ich-Denke als Regress-Blocker): Dieses Kapitel befasst sich mit dem „Ich denke“-Gedanken bei Kant und seiner Funktion als Regress-Blocker. Die verschiedenen Aspekte des verbindenden Prinzips werden diskutiert, jedoch ohne detaillierte Ausführungen.
Schlüsselwörter
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Transzendentale Ästhetik, Transzendentale Logik, Erkenntnistheorie, Rationalismus, Empirismus, Synthetische Einheit der Apperzeption, Kategorien, Einbildungskraft, Synthesis, „Ich denke“, Erscheinung, Ding an sich, a priori, a posteriori.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Kants "kopernikanische Wende"?
Kant postuliert, dass sich die Erkenntnis nicht nach den Gegenständen richtet, sondern dass sich die Gegenstände nach den Bedingungen unseres Erkenntnisvermögens im Subjekt richten müssen.
Welche Funktion hat die produktive Einbildungskraft?
Sie vermittelt zwischen Sinnlichkeit und Verstand, indem sie das Mannigfaltige der Anschauung mit den Verstandesbegriffen (Kategorien) verbindet.
Was bedeutet die "transzendentale Einheit der Apperzeption"?
Es ist das ursprüngliche Prinzip des Selbstbewusstseins, das alle Vorstellungen begleiten muss ("Ich denke"), damit sie eine Einheit der Erkenntnis bilden können.
Warum wird das "Ich denke" als Regress-Blocker bezeichnet?
Das "Ich denke" ist ein letzter, nicht weiter zurückführbarer Ursprung allen Verbindens, der verhindert, dass die Suche nach der Bedingung der Erkenntnis ins Unendliche läuft.
Was unterscheidet Erscheinung vom Ding an sich?
Erscheinungen sind die Gegenstände, wie sie uns durch unsere Erkenntnisformen (Raum, Zeit, Kategorien) gegeben sind, während das Ding an sich unabhängig von unserer Wahrnehmung existiert und unerkennbar bleibt.
- Citar trabajo
- Tobias Knecht (Autor), 2011, Die Synthesisleistung der transzendentalen Einheit der Apperzeption und das "Ich-Denke" als Regress-Blocker, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187562