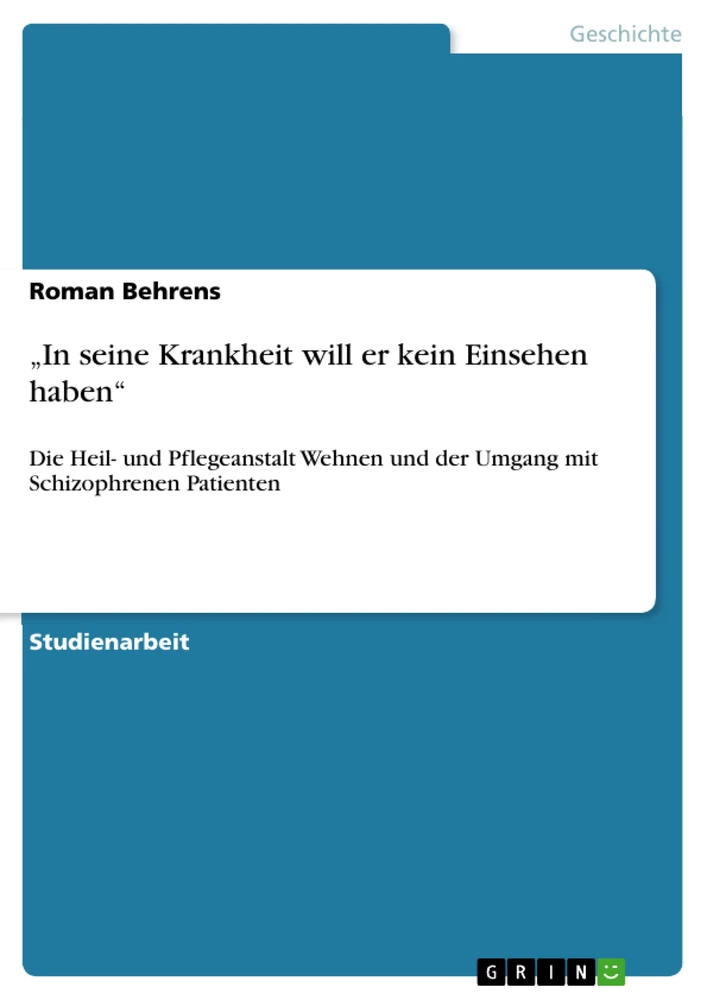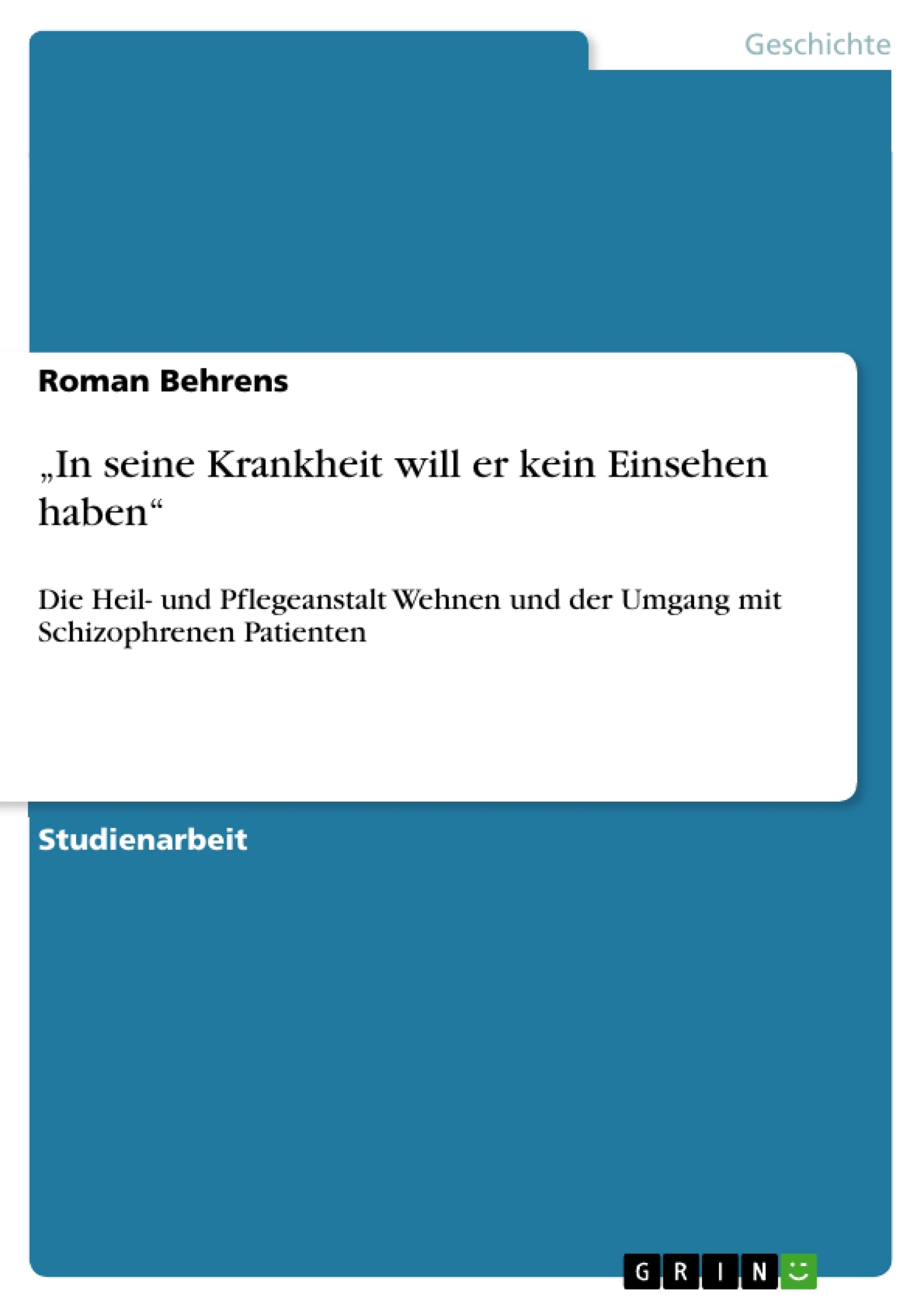In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die Ursprünge und die Entstehungsgeschichte der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen kurz darzustellen, um dann die Rolle der Klinik während der nationalsozialistischen Epoche zu untersuchen. Dies soll dazu dienen, die Rolle der Anstalt Wehnen auch chronologisch transparent darzustellen und mögliche bewährte Handlungsmuster hinsichtlich der Disziplinierung aufzuzeigen. Im dritten Kapitel erfolgt eine kurze biografische Einleitung und die Darstellung des stationären Aufenthalts sowie des Todes des Patienten Hermann I., woraus sich Erkenntnisse hinsichtlich des Umgangs mit schizophrenen Patienten
und die ärztliche Disziplinierung derselben in Wehnen ableiten lassen, die schließlich im vierten Kapitel untersucht werden sollen. Auch wird kurz und kontextualisierend auf die Rolle der nationalsozialistischen Landespolitik und der Oldenburger Landesbehörden hinsichtlich der Krankenmorde in Wehnen eingegangen werden, allerdings ohne eigenes Kapitel, da der Einzelfall im Zentrum dieser Arbeit steht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Heil- und Pflegeanstalt Wehnen - ein historischer Abriss
- Von der „,Irrenanstalt zu Wehnen“ - die Ursprünge
- Die Heil- und Pflegeanstalt in der nationalsozialistischen Epoche
- Der Patient Hermann I. - ein Fallbeispiel
- Vorgeschichte und Zeit bis zur stationären Aufnahme
- Das Leben in der Anstalt
- Das Sterben in der Anstalt
- Die Behandlung und ärztlich angeordnete Disziplinierung von schizophrenen Patienten in Wehnen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen und dem Umgang mit schizophrenen Patienten während der nationalsozialistischen Epoche. Sie analysiert den Umgang mit Patienten im Kontext der „Euthanasie“-Programme und beleuchtet die Rolle der Disziplinierung, der Krankheitseinsicht und der Heilung im Vergleich zur Zeit der Krankenmorde.
- Die Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen
- Die Behandlung von schizophrenen Patienten in Wehnen
- Die Rolle der Disziplinierung und der Krankheitseinsicht
- Die Auswirkungen der „Euthanasie“-Programme auf die Anstalt
- Der Fallbeispiel des Patienten Hermann I. als exemplarische Darstellung des Umgangs mit schizophrenen Patienten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar. Kapitel zwei liefert einen historischen Abriss der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen, beginnend mit den Ursprüngen bis zur nationalsozialistischen Epoche. In Kapitel drei wird der Patient Hermann I. vorgestellt und sein Leben in der Anstalt, von der stationären Aufnahme bis zum Tod, detailliert dargestellt. Kapitel vier befasst sich mit der Behandlung und Disziplinierung von schizophrenen Patienten in Wehnen. Es analysiert die angewendeten Methoden und ihre Auswirkungen auf die Patienten. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themengebiete der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen, der Behandlung von schizophrenen Patienten, der Disziplinierung von Patienten, der „Euthanasie“-Programme und dem Krankenmord. Es werden zentrale Begriffe wie Krankheitseinsicht, Wahnideen, Halluzinationen, Disziplinierungsmaßnahmen, „lebensunwertes Leben“, und die Geschichte der psychiatrischen Einrichtungen im Nationalsozialismus behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah in der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen während der NS-Zeit?
Die Anstalt war in die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programme verwickelt, bei denen Patienten durch gezielte Vernachlässigung oder Hunger getötet wurden.
Wie wurden schizophrene Patienten in Wehnen behandelt?
Die Arbeit zeigt anhand des Falls Hermann I., dass die ärztliche Behandlung oft weniger der Heilung als vielmehr der Disziplinierung der Patienten diente.
Welche Rolle spielte die „Krankheitseinsicht“?
Patienten, die keine Einsicht in ihre Krankheit zeigten oder sich den Anstaltsregeln widersetzten, wurden oft als „unheilbar“ oder „lebensunwert“ eingestuft.
Wer war für die Krankenmorde in Wehnen verantwortlich?
Neben der Anstaltsleitung spielten die Oldenburger Landesbehörden und die nationalsozialistische Landespolitik eine zentrale koordinierende Rolle.
Was war das Schicksal des Patienten Hermann I.?
Das Fallbeispiel dokumentiert seine Aufnahme, das Leben unter den Disziplinierungsmaßnahmen der Ärzte und schließlich seinen Tod in der Anstalt.
- Quote paper
- Roman Behrens (Author), 2011, „In seine Krankheit will er kein Einsehen haben“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187633