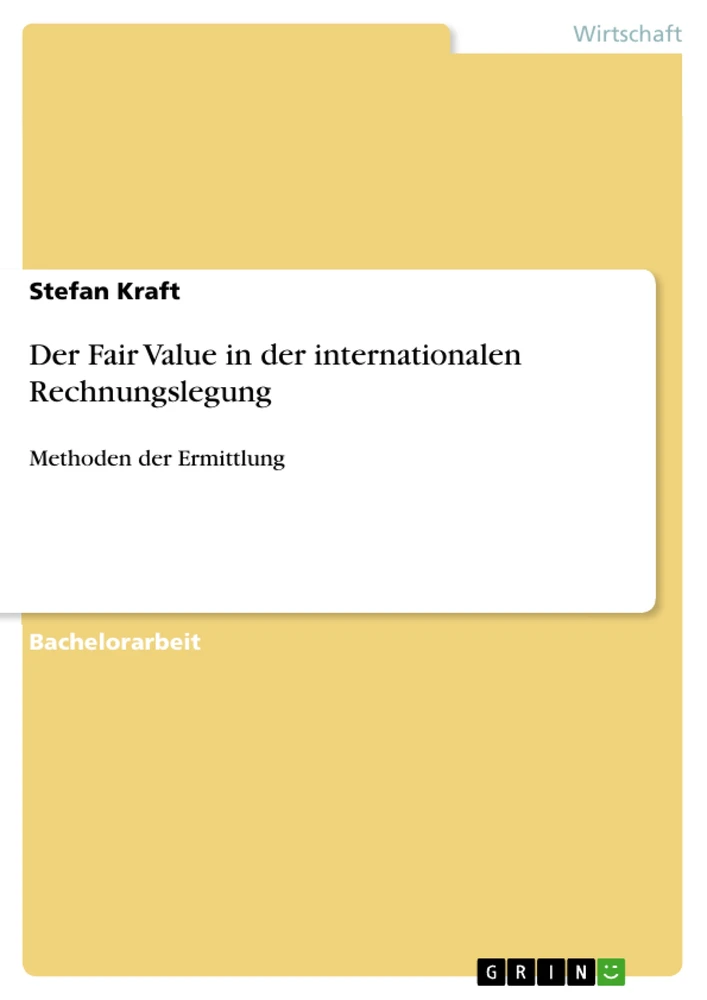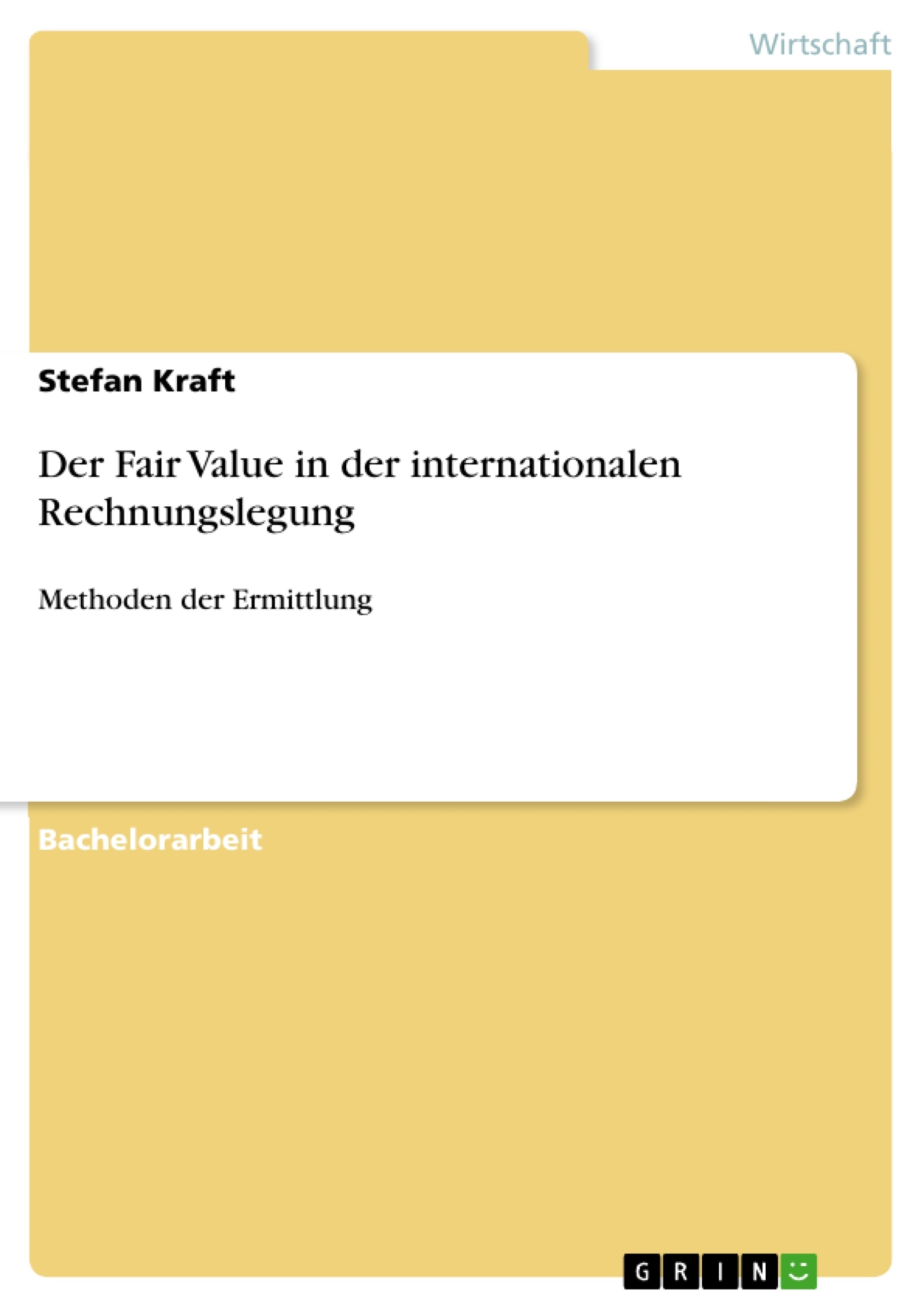Im Kontext globaler Märkte gewinnen die int. Rechnungslegungsstandards, vornehmlich IAS/IFRS und US-GAAP, zunehmend an Bedeutung. Die Gründe hierfür sind primär in der steigenden Integration der Kapitalmärkte, sowie der voranschreitenden Internationalisierung der Wirtschaft und den dadurch bedingten, veränderten Anforderungen an die Rechnungslegung zu suchen. (...)
Im Zuge dieser Entwicklung haben sich auch die Rechnungslegungsgrundsätze deutscher Unternehmen, nicht zuletzt aufgrund der 2002 erlassenen, sog. „IAS-Verordnung“, verändert. (...) Durch die soeben beschriebene Hinwendung zur int. Rechnungslegung rückt, im Gegensatz zur von Gläubigerschutz und Vorsichtsprinzip beherrschten HGB-Bilanzierung, die Informationsfunktion ins Zentrum des Interesses. Anders ausgedrückt entsteht ein zunehmendes Bedürfnis nach einem „(…)“Mehr“ an Darstellung der ökonomischen Realität(…)“. Die int. Standardsetter IASB und FASB sehen in der Neuorientierung der Bewertung am „Fair Value“ und der damit einhergehenden Abkehr von den historischen Anschaffungskosten als Bewertungsmaßstab die geeigneten Maßnahmen, um dieser Anforderung gerecht zu werden. Das Hauptargument hierfür besteht ihrer Auffassung nach darin, dass Zeitwertinformationen, im Gegensatz zu kostenbasierten Wertansätzen, eine höhere Entscheidungserheblichkeit für sich verbuchen können. (...)
Diese Orientierung hin zum FV wird in der Literatur schon jetzt oftmals als Ausdruck eines Paradigmenwechsels in der Rechnungslegung betrachtet. (...) Welch starke Bedeutung er bereits heute erlangt hat, lässt sich auch daran erkennen, dass er bereits als „Markenzeichen“ und sogar als „Hoffnungsträger“ der int. Rechnungslegung gilt. (...)
Bei aller Begeisterung für den neuen Wertmaßstab existieren jedoch auch kritische Stimmen. (...) Das Fehlen detaillierter und konsistenter Vorschriften zur Definition und Er-mittlung des FVs, seine vielfältigen Ausprägungen und die teils widersprüchlichen Einzelregelungen führen darüber hinaus zu weiterer Kritik aus Theorie und Praxis und damit zu einer anhaltenden Debatte. Angesichts dieser Problemstellungen wird die auch zukünftig steigende Bedeutung des FVs von manchen auch als „Anlaß zu großer Besorgnis“ genommen.
Innerhalb der gesamten Arbeit liegt der Fokus der Betrachtung des Fair Values auf der Sichtweise der IAS/IFRS. Weiterhin beruht die Erstellung der Arbeit auf den aktuell gültigen Standards und Regelungen mit besonderer Berücksichtigung des IFRS 13.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Begriff und Einordnung
- 2.2 Marktpreisbildungshypothese und aktiver Markt
- 3. Anwendungsfälle der Fair Value-Bewertung
- 3.1 Finanzinstrumente
- 3.2 Nicht-finanzielle Positionen
- 4. Ermittlungskonzept
- 5. Ermittlungsmethoden
- 5.1 Überblick und Bewertungsgrundsätze
- 5.2 Marktpreisorientiertes Verfahren
- 5.2.1 Fair Value als Marktpreis
- 5.2.2 Analogiemethode
- 5.3 Kapitalwertorientiertes Verfahren
- 5.3.1 Lizenzpreisanalogiemethode
- 5.3.2 Mehrgewinnmethode
- 5.3.3 Residualwertmethode
- 5.3.4 Bestimmung des Kapitalisierungszinssatzes
- 5.4 Kostenbasiertes Verfahren
- 6. Kritik an der Fair Value-Bewertung
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Fair Value in der internationalen Rechnungslegung. Ziel ist es, die Methoden zur Ermittlung des Fair Value zu analysieren und deren Anwendung in verschiedenen Kontexten zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den theoretischen Grundlagen des Fair Value, den verschiedenen Bewertungsmethoden und der Kritik an diesem Bewertungsansatz.
- Begriff und Einordnung des Fair Value
- Marktpreisbildung und aktive Märkte
- Anwendungsfälle des Fair Value in der Praxis
- Vergleichende Analyse verschiedener Ermittlungsmethoden
- Kritikpunkte und Limitationen der Fair Value-Bewertung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Thematik des Fair Value und gibt einen Überblick über die Struktur und den Aufbau der Arbeit. Es skizziert die Relevanz des Fair Value in der internationalen Rechnungslegung und benennt die zentralen Forschungsfragen.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis des Fair Value dar. Es definiert den Begriff des Fair Value präzise und ordnet ihn in den Kontext der internationalen Rechnungslegung ein. Besondere Aufmerksamkeit wird der Marktpreisbildungshypothese und dem Konzept des aktiven Marktes gewidmet, die zentrale Elemente für die Fair-Value-Bewertung darstellen. Die Diskussion dieser theoretischen Grundlagen bildet die Basis für die Analyse der verschiedenen Bewertungsmethoden in den folgenden Kapiteln.
3. Anwendungsfälle der Fair Value-Bewertung: Dieses Kapitel beleuchtet die praktischen Anwendungsfälle der Fair Value-Bewertung. Es unterscheidet zwischen finanziellen und nicht-finanziellen Positionen und zeigt auf, wie der Fair Value in diesen verschiedenen Kontexten ermittelt und angewendet wird. Die Kapitel befasst sich mit konkreten Beispielen, um die Anwendung des Konzepts zu verdeutlichen und die Herausforderungen aufzuzeigen, die sich bei der Bewertung unterschiedlicher Anlageklassen ergeben.
4. Ermittlungskonzept: Das Kapitel beschreibt das grundlegende Konzept zur Ermittlung des Fair Value. Es erläutert die hierarchische Struktur der Bewertung und die Prinzipien, die bei der Auswahl der anzuwendenden Methode zu berücksichtigen sind. Dieses Kapitel dient als Brücke zwischen den theoretischen Grundlagen und den im darauffolgenden Kapitel detailliert beschriebenen Bewertungsmethoden.
5. Ermittlungsmethoden: In diesem zentralen Kapitel werden die verschiedenen Methoden zur Ermittlung des Fair Value detailliert dargestellt und verglichen. Es werden marktpreisorientierte, kapitalwertorientierte und kostenbasierte Verfahren erläutert und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile analysiert. Die Kapitel legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Anwendung der einzelnen Methoden und die jeweiligen Herausforderungen in der Praxis. Die einzelnen Unterkapitel (5.2, 5.3, 5.4) liefern detaillierte Beschreibungen und Beispiele für die verschiedenen Methoden.
6. Kritik an der Fair Value-Bewertung: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit der Fair Value-Bewertung. Es beleuchtet die potenziellen Nachteile und Risiken, die mit der Anwendung dieses Bewertungsansatzes verbunden sind. Die Kapitel analysiert kritische Punkte wie die Subjektivität der Bewertung, die Volatilität des Fair Value und den Einfluss auf die finanzielle Berichterstattung.
Schlüsselwörter
Fair Value, Internationale Rechnungslegung, Bewertungsmethoden, Marktpreisbildung, Kapitalwert, Kostenbasierte Verfahren, Kritik, Finanzinstrumente, Nicht-finanzielle Positionen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Fair Value in der internationalen Rechnungslegung
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Fair Value in der internationalen Rechnungslegung. Sie analysiert die Methoden zur Ermittlung des Fair Value, beleuchtet deren Anwendung in verschiedenen Kontexten und diskutiert kritische Aspekte dieses Bewertungsansatzes. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, theoretische Grundlagen, Anwendungsfälle, das Ermittlungskonzept, verschiedene Ermittlungsmethoden (marktpreisorientiert, kapitalwertorientiert, kostenbasiert), eine kritische Auseinandersetzung mit dem Fair Value und ein Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: den Begriff und die Einordnung des Fair Value, die Marktpreisbildung und aktive Märkte, Anwendungsfälle des Fair Value in der Praxis, einen Vergleich verschiedener Ermittlungsmethoden und eine kritische Analyse der Limitationen der Fair Value-Bewertung.
Welche Methoden zur Fair Value-Ermittlung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert verschiedene Methoden zur Ermittlung des Fair Value, darunter marktpreisorientierte Verfahren (mit Fair Value als Marktpreis und Analogiemethode), kapitalwertorientierte Verfahren (Lizenzpreisanalogiemethode, Mehrgewinnmethode, Residualwertmethode und die Bestimmung des Kapitalisierungszinssatzes) und kostenbasierte Verfahren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einführung: Einleitung in die Thematik und Forschungsfragen. 2. Theoretische Grundlagen: Definition des Fair Value und Einordnung in die internationale Rechnungslegung, Marktpreisbildungshypothese und aktiver Markt. 3. Anwendungsfälle: Praktische Anwendung des Fair Value bei finanziellen und nicht-finanziellen Positionen. 4. Ermittlungskonzept: Grundlegendes Konzept und Prinzipien der Bewertungsmethodik. 5. Ermittlungsmethoden: Detaillierte Darstellung und Vergleich verschiedener Bewertungsmethoden. 6. Kritik: Analyse der Nachteile und Risiken des Fair Value-Ansatzes. 7. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Kritikpunkte an der Fair Value-Bewertung werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet kritische Punkte wie die Subjektivität der Bewertung, die Volatilität des Fair Value und den Einfluss auf die finanzielle Berichterstattung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere im Bereich Rechnungswesen und Finanzwirtschaft, sowie für alle, die sich mit der internationalen Rechnungslegung und dem Fair Value auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Fair Value, Internationale Rechnungslegung, Bewertungsmethoden, Marktpreisbildung, Kapitalwert, Kostenbasierte Verfahren, Kritik, Finanzinstrumente, Nicht-finanzielle Positionen.
- Citation du texte
- Stefan Kraft (Auteur), 2011, Der Fair Value in der internationalen Rechnungslegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187651