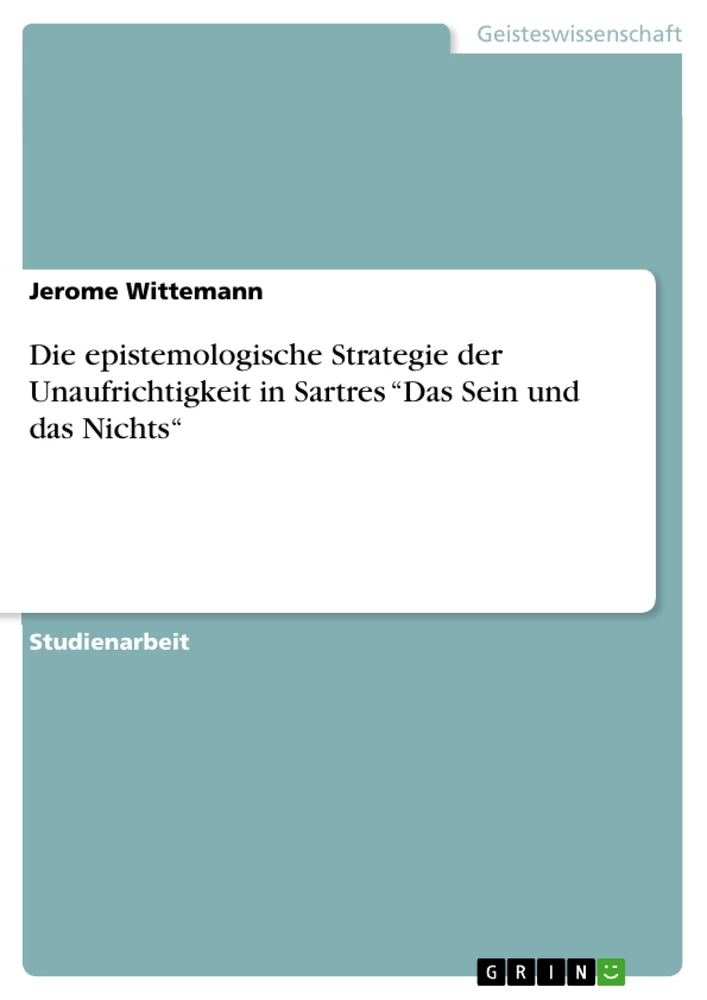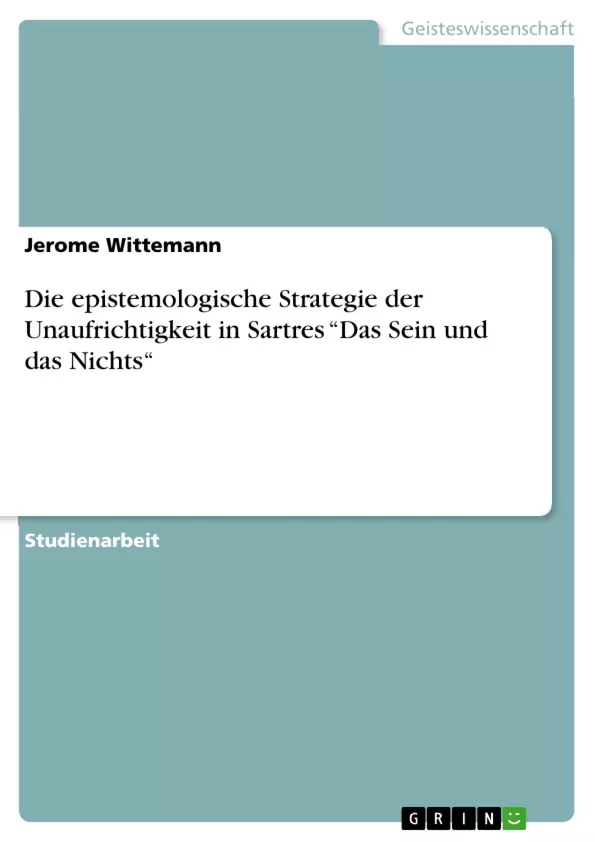Diese Arbeit soll der Frage nachgehen, inwiefern Sartres Ausführungen einer epistemologischen
Strategie der Unaufrichtigkeit eine Selbsttäuschung ermöglichen können und welche Probleme sich
daraus ergeben.
Da die Unaufrichtigkeit die menschliche Natur bzw. das Wesen des Bewusstseins als Nicht-
Koinzidenz ausnutzt, ist es zunächst notwendig, Sartres phänomenologische Bewusstseinstheorie
im Kontext seiner umfassenderen Ontologie darzulegen. Im Rahmen der sich daran anschließenden
Untersuchung der epistemologischen Unaufrichtigkeit wird im Besonderen auf die Implikationen
und Widersprüchlichkeiten eingegangen werden, die sich aus Sartres Feststellung, die
Unaufrichtigkeit könne nicht zynisch sein, ergeben. In diesem Zusammenhang soll zuletzt
aufgezeigt werden, welche konkretisierenden Annahmen für eine kohärente Argumentation
notwendig wären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sartres Bewusstseinstheorie im Kontext seiner Ontologie.
- Faktizität und Transzendenz des Menschen als Basisinstrument der Unaufrichtigkeit
- Die Unaufrichtigkeit als epistemologische Haltung..
- Der Zynismus der Unaufrichtigkeit
- Schluss....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit setzt sich zum Ziel, die epistemologische Strategie der Unaufrichtigkeit in Sartres „Das Sein und das Nichts“ zu untersuchen. Dabei wird der Fokus auf die Möglichkeit einer Selbsttäuschung durch die Unaufrichtigkeit gelegt und die sich daraus ergebenden Probleme betrachtet.
- Sartres phänomenologische Bewusstseinstheorie im Kontext seiner Ontologie
- Die Implikationen und Widersprüchlichkeiten der epistemologischen Unaufrichtigkeit
- Die Frage, ob Unaufrichtigkeit zynisch sein kann
- Notwendige Annahmen für eine kohärente Argumentation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Unaufrichtigkeit in Sartres Werk „Das Sein und das Nichts“ vor und führt in die Problematik der Interpretationen ein. Sie betont die Notwendigkeit, zwischen „ontologischer Unaufrichtigkeit“ und „epistemologischer Unaufrichtigkeit“ zu unterscheiden. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach der Möglichkeit einer Selbsttäuschung durch eine epistemologische Strategie der Unaufrichtigkeit.
- Sartres Bewusstseinstheorie im Kontext seiner Ontologie: Das Kapitel beschreibt Sartres ontologische Unterscheidung zwischen „Sein-für-sich“ (Bewusstsein) und „Sein-an-sich“ (Dinge). Es erläutert die Konzeption des „präreflexiven Bewusstseins“ und des „reflexiven Bewusstseins“ und geht auf die Selbstbewusstseinskonzeption Sartres ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die epistemologische Strategie der Unaufrichtigkeit in Sartres „Das Sein und das Nichts“, beleuchtet seine phänomenologische Bewusstseinstheorie im Kontext seiner Ontologie, analysiert die Implikationen und Widersprüchlichkeiten der Unaufrichtigkeit und untersucht die Frage, ob Unaufrichtigkeit zynisch sein kann. Zentrale Konzepte sind „Sein-für-sich“, „Sein-an-sich“, „präreflexives Bewusstsein“, „reflexives Bewusstsein“, „Unaufrichtigkeit“, „Selbsttäuschung“ und „Zynismus“.
- Arbeit zitieren
- Jerome Wittemann (Autor:in), 2011, Die epistemologische Strategie der Unaufrichtigkeit in Sartres “Das Sein und das Nichts“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187710