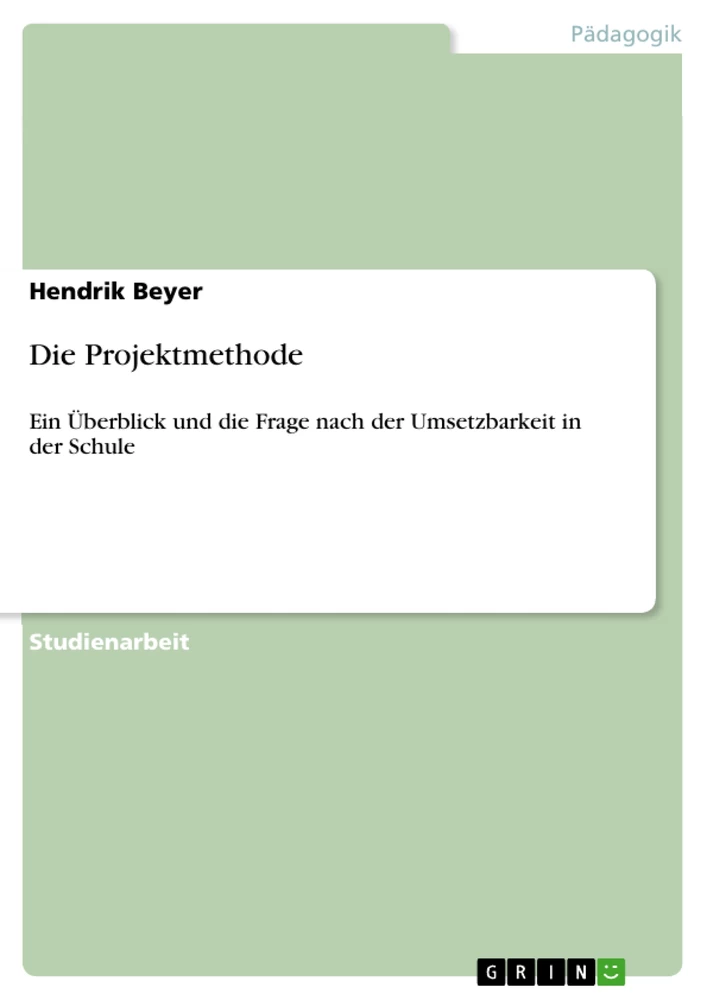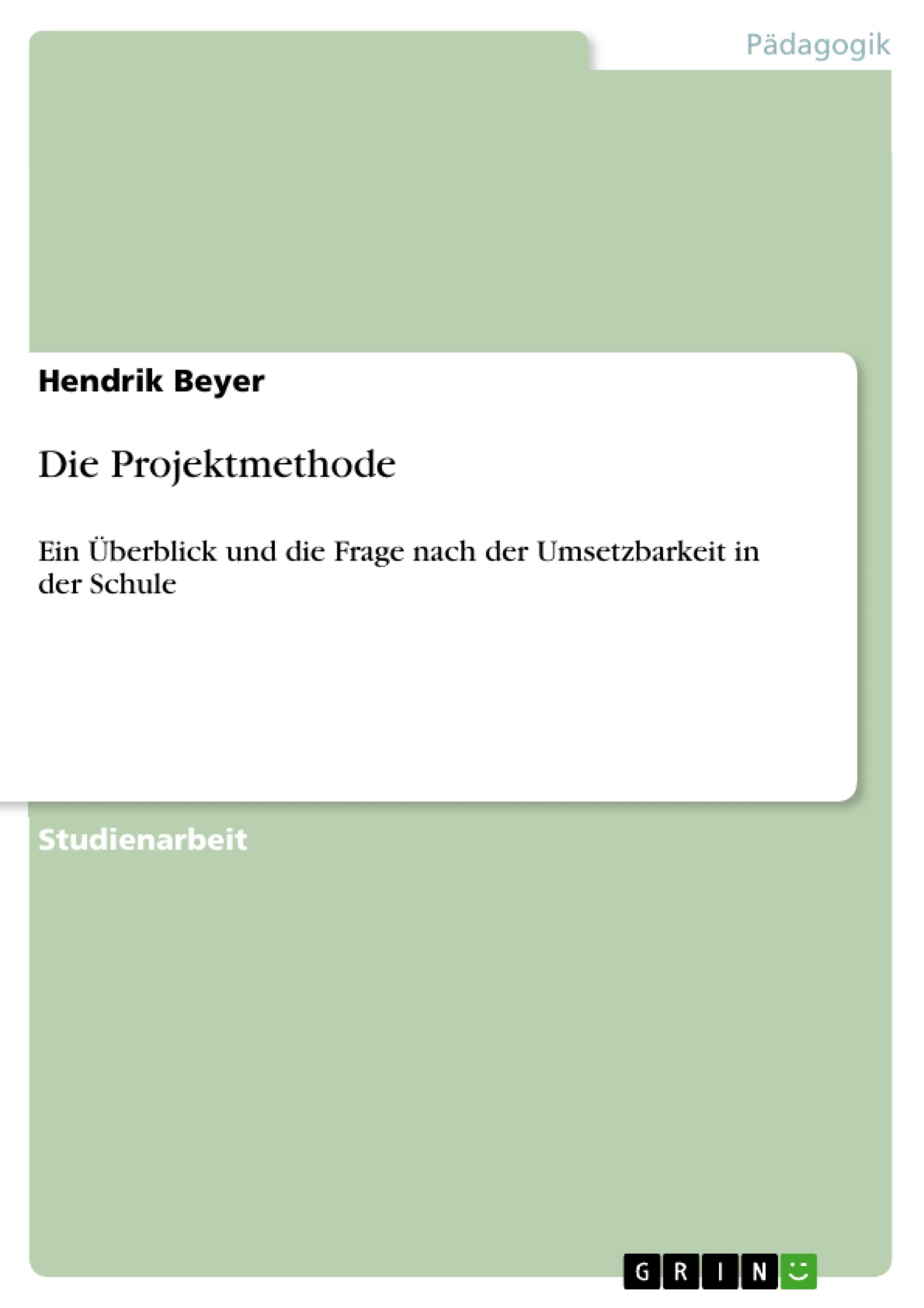Fächerübergreifendes Denken, Handeln und Unterrichten wird immer mehr gefordert und in den Curricula und Bildungsstandards verankert. Während man früher streng getrennt in den klassi-schen Fächern lernte, steht heute vor allem im Projektunterricht das fächervernetzende Denken im Vordergrund. Für den Unterrichtserfolg in der Schule stellt die Auswahl der Methode eine besonders wichtige Rolle dar. Doch was genau ist die sogenannte Projektmethode, die heute in den unterschiedlichsten Schularten angewandt wird und als Methode des modernen Unterrichtens gilt? Zunächst soll daher ein kurzer Definitionsversuch unternommen werden, der sich jedoch äußerst schwierig gestaltet. Wie Knoll 1993 angesichts seiner umfangreichen Studien zur Ge-schichte des Projektbegriffs treffend anmerkt, wird der Begriff oft „unpräszis, ausufernd und in-flationär“ gebraucht. Daher erscheint es notwendig, im Anschluss einen kurzen Blick auf die His-torie dieser Methode und ihre Entwicklung zu werfen. Anschließend werden die Projektkriterien sowie die methodischen Merkmale des Konzepts aus-führlich dargestellt, wie sie heute vor allem von Herbert Gudjons und Karl Frey postuliert wer-den. Daran schließt sich die Erläuterung der Komponenten der Projektmethode nach Frey an, die das Projekt in ein hierarchisches Phasenmodell untergliedern und so leicht nachvollziehbar ma-chen. Die genaue Darlegung dieser Kriterienkataloge erscheint angesichts der benannten Schwie-rigkeiten bei der Definition unabdingbar, um dennoch einen ausreichenden Überblick über das Thema zu erhalten. Des weiteren soll dann die Umsetzbarkeit der Projektidee im schulischen Projektunterricht kritisch beleuchtet und Probleme aufgezeigt werden. Dabei soll unter anderem aufgedeckt werden, dass Projektwochen oftmals den Grundgedanken der Projektmethode verfeh-len. Abschließend sollen die gewonnenen Erkenntnisse bewertet und die Projektmethode im Be-zug auf ihre Anwendbarkeit in der Schule und qualifiziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionsversuche
- Historisches
- Projektkriterien und methodische Merkmale
- Situationsbezug
- Orientierung an den Interessen der Beteiligten
- Gesellschaftliche Praxisrelevanz
- Zielgerichtete Projektplanung
- Selbstorganisation und Selbstverantwortung
- Einbeziehung vieler Sinne
- Soziales Lernen
- Produkt- und Ergebnisorientierung
- Interdisziplinarität
- Grenzen des Projektunterrichts
- Komponenten der Projektmethode
- Projektinitiative
- Auseinandersetzung mit der Projektinitiative
- Gemeinsame Entwicklung des Betätigungsgebiets
- Projektdurchführung
- Abschluss des Projekts
- Fixpunkte
- Metainteraktion
- Probleme des Projektunterrichts
- Institutionelle Rahmenbedingungen
- Veränderte Rolle von Lehrer- und Schüler
- Methodische Probleme (speziell in der Projektwoche)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Projektmethode als eine moderne Unterrichtsform und beleuchtet ihre Umsetzbarkeit in der Schule. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung der Methode, erläutert ihre methodischen Merkmale und Komponenten und diskutiert schließlich die Herausforderungen ihrer Anwendung im schulischen Kontext.
- Definition und Geschichte der Projektmethode
- Projektkriterien und methodische Merkmale
- Komponenten der Projektmethode und ihre Phasen
- Probleme der Umsetzung im schulischen Kontext
- Bewertung der Anwendbarkeit und Qualifizierung der Projektmethode
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Projektmethode vor und führt in die Problematik ihrer Definition und historischen Entwicklung ein. Im zweiten Kapitel werden wichtige Projektkriterien und methodische Merkmale erläutert, die von Gudjons und Frey definiert wurden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Komponenten der Projektmethode nach Frey, die das Projekt in ein hierarchisches Phasenmodell gliedern. Das vierte Kapitel widmet sich den Problemen der Umsetzung der Projektidee im schulischen Projektunterricht.
Schlüsselwörter
Projektmethode, Projektunterricht, Projektarbeit, Projektlernen, Situationsbezug, Interessen der Beteiligten, Praxisrelevanz, Projektplanung, Selbstorganisation, Selbstverantwortung, Interdisziplinarität, Institutionelle Rahmenbedingungen, Lehrerrolle, Schülerrolle, Projektwoche.
- Citar trabajo
- Hendrik Beyer (Autor), 2011, Die Projektmethode, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187734