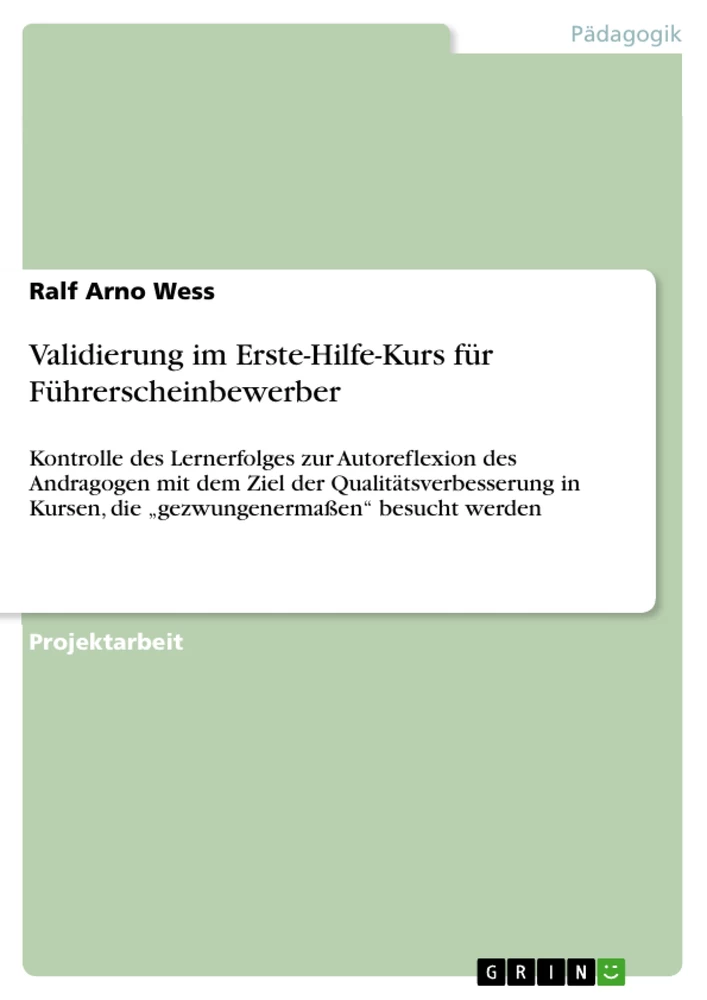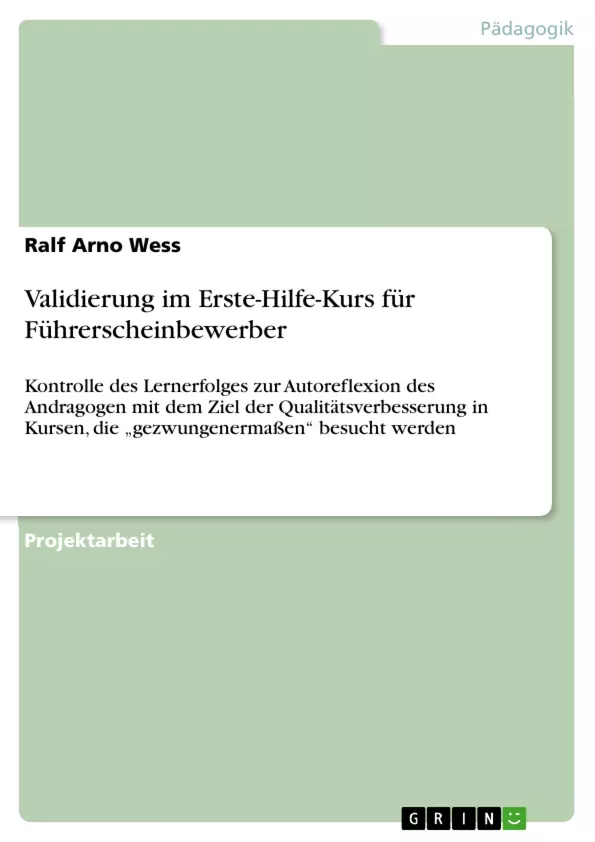Der Nachweis von Kenntnissen in Erster Hilfe ist Voraussetzung für die Zulassung zu Fahrprüfungen und damit zur Erlangung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen). Dieser Nachweis wird üblicherweise durch das Vorlegen einer Teilnahmebescheinigung an entsprechenden Kursen geführt, welche beim Regierungspräsidium der jeweiligen Landesregierung akkreditiert sind. Der Akkreditierung geht die Vorlage eines Lehrplanes durch den Ausbildungsträger voraus, von dem nicht ohne Zustimmung abgewichen werden darf. Der Spielraum des Kursleiters ist in inhaltlicher wie methodischer Hinsicht also gering. Daher bietet es sich an durch kurze Einlagen den Erfolg der Wissensaneignung durch die Teilnehmenden zu ermitteln.
Wenn das Ergebnis positiv ist, kann der entsprechende Kniff in den Lehrplan aufgenommen werden (und dann der nächste und so weiter). Das Erreichen einer positiven Einstellung zum Thema „Erste Hilfe“ muss auf jeden Fall primäres Kursziel sein. Denn kein Kurs von 16 Unterrichtseinheiten macht aus Unmotivierten tatsächlich kompetente Ersthelfer und die Halbwertszeit des Gelernten ist in der Tat erschreckend kurz. Aber Lernen ist immer ein aktiver Prozess, der nicht erzwungen werden kann. Die staatlich vorgeschriebene Konfrontation wird hier als eine Chance zur Annäherung an das Problem der Notwendigkeit zur Hilfeleistung verstanden.
Die formalen Restriktionen der Veranstaltung lassen kaum zeitlichen Raum für eine zusätzliche Feedbackrunde („Blitzlicht“ etc.). Daher wurde eine in den Kursverlauf integrierte Organisation eines feedbackfähigen Elements untersucht. Es geht um die Durchführung der geforderten praktischen Übungen „Umlagerung eines Patienten“, „Helmabnahme“ und „Herstellen einer stabilen Lagerung “. Normalerweise werden diese Tätigkeiten von den Teilnehmenden in Zweiergruppen (eine handelnde und eine das Opfer darstellende Person im Rollenwechsel) vor der gesamten (während dieser Zeit passiven oder im besten Fall zuschauenden) Gruppe prüfungshaft unter Aufsicht der Leitungsperson durchgeführt.
Alternativ wurde eine „kombinierte Übung“, in der die Teilnehmenden komplette Hilfeleistung in einem vorgestellten Beispiel durchführen, konzipiert und validiert.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Biologe Ralf Arno Wess (Autor:in), 2007, Validierung im Erste-Hilfe-Kurs für Führerscheinbewerber, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187792