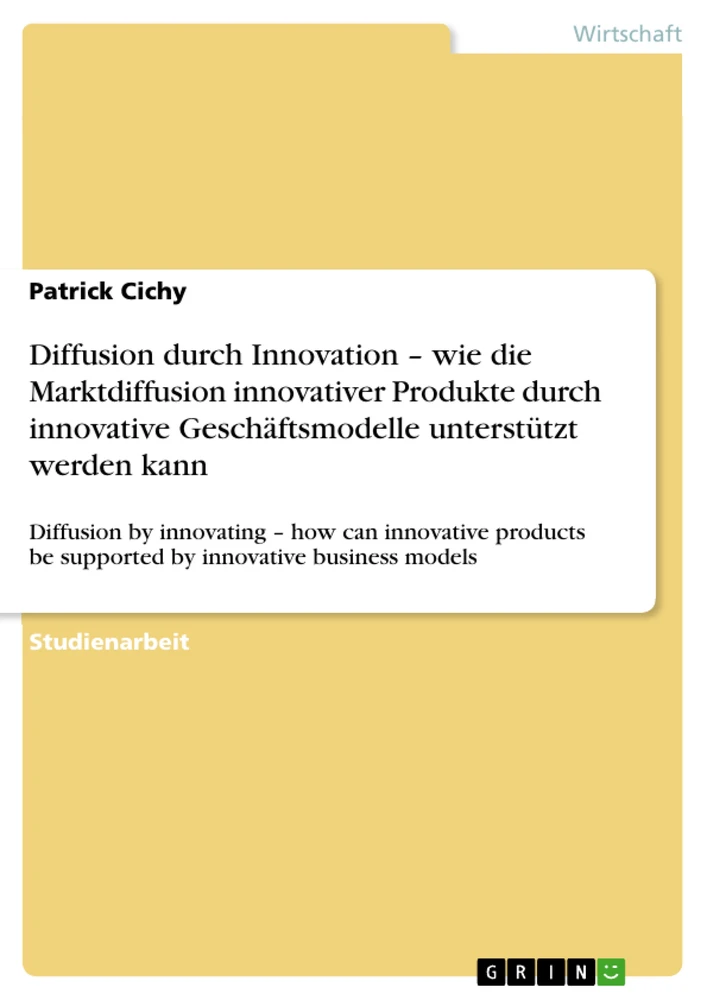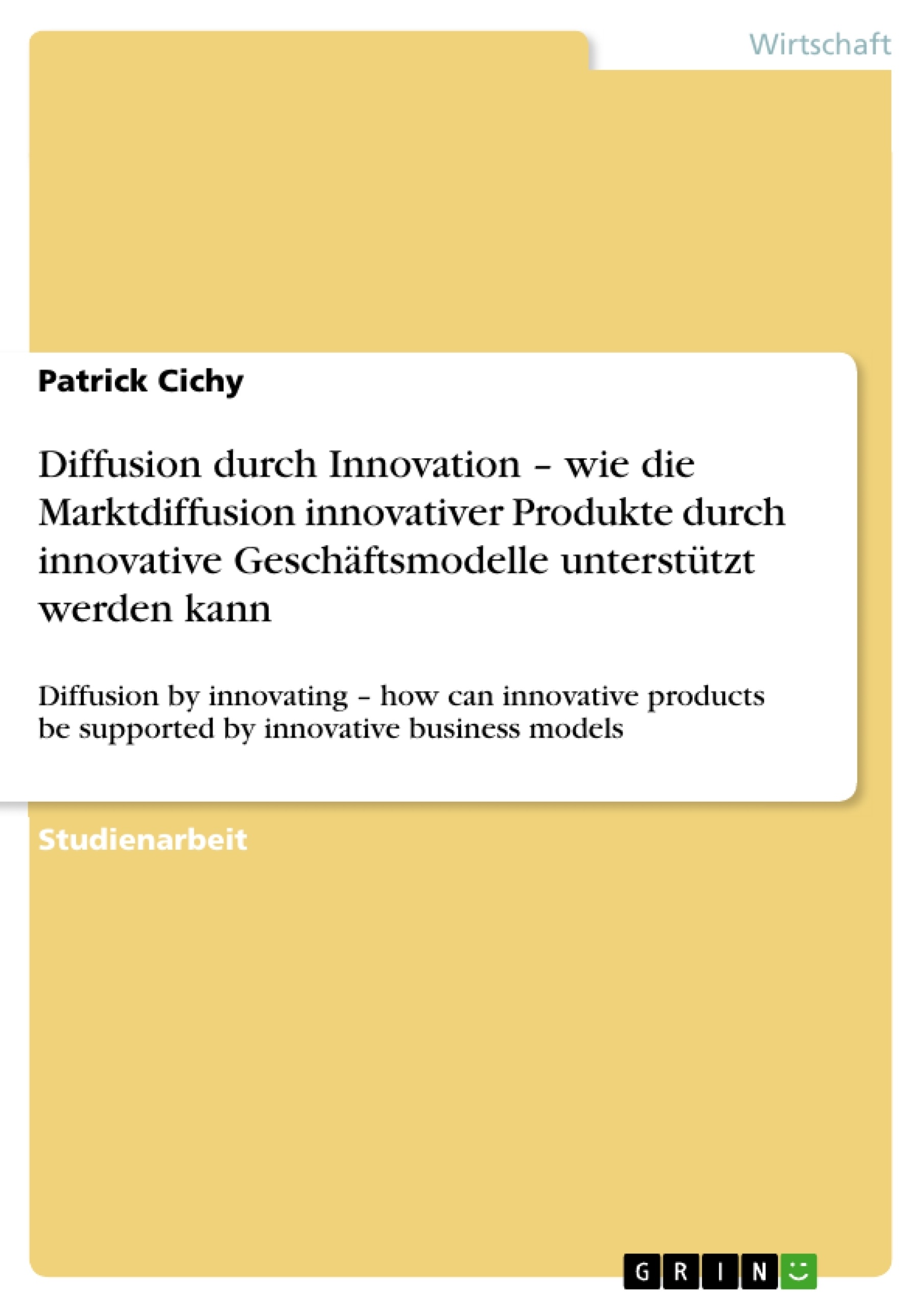„Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal“ (Bundespräsident Roman Herzog in seiner Rede „ Aufbruch ins 21. Jahrhundert“ am 26. April 1997).
So drastisch beschrieb der Bundespräsident Roman Herzog die Rolle und Wichtigkeit der Innovation.
Innovationen helfen Unternehmen dem Wettbewerb, bei zunehmender Globalisierung der Märkte, standzuhalten und langfristig erfolgreich zu sein. Den Wettbewerbsvorteil erlangen die Unternehmen dabei durch eine kurzzeitige Monopolstellung.
Ohne ein optimal ausgestaltetes Geschäftsmodell sind Innovationen allerdings zum Scheitern verurteilt. Es wird nicht möglich sein, die Nutzenstiftung der Innovation ökonomisch effizient zu verwerten.
An dieser Stelle setzt die Fragestellung dieser Seminararbeit an. Die Beantwortung dieser soll aufzeigen, wie innovative Geschäftsmodelle die Diffusion von innovativen Produkten unterstützen können. Ziel dieser Seminararbeit ist es, die Auswirkungen des Geschäftsmodells auf die Innovationsdiffusion zu analysieren und daraus Ansätze für eine optimale Ausgestaltung des Geschäftsmodells zu formulieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Innovationen
- 2.1 Definition des Begriffs Innovation
- 2.2 Innovationsbarrieren
- 2.2.1 Der Innovations-Entscheidungs-Prozess
- 2.2.2 Innovationsbarrieren auf Kundenseite
- 3. Geschäftsmodelle
- 3.1 Definition des Begriffs Geschäftsmodell
- 3.2 Abgrenzung Geschäftsmodell und Strategie
- 4. Wirkung von Geschäftsmodellen auf kundenseitige Innovationsbarrieren
- 4.1 Ausprägungen der Geschäftsmodellelemente
- 4.2 Negative Auswirkungen der Innovationsbarrieren
- 4.2.1 Wissensbarriere und Nutzenbarriere
- 4.2.2 Gebrauchsbarriere
- 4.2.3 Risikobarriere
- 4.3 Zusammenfassung der Analyseergebnisse
- 5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert, wie innovative Geschäftsmodelle die Diffusion von innovativen Produkten unterstützen können. Ziel ist es, die Auswirkungen des Geschäftsmodells auf die Innovationsdiffusion zu untersuchen und daraus Ansätze für eine optimale Ausgestaltung des Geschäftsmodells zu formulieren.
- Definition von Innovation und Innovationsbarrieren
- Analyse der Innovationsbarrieren auf Kundenseite
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Geschäftsmodell
- Auswirkungen der Ausgestaltung des Geschäftsmodells auf Innovationsbarrieren
- Formulierung von Ansätzen zur Überwindung von Innovationsbarrieren durch Geschäftsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 definiert den Begriff „Innovation“ und zeigt die Schwierigkeiten einer einheitlichen Begriffsdefinition auf. In Kapitel 2.2 werden Innovationsbarrieren, insbesondere auf Kundenseite, behandelt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs „Geschäftsmodell“. Kapitel 4 untersucht die Auswirkung der Ausgestaltung des Geschäftsmodells auf die Innovationsbarrieren und analysiert, wie diese abgebaut werden können.
Schlüsselwörter
Innovation, Innovationsbarrieren, Kundenseite, Geschäftsmodell, Innovationsdiffusion, Wettbewerbsvorteil, Monopolstellung, Nutzenstiftung, ökonomische Effizienz, Wissensbarriere, Nutzenbarriere, Gebrauchsbarriere, Risikobarriere
- Arbeit zitieren
- Patrick Cichy (Autor:in), 2011, Diffusion durch Innovation – wie die Marktdiffusion innovativer Produkte durch innovative Geschäftsmodelle unterstützt werden kann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187813