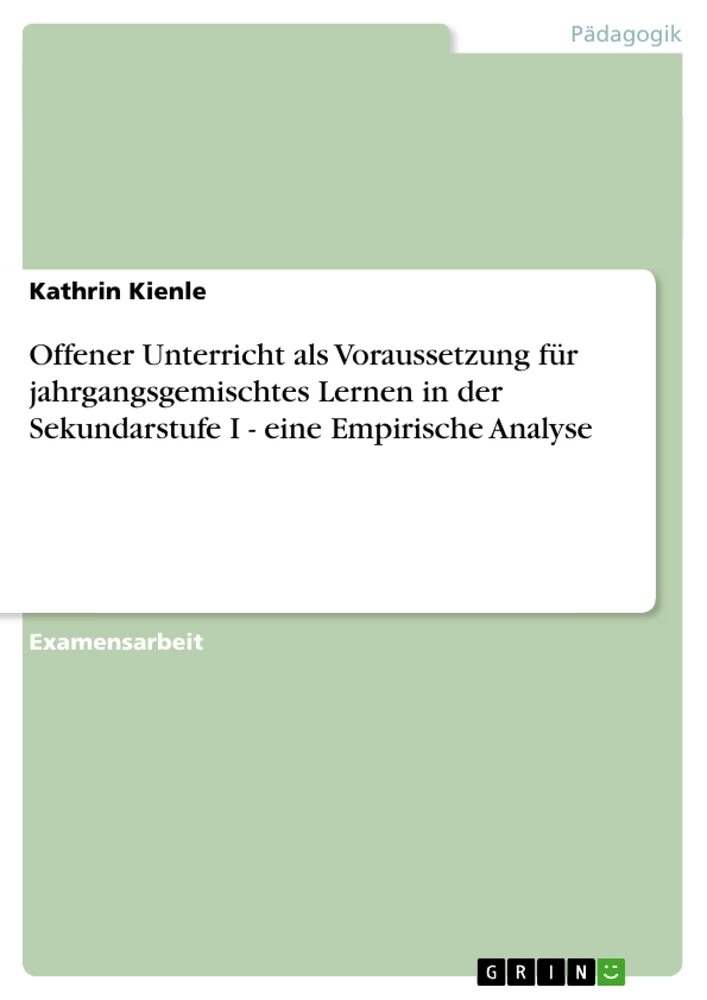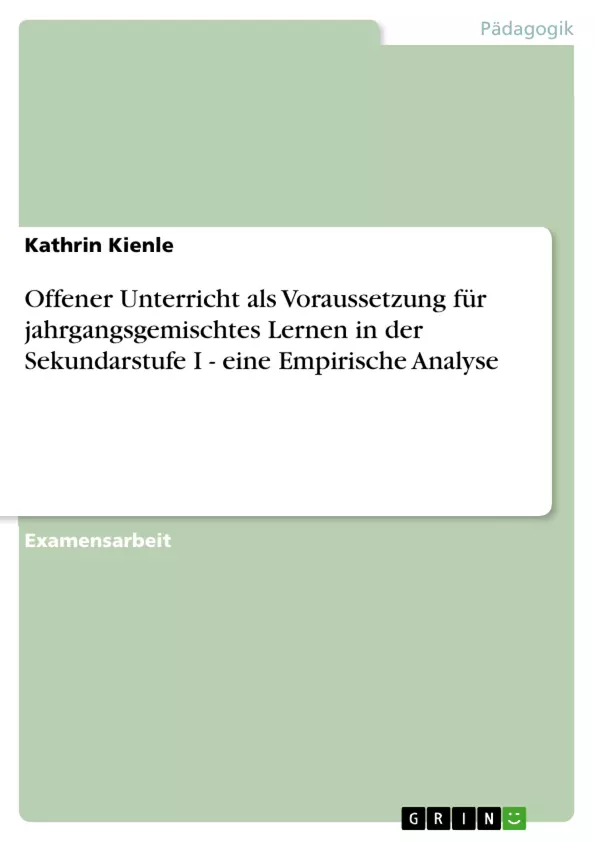Lernen in jahrgangsgemischten Klassen, eine natürliche Form der Heterogenität, ist in den letzten Jahren wieder ins Blickfeld der pädagogischen Diskussionen gerückt. Die positiven Auswirkungen hinsichtlich der sozialen Entwicklung und der Leistungsbereitschaft überzeugen. Studien zeigen, dass jahrgangsgemischt unterrichtete Schüler keine Nachteile gegenüber Schülern aus Jahrgangsklassen haben. Im Gegenteil, sie zeigen sogar leicht positivere Auswirkungen hinsichtlich des Sozialverhaltens, während in den fachlichen Bereichen keine Unterschiede festgestellt wurden.
Trotz der positiven Ausgangslage: die Kritik an der Jahrgangsmischung scheint nicht ganz unberechtigt. Ohne Offenheit im Hinblick auf das gesamte Unterrichtskonzept scheint die Jahrgangsmischung schwer umsetzbar. Weg vom lehrerzentrierten Unterricht, hin zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Aber geht bei aller Offenheit nicht die Kontrolle darüber verloren, was die Schüler wirklich lernen bzw. gelernt haben? Braucht man diese Kontrolle überhaupt? Diese Offenheit im Sinne des offenen Unterrichts ist ebenfalls wieder im Gespräch, spätestens seit Falko Peschels genauer Beschreibung seines offenen Unterrichts. Auch bei ihm geht es um das individuelle Eingehen auf die Schüler, um eine veränderte Leistungsbeurteilung und ein harmonisches soziales Miteinander. Die Frage, ob und wenn ja, inwiefern der offene Unterricht die Jahrgangsmischung unterstützen könnte, liegt nahe.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Teil
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Jahrgangsgemischtes Lernen
- Offener Unterricht
- Historischer Ursprung und Entwicklung
- Jahrgangsgemischtes Lernen
- Offener Unterricht
- Begründungszusammenhänge
- Gesellschaftliche Veränderungen
- Lerntheoretische Begründungsansätze
- Didaktische Begründungsansätze
- Voraussetzungen und Ziele jahrgangsgemischten Lernens und offener Unterricht als notwendige Basis
- Voraussetzungen
- Ziele
- Empirischer Teil
- Fragestellungen
- Untersuchungsmethodik
- Vorstellung der beteiligten Schulen/Stichproben
- Durchführung der Untersuchung
- Untersuchungsmethoden
- Ergebnisse und Diskussion
- Beobachtung
- Fragebogen Lehrer
- Fragebogen Schüler
- Diskussion im Hinblick auf die Fragestellungen
- Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen offenem Unterricht und jahrgangsgemischtem Lernen in der Sekundarstufe I. Ziel ist es, empirisch zu analysieren, ob und inwiefern offener Unterricht eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiches jahrgangsgemischtes Lernen darstellt. Die Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen und der empirischen Überprüfung dieser Zusammenhänge.
- Definitionen und historische Entwicklung von jahrgangsgemischtem Lernen und offenem Unterricht
- Begründungsansätze für jahrgangsgemischtes Lernen und offener Unterricht
- Voraussetzungen und Ziele von jahrgangsgemischtem Lernen im Kontext von offenem Unterricht
- Empirische Untersuchung an zwei Schulen mit unterschiedlichen Lernsituationen
- Analyse der Ergebnisse im Hinblick auf den Einfluss von offenem Unterricht auf jahrgangsgemischtes Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Der theoretische Teil der Arbeit beleuchtet die Begrifflichkeiten von jahrgangsgemischtem Lernen und offenem Unterricht sowie ihre historische Entwicklung. Es werden gesellschaftliche, lerntheoretische und didaktische Begründungsansätze für beide Konzepte diskutiert. Des Weiteren werden die notwendigen Voraussetzungen und Ziele für erfolgreiches jahrgangsgemischtes Lernen im Kontext von offenem Unterricht untersucht.
Im empirischen Teil werden die Fragestellungen der Untersuchung und die angewandte Methodik vorgestellt. Die Untersuchung basiert auf Beobachtungen, Fragebögen für Lehrer und Schüler sowie einer anschließenden Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellungen.
Schlüsselwörter
Jahrgangsgemischtes Lernen, offener Unterricht, Sekundarstufe I, empirische Analyse, Voraussetzungen, Ziele, Lerntheorie, Didaktik, Unterrichtsforschung, Beobachtung, Fragebögen, Schüler, Lehrer
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile von jahrgangsgemischtem Lernen?
Studien belegen positive Effekte auf das Sozialverhalten und die Leistungsbereitschaft. Schüler in gemischten Klassen haben keine fachlichen Nachteile gegenüber traditionellen Klassen.
Warum ist offener Unterricht eine Voraussetzung für Jahrgangsmischung?
Da Schüler unterschiedlichen Alters verschiedene Lernstände haben, ermöglicht nur ein offenes Konzept (weg vom Frontalunterricht) das individuelle Eingehen auf jedes Kind.
Wer ist Falko Peschel und welche Rolle spielt er hier?
Falko Peschel ist ein bekannter Pädagoge, dessen Konzepte zum offenen Unterricht als theoretische Basis für die Analyse der Jahrgangsmischung in dieser Arbeit dienen.
Geht durch offenen Unterricht die Kontrolle verloren?
Die Arbeit diskutiert die Kritik, ob Lehrer den Überblick behalten. Sie zeigt jedoch, dass durch veränderte Leistungsbeurteilung und Selbststeuerung der Lernerfolg gesichert werden kann.
Wie wurde die empirische Analyse durchgeführt?
Die Untersuchung basierte auf Beobachtungen sowie Fragebögen für Lehrer und Schüler an zwei Schulen mit unterschiedlichen Unterrichtskonzepten in der Sekundarstufe I.
- Quote paper
- Kathrin Kienle (Author), 2011, Offener Unterricht als Voraussetzung für jahrgangsgemischtes Lernen in der Sekundarstufe I - eine Empirische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187833