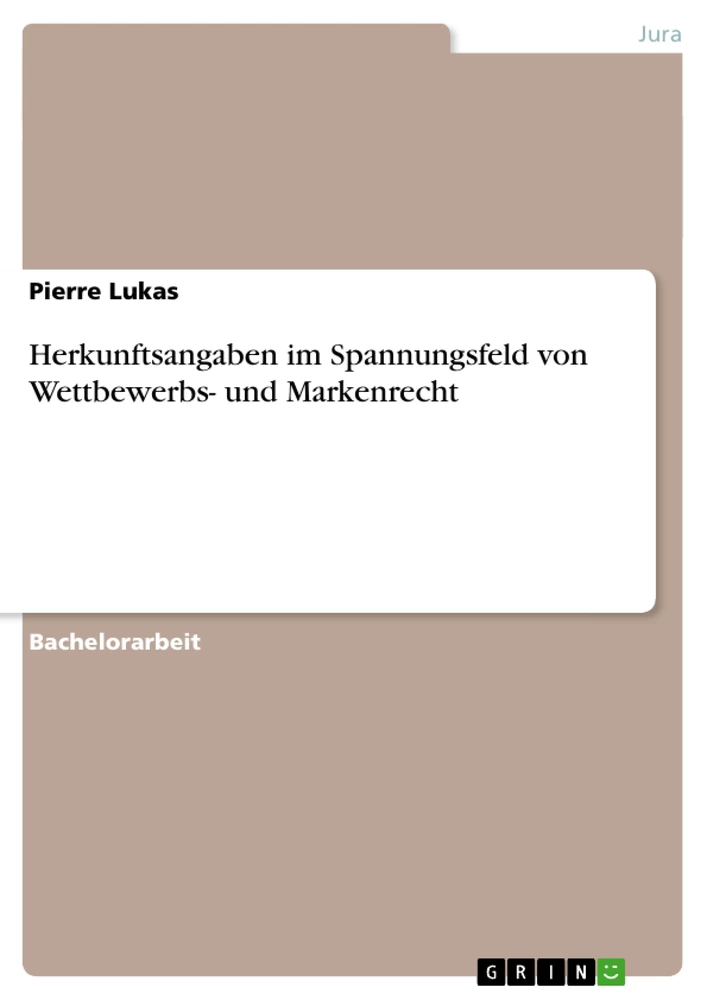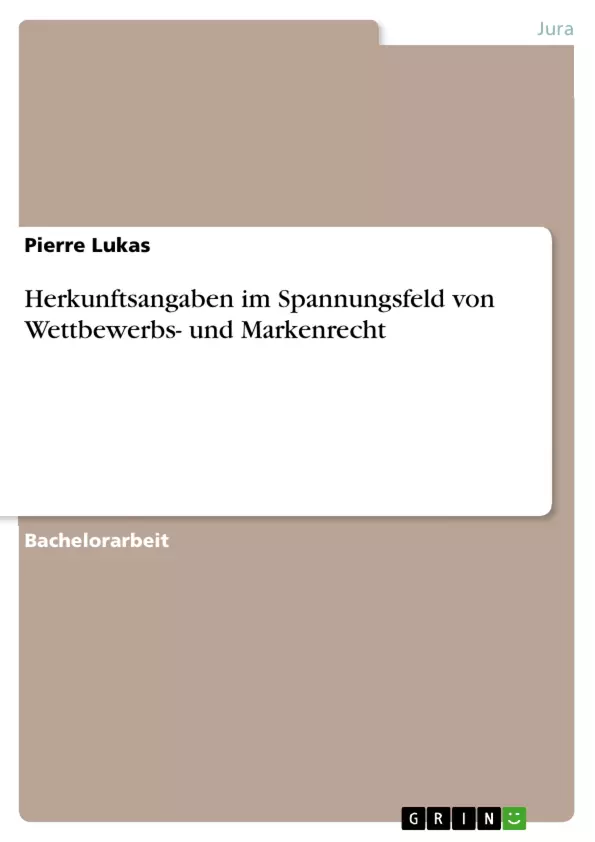Champagner, Gorgonzola, Kölnisch Wasser und die Havanna Zigarre haben eines gemeinsam. Bei diesen Produkten erweckt bereits der Name eine gewisse Erwartungshaltung bei dem potentiellen Erwerberkreis und wirtschaftliche Begehrlichkeiten bei den Mitbewerbern.
Aufgrund der, mit der zunehmenden Digitalsierung und Vernetzung einhergehenden steigenden Transparenz von Wettbewerbsinformationen und der, ebenfalls dadurch verstärkten, Nivellierung kultureller und regionaler Differenzen, können Unterscheidbarkeit und regionale Identität die entscheidenden Wettbewerbsvorteile für Unternehmen und ihre Leistungen sein.
Diesen Vorteil können sich Unternehmen mit den, eng mit Marken- und Firmennamen bzw. betrieblichen Herkunftsangaben verwobenen, geogra-phischen Herkunftsangaben dauerhaft sichern. Der Schutz solcher Angaben ist in Anbetracht der, durch die Globalisierung hervorgerufene, Qualitätsun-sicherheit des Verbrauchers von zunehmender wirtschaftlicher , politischer und juristischer Bedeutung. Für Unternehmen besteht daher ein grundlegendes Bedürfnis im Wettbewerb mit derartigen Merkmalen zu werben und sich die Nutzung gegenüber den Mitbewerbern schützen zu lassen. So gibt es auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene aktuell über 1.000 registrierte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.
Auf der anderen Seite wiederum ist es auch notwendig, den Verbraucher davor zu schützen, dass Unternehmen im Wettbewerb durch Werbung mit Herkunftsangaben ihre jeweilige Leistung mit unwahren Qualitäts- und Herkunftsattributen versehen, und darüber den Kunden in die Irre führen.
Die Bedeutung und Komplexität des Themenfeldes erschließt sich auch bei einer juristischen Betrachtungsweise anhand der umfangreichen Juris-diktion des EuGH, der in der Vergangenheit sehr häufig die Aufgabe hatte im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbs- und Markenrecht Recht zu spre-chen. Exemplarisch seien hier die Urteile „Chiemsee“, „Bayerisches Bier“ oder „Budweiser“ erwähnt.
Wenngleich in Literatur und Rechtsprechung auf nationaler und interna-tionaler Ebene bereits ein beachtlicher Bestand an Befassungen mit dem Thema festzustellen ist, so ist auch ersichtlich, dass das Spannungsfeld zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht nicht abschließend aufgelöst werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG ZUM THEMA.
- I. BEDEUTUNG.
- II. RECHTLICHE EINORDNUNG.
- III. ZIELSETZUNG UND VORGEHEN.
- B. TERMINOLOGIE
- I. ABGRENZUNG WETTBEWERBSRECHT UND MARKENRECHT
- 1. Das Wettbewerbsrecht im engeren Sinn
- 2. Das Marken- bzw. Kennzeichenrecht.
- II. GEOGRAPHISCHE HERKUNFTSANGABEN
- 1. Einfache Herkunftsangaben.
- 2. Ursprungsbezeichnungen und qualifizierte Herkunftsangaben....
- 3. Mittelbare und unmittelbare Herkunftsangaben
- 4. Gattungsbezeichnungen
- 5. Sonstige Bezeichnungen
- 6. Betriebliche Herkunftsangaben
- C. MULTILATERALE EBENE...........
- I. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE.
- II. SCHUTZRICHTUNG UND -UMFANG MULTILATERALER VERTRÄGE......
- 1. Pariser Verbandsübereinkunft..
- 2. Madrider Herkunftsabkommen.
- 3. Lissaboner Ursprungsabkommen........
- 4. TRIPS-Abkommen...
- III. VERGLEICH UND BEWERTUNG
- D. GEOGRAPHISCHE HERKUNFTSANGABEN IM EUROPARECHT..\n.
- I. ÜBERSICHT..\n.
- II. VO (EG) NR. 510/2006.......\n.
- IIII. BESTIMMUNGEN NEBEN DER VO (EG) NR. 510/2006.\n.
- 1. MRRL und GMV
- 2. Sonstige\n.
- IV. KOLLISION UND KOHÄSION - RECHTSPRECHUNG DES EUGH........\n.
- V. ZUSAMMENFASSUNG..\n
- E. UWG UND MARKENG\n.....
- I. ENTWICKLUNG ZUM MARKENG.\n.
- II. STATUS GEOGRAPHISCHER HERKUNFTSANGABEN NACH DEM MARKENG .....………………….……………………\n.
- IV. UWG IM VERHÄLTNIS ZUM MARKENRECHT.\n.
- 1. Ausgangssituation\n.
- 2. Vorrangthese Spezialität.\n.
- 3. Normenkonkurrenz - Subsidiarität..\n.
- 4. Bewertung - Stellungnahme ......\n
- V. VERKEHRSAUFFASSUNG UND IRREFÜHRUNGSQUOTE.\n
- VI. ANWENDUNGSBEREICHE DES § 512 NR. 1 UWG....\n
- 1. Nicht mehr existierende Ortsangaben......\n
- 2. Scheingeographische Ortsangaben............\n.
- 3. Noch nicht in Benutzung genommene Ortsangabe.\n
- 4. Teil einer Unternehmenskennzeichnung.\n
- F. PERSPEKTIVEN…...........\n……....
- I. INTERNATIONAL...\n.
- 1. TRIPS-Abkommen.....\n.
- 2. PVÜ, MHA und LUA\n.
- II. SUPRANATIONAL..\n
- III. NATIONAL....\n
- G. ZUSAMMENFASSUNG .\n.
- I. THESEN\n.
- II. SCHLUSSFOLGERUNG\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung und rechtliche Einordnung von Herkunftsangaben im Spannungsfeld von Wettbewerbs- und Markenrecht. Sie beleuchtet die Entwicklung des Schutzes geographischer Herkunftsangaben auf multilateraler, supranationaler und nationaler Ebene.
- Entwicklung des Schutzes geographischer Herkunftsangaben im internationalen Recht
- Regulierung von Herkunftsangaben im europäischen Recht
- Zusammenspiel von Wettbewerbsrecht und Markenrecht im Kontext von Herkunftsangaben
- Aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Herkunftsangaben
- Zukünftige Perspektiven für den Schutz geographischer Herkunftsangaben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung zum Thema, die die Bedeutung und die rechtliche Einordnung von Herkunftsangaben erklärt. Sie erläutert auch die Ziele und die Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel B definiert die wichtigsten Begriffe und grenzt das Wettbewerbsrecht vom Markenrecht ab. Es werden verschiedene Arten von Herkunftsangaben vorgestellt, darunter einfache Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und qualifizierte Herkunftsangaben, mittelbare und unmittelbare Herkunftsangaben, Gattungsbezeichnungen, sonstige Bezeichnungen sowie betriebliche Herkunftsangaben.
Kapitel C befasst sich mit dem Schutz von Herkunftsangaben auf multilateraler Ebene und beleuchtet die Entstehungsgeschichte von internationalen Verträgen wie der Pariser Verbandsübereinkunft, dem Madrider Herkunftsabkommen, dem Lissaboner Ursprungsabkommen und dem TRIPS-Abkommen. Es werden die Schutzrichtung und der Schutzumfang dieser Verträge erläutert und die einzelnen Abkommen verglichen und bewertet. Kapitel D untersucht die Regulierung von Herkunftsangaben im europäischen Recht, mit einem Schwerpunkt auf der VO (EG) NR. 510/2006. Es werden außerdem andere relevante Bestimmungen wie das MRRL und das GMV sowie die Rechtsprechung des EUGH im Hinblick auf Kollisionen und Kohäsion von Normen betrachtet.
Kapitel E behandelt das Verhältnis von UWG und Markengesetz zum Schutz geographischer Herkunftsangaben. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Markengesetzes, den Status geographischer Herkunftsangaben nach dem Markengesetz, die Normenkonkurrenz zwischen UWG und Markenrecht sowie die Verkehrsauffassung und die Irreführungsquote im Zusammenhang mit Herkunftsangaben. Kapitel F befasst sich mit den Perspektiven für den Schutz geographischer Herkunftsangaben auf internationaler, supranationaler und nationaler Ebene.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Herkunftsangaben, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Ursprungsbezeichnungen, geographische Angaben, Kennzeichenrecht, Lauterkeitsrecht, europäisches Recht, internationaler Recht, TRIPS-Abkommen, Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, Lissaboner Ursprungsabkommen, MRRL, GMV, EUGH.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einfachen und qualifizierten Herkunftsangaben?
Einfache Herkunftsangaben informieren lediglich über den Ort der Herstellung, während qualifizierte Herkunftsangaben (wie Ursprungsbezeichnungen) eine besondere Qualität des Produkts versprechen, die auf der geographischen Herkunft beruht.
Welche Rolle spielt das TRIPS-Abkommen für den Schutz von Herkunftsangaben?
Das TRIPS-Abkommen ist ein internationales Abkommen, das Mindeststandards für den Schutz geistigen Eigentums, einschließlich geographischer Angaben, auf multilateraler Ebene festlegt.
Wie schützt das Wettbewerbsrecht (UWG) den Verbraucher bei Herkunftsangaben?
Das UWG schützt vor irreführender Werbung. Unternehmen dürfen keine unwahren Herkunftsattribute verwenden, die den Kunden über die tatsächliche Qualität oder den Ursprung täuschen.
Was regelt die EU-Verordnung (EG) NR. 510/2006?
Diese Verordnung regelt den Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel auf europäischer Ebene.
Was versteht man unter einer Gattungsbezeichnung?
Eine Gattungsbezeichnung ist ein Name, der ursprünglich eine Herkunft bezeichnete, aber im allgemeinen Sprachgebrauch zum Namen des Produkts an sich geworden ist (z. B. Camembert) und keinen Herkunftsschutz mehr genießt.
- Citation du texte
- Pierre Lukas (Auteur), 2011, Herkunftsangaben im Spannungsfeld von Wettbewerbs- und Markenrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187895