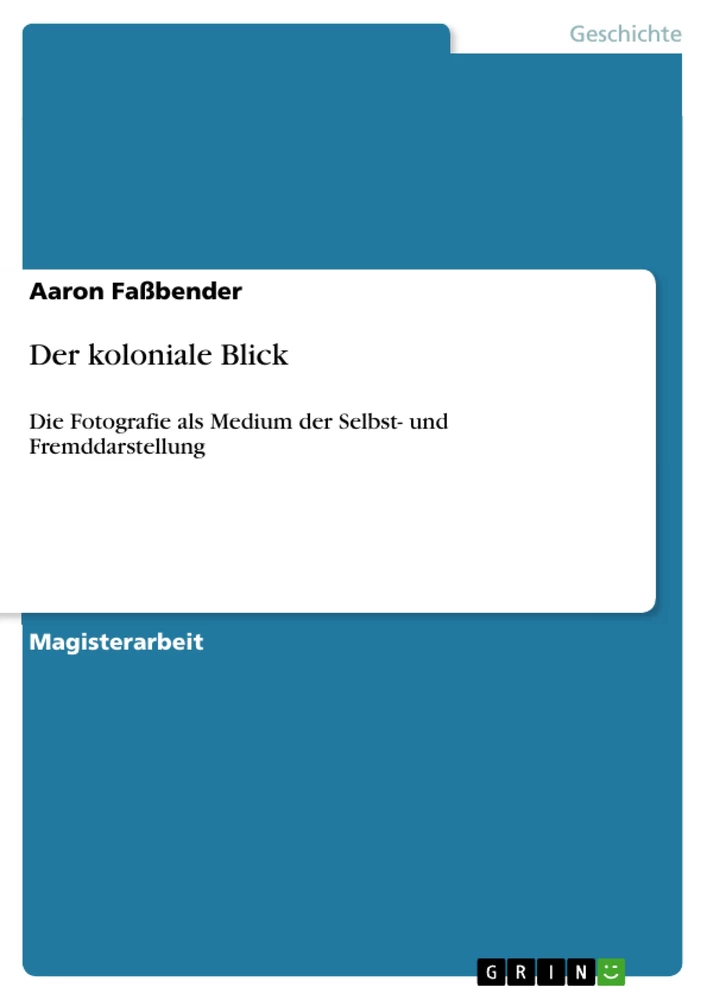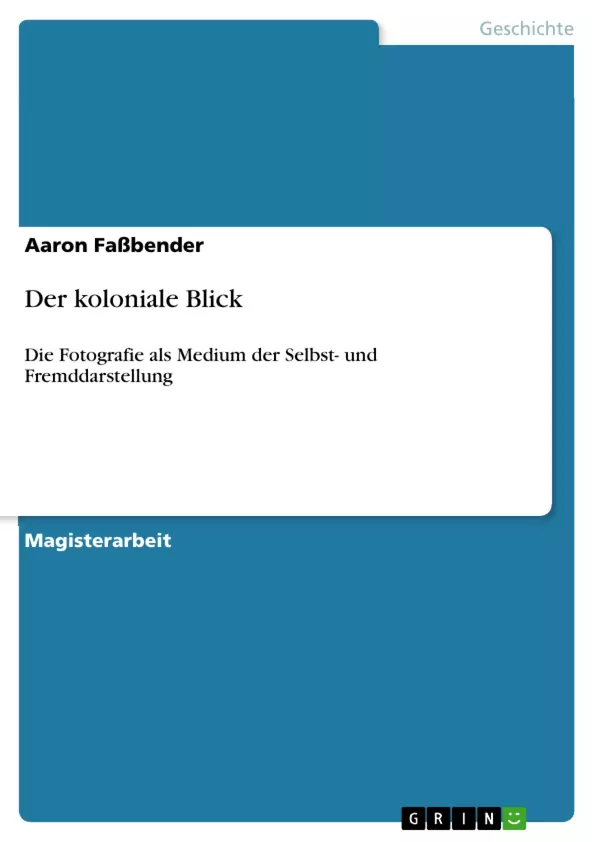Die Auseinandersetzung mit Fotografien stellt für den Historiker eine große Herausforderung dar. Die vorliegende Arbeit, Der koloniale Blick setzt sich mit den Problemen im Umgang mit dieser Quellengattung auseinander und untersucht ihren Nutzen für die Sozialgeschichte Deutsch-Ostafrikas. Geprüft werden soll außerdem, inwiefern die Fotografie als solches zu einem umfassenderen Verständnis der betrachteten Epoche beitragen kann.
Untersuchungsgegenstand ist die Kolonialfotografie, mit deren Hilfe die Selbst- und Fremddarstellung analysiert werden soll. Die Fotografie wird in ihrer Funktion als soziale Praxis betrachtet werden, die in gesellschaftlichen Zusammenhängen stattfindet und ihre Bedeutung, weniger aus sich selbst heraus, als durch Zuschreibungen und Verwendungszusammenhänge gewinnt. Von Bedeutung sind daher, nicht nur die Art und Weise in der die koloniale Welt in Ostafrika abgelichtet wurde, sondern auch die gesellschaftlichen und historischen Zusammenhänge, die den kolonialen Blick prägten. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, inwiefern das Sujet eines Fotografen repräsentativ für die Fremd- und Selbstwahrnehmung der kolonialen Gesellschaft sein kann. [...]
Um einen Einblick in den methodischen Umgang mit Fotografien zu vermitteln, ist der erste Teil der Arbeit der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Medium gewidmet. Im Hauptteil werden die Quellen verschiedenen Oberbegriffen zugeordnet, die anschließend einer eingehenden Analyse unterzogen werden. Dabei ist nicht zuletzt die Bewertung der Bilder auf Ebene der Authentizität sowie der Objektivität relevant, die wiederumeine eine profunde Auseinandersetzung mit den historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen voraussetzt.
Der Betrachtung der fotografischen Erschließung der Wildnis, d.h. der geo-grafischen und anthropologischen Betrachtungen der Kolonie und seiner Ureinwohner, schließt sich die Auseinandersetzung mit der Selbstdarstellung der Europäer an. Im Anschluss daran wird (im Kapitel Tabus der kolonialen Fotografie) der Frage nach dem nicht Dargestellten nachgegangen. Hierbei wird thematisiert, warum einzelne Aspekte des öffentlichen Lebens jener Zeit keinen Platz im fotografischen Nachlass fanden.
Abschließend wird eine Evaluierung bezüglich der Repräsentativität der betrachteten Bildzeugnisse für die Fremd- und Selbstwahrnehmung der kolonialen Gesellschaft vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellen, Literatur und Forschungsstand
- Vorgehensweise
- Die Fotografie als historische Quelle
- Die Illusion der Wahrhaftigkeit
- Die Fotografie in der historischen Forschung
- Anmerkungen zur Quellenkritik der verwendeten fotogra�fischen Quellen
- Die fotografische Erschließung der Wildnis
- Anthropologische Betrachtungen des wilden afrikanischen Ureinwohners
- Der zivilisierte Afrikaner
- Afrikanische Lohnarbeiter
- Afrikanische Bedienstete
- Das koloniale Schulwesen
- Afrikaner in den kolonialen Schutztruppen
- Krankheiten der indigenen Bevölkerung
- Die fotografische Selbstdarstellung der Kolonialherren
- Tabus der kolonialen Fotografie
- Krankheit und Tod der Kolonialherren
- Kolonialjustiz
- Der Bruch mit den Tabus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit, Der koloniale Blick, untersucht die Rolle der Fotografie in der Sozialgeschichte Deutsch-Ostafrikas. Sie analysiert die fotografische Selbstdarstellung der Kolonialherren und die Fremddarstellung der afrikanischen Bevölkerung, um ein besseres Verständnis der betrachteten Epoche zu erlangen. Die Arbeit befasst sich mit den Problemen im Umgang mit der Fotografie als historischer Quelle und untersucht die Authentizität und Objektivität der Bilder.
- Die Fotografie als Mittel der Selbst- und Fremddarstellung im Kolonialismus
- Die Rolle der Fotografie in der Erschließung und Repräsentation der „Wildnis“ und ihrer Bewohner
- Die Disziplinierung der afrikanischen Bevölkerung durch die koloniale Verwaltung und Mission
- Die Auswirkungen des Kolonialismus auf die Lebenswelt der afrikanischen Bevölkerung
- Die Tabuisierung bestimmter Motive in der kolonialen Fotografie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Fotografie als historischer Quelle und analysiert ihre Funktion als soziale Praxis. Das zweite Kapitel untersucht die fotografische Erschließung der „Wildnis“ in Deutsch-Ostafrika und die anthropologische Betrachtung der afrikanischen Bevölkerung. Das dritte Kapitel beleuchtet die verschiedenen Facetten der „Zivilisierung“ der afrikanischen Bevölkerung durch die koloniale Verwaltung und Mission, einschließlich der Arbeit auf Plantagen und in den Schutztruppen. Das vierte Kapitel analysiert die fotografische Selbstdarstellung der Kolonialherren und die Tabuisierung bestimmter Motive, wie Krankheit und Tod von Europäern.
Schlüsselwörter
Kolonialfotografie, Deutsch-Ostafrika, Sozialgeschichte, Selbstdarstellung, Fremddarstellung, Authentizität, Objektivität, Wildnis, Zivilisierung, Arbeit, Schutztruppe, Krankheit, Tod, Tabu, Exotismus, Xenophobie, Rassismus, Kolonialrecht, Disziplinierung.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Arbeit "Der koloniale Blick"?
Die Arbeit analysiert Kolonialfotografien aus Deutsch-Ostafrika als historische Quellen, um die Selbst- und Fremddarstellung der Kolonialgesellschaft zu verstehen.
Warum ist die Fotografie als historische Quelle problematisch?
Fotografien erzeugen eine "Illusion der Wahrhaftigkeit". In Wirklichkeit sind sie soziale Praktiken, deren Bedeutung stark von den Intentionen des Fotografen und dem historischen Kontext abhängt.
Wie wurden Afrikaner in der Kolonialfotografie dargestellt?
Die Darstellung reichte von anthropologischen Studien des "wilden Ureinwohners" bis hin zur Inszenierung des "zivilisierten Afrikaners" als Lohnarbeiter, Bediensteter oder Soldat in der Schutztruppe.
Welche Motive galten in der kolonialen Fotografie als Tabu?
Aspekte, die das Bild der überlegenen Kolonialherren schwächen könnten, wie Krankheit und Tod von Europäern oder die Brutalität der Kolonialjustiz, wurden oft nicht dargestellt.
Was war das Ziel der fotografischen Selbstdarstellung der Europäer?
Die Selbstdarstellung diente der Legitimation der Herrschaft und der Vermittlung eines Bildes von Ordnung, Zivilisation und Überlegenheit gegenüber der Heimatgesellschaft.
Inwiefern trägt die Fotografie zum Verständnis der Sozialgeschichte bei?
Sie macht visuell deutlich, wie Machtverhältnisse konstruiert wurden und wie die Disziplinierung der indigenen Bevölkerung durch Verwaltung und Mission funktionierte.
- Citation du texte
- M. A. Aaron Faßbender (Auteur), 2006, Der koloniale Blick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187931