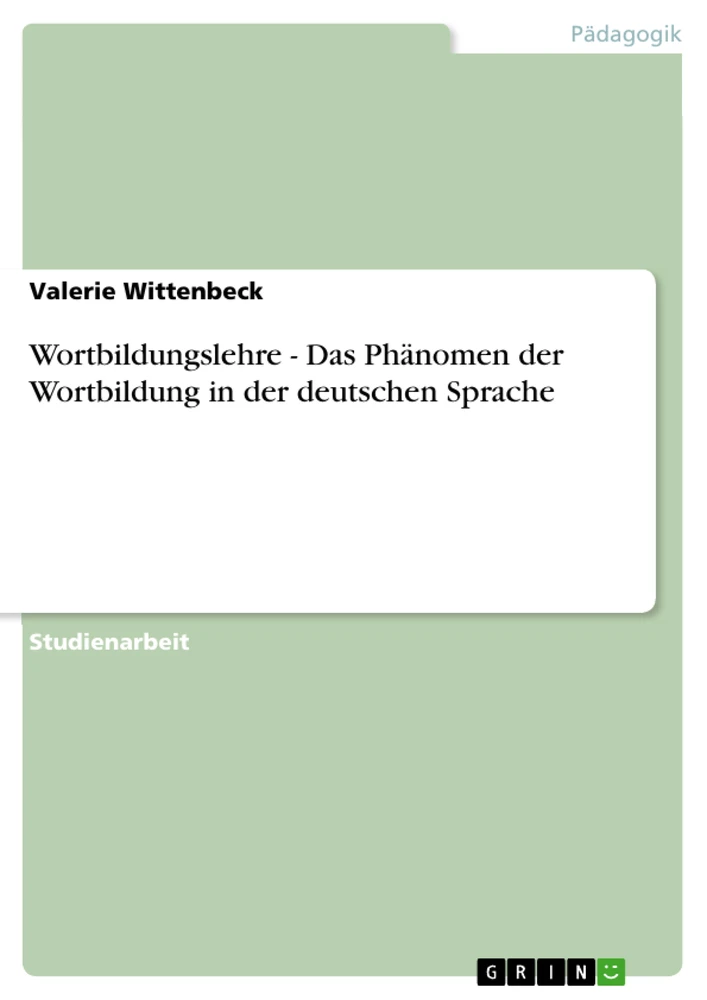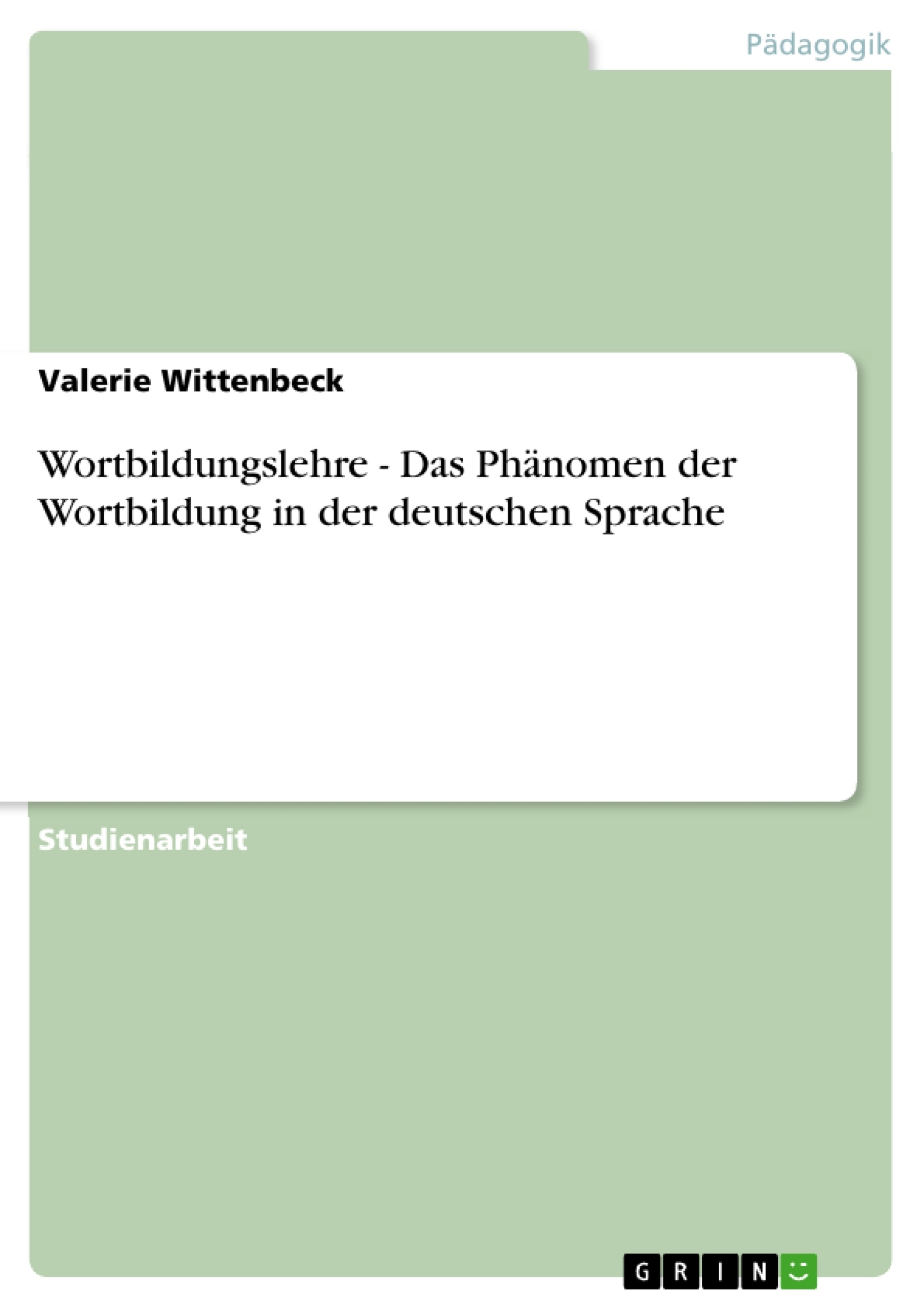Folgende Hausarbeit handelt von dem Phänomen der Wortbildung in der deutschen Sprache. Um den Prozess der Wortbildung nachvollziehen zu können, sollte zunächst die Bedeutung des Wortes und der Wortbausteine geklärt werden. Davon handelt das zweite Kapitel. Im dritten Kapitel wird die Wortbildung definiert und von weiteren Prozessen abgegrenzt. In Kapitel vier werden die Wortbildungstypen erläutert. Dabei werden die häufig genutzten Verfahren genau dargestellt. Die abschließende Betrachtung erläutert das Kapitel fünf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wortbausteine
- Lexikalische Morpheme
- Grammatische Morpheme
- Flexionsmorpheme
- Derivationsmorpheme
- Wortbildung
- Gründe für die Wortbildung
- Abgrenzungen
- Wortbildungstypen
- Komposition
- Determinativ-Komposita
- Kopulativ-Komposita
- Possessiv-Komposita
- Derivata / Ableitungen
- Explizite Ableitung
- Implizite Ableitung
- Konversion
- Kontamination
- Kürzung
- Komposition
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Wortbildung in der deutschen Sprache. Ziel ist es, den Prozess der Wortbildung zu beleuchten, indem die Bedeutung von Wörtern und Wortbausteinen analysiert und die verschiedenen Arten der Wortbildung erläutert werden. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Verfahren, mit denen neue Wörter aus bestehenden Sprachmaterialien gebildet werden.
- Bedeutung von Wörtern und Wortbausteinen
- Definition und Abgrenzung der Wortbildung
- Analyse verschiedener Wortbildungstypen
- Untersuchung der Motivation und Funktion der Wortbildung
- Die Rolle der Wortbildung in der Sprachentwicklung und Sprachvariation
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Bedeutung der Wortbildung für die deutsche Sprache. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die Inhalte der folgenden Kapitel.
Kapitel 2: Wortbausteine
Dieses Kapitel befasst sich mit der morphologischen Struktur von Wörtern und definiert den Begriff des Morphems. Es werden lexikalische und grammatische Morpheme unterschieden, die sich in ihrer Bedeutung und Funktion unterscheiden. Die Unterscheidung in freie und gebundene Morpheme wird ebenfalls behandelt.
Kapitel 3: Wortbildung
In diesem Kapitel wird die Wortbildung definiert und von anderen sprachlichen Prozessen abgegrenzt. Die Bedeutung der Wortbildung für die Sprachentwicklung und die Anpassung an neue Bedürfnisse der Gesellschaft wird erläutert. Die Motivation und die Funktion der Wortbildung werden ebenfalls behandelt.
Kapitel 4: Wortbildungstypen
Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Wortbildungstypen vor und erläutert ihre Merkmale. Dabei werden die wichtigsten Verfahren der Wortbildung wie Komposition, Derivation, Konversion, Kontamination und Kürzung detailliert beschrieben. Die Kapitel befasst sich mit den spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereichen jedes Wortbildungstyps.
Schlüsselwörter
Wortbildung, Morpheme, Lexikalische Morpheme, Grammatische Morpheme, Flexionsmorpheme, Derivationsmorpheme, Komposition, Derivation, Konversion, Kontamination, Kürzung, deutsche Sprache, Sprachentwicklung, Sprachvariation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Morphem und einem Wort?
Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache; ein Wort kann aus einem oder mehreren Morphemen bestehen.
Was versteht man unter „Komposition“?
Die Zusammensetzung von zwei oder mehr bereits existierenden Wörtern zu einem neuen Wort (z.B. „Haus“ + „Tür“ = „Haustür“).
Was ist eine „Derivation“ (Ableitung)?
Die Bildung eines neuen Wortes durch Anfügen eines Affixes (Präfix oder Suffix) an einen Wortstamm (z.B. „schön“ -> „Schönheit“).
Was ist der Unterschied zwischen Flexion und Wortbildung?
Flexion verändert die grammatische Form eines Wortes (z.B. Pluralbildung), während Wortbildung ein neues Wort mit neuer Bedeutung schafft.
Was bedeutet „Konversion“ in der Wortbildungslehre?
Der Wechsel eines Wortes in eine andere Wortart ohne formale Änderung (z.B. „laufen“ -> „das Laufen“).
- Citation du texte
- Dipl. Päd. Valerie Wittenbeck (Auteur), 2007, Wortbildungslehre - Das Phänomen der Wortbildung in der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187945