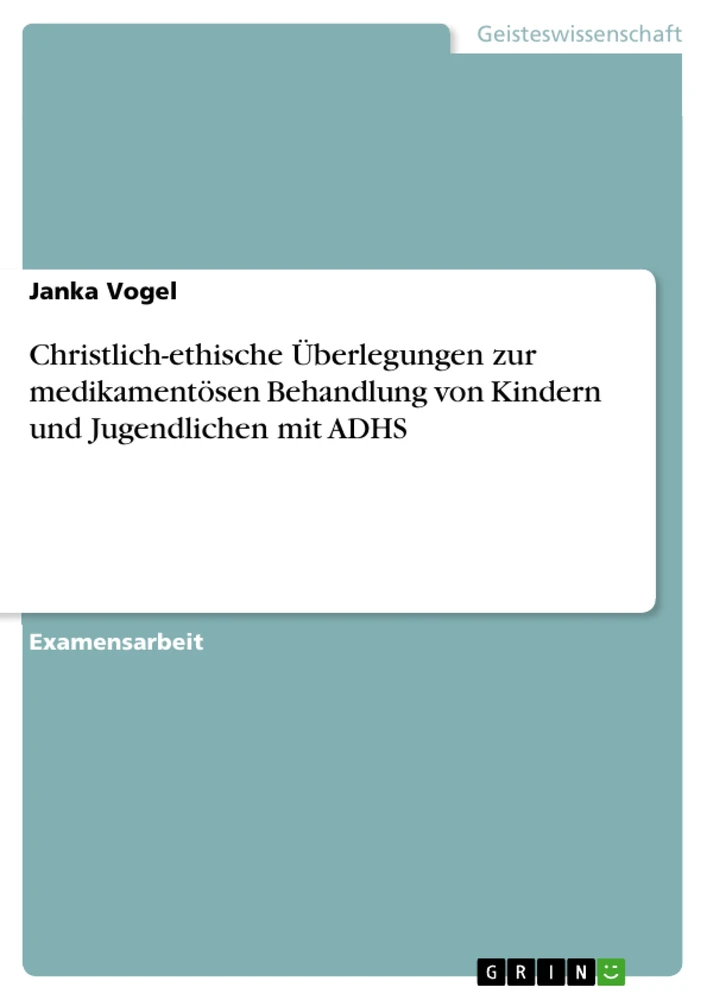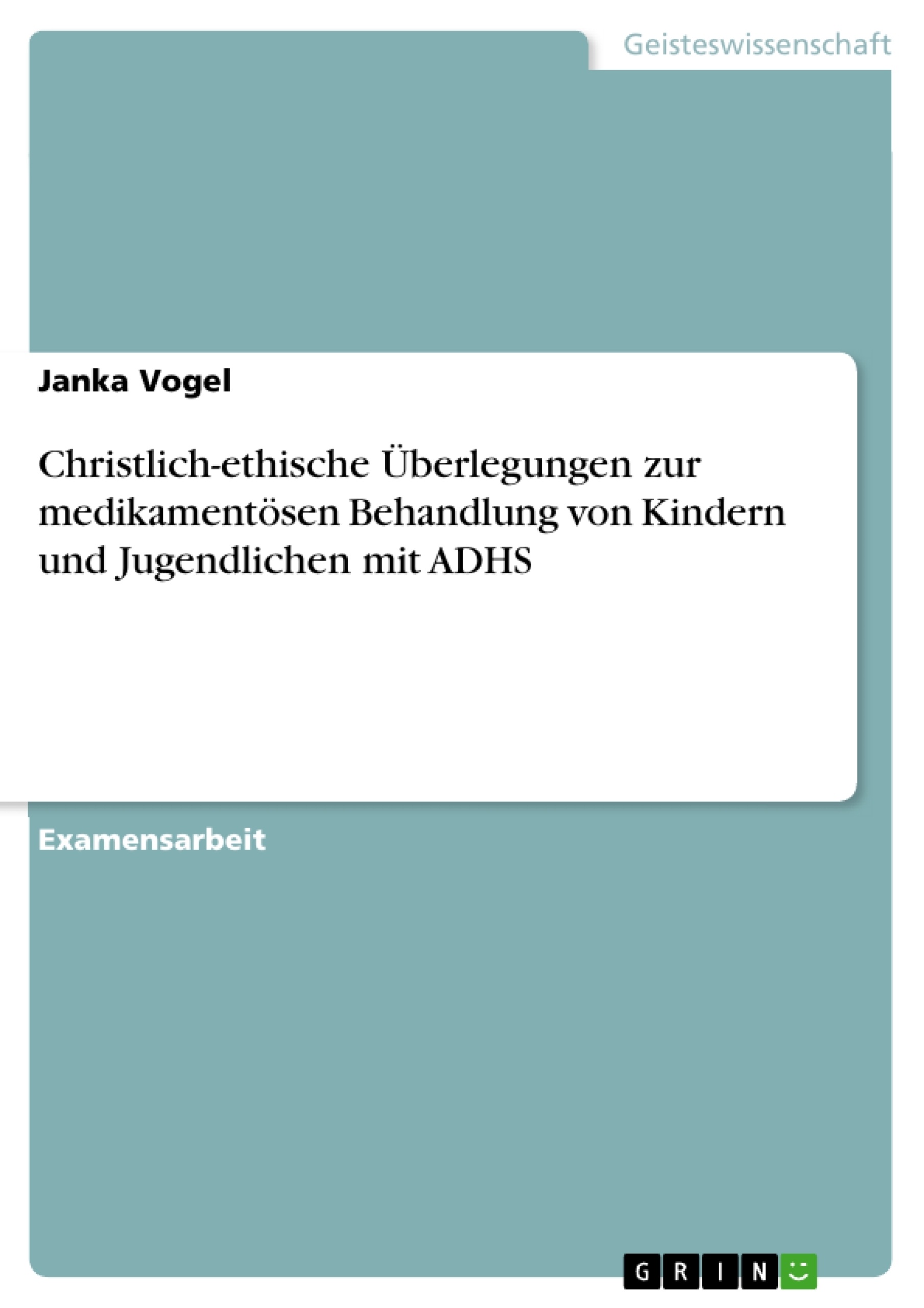Die medikamentöse Behandlung von Kindern/ Jugendlichen ist deshalb risikobehaftet, da sie sich noch in der körperlichen und geistigen Entwicklung befinden. Kaum ist bekannt, inwieweit die eingesetzten Medikamente Hirnschäden verursachen können oder die kindliche Entwicklung anderweitig gefährden können. Hinzu kommt, dass es sich bei dem eingesetzten Medikament um ein Amphetamin mit hohem Suchtfaktor handelt und derzeit noch Studien zur Langzeitwirkung der Substanz fehlen. In zunehmendem Maße werden Kinder und Jugendliche häufig jahrelang mit Medikamenten behandelt, deren Neben- und Langzeitwirkungen unbekannt sind, bei denen allerdings ein hohes Abhängigkeitsrisiko besteht; diese Substanzen fallen zum Teil unter das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wird durch die Einnahme eines Medikamentes dem Betroffenen suggeriert, er sei krank. Nicht zu unterschlagen ist also das Stigma, dem Kinder/ Jugendliche mit der Diagnose ADHS ausgesetzt werden.
Andererseits haben jahrelange Erfahrungen mit den pharmakologischen Wirkstoffen gezeigt, dass den Betroffenen durch die Einnahme von Medikamenten wie z.B. Ritalin® ein vergleichsweise normales Leben ermöglicht werden kann. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben - etwa in Kita, Schule, Ausbildungsstätte, Familie – ist für viele Kinder/ Jugendliche mit dem hyperkinetischen Syndrom ohne die Einnahme von besagten Medikamenten häufig kaum oder gar nicht möglich. Die Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit steigert die Leistungsfähigkeit und eine in den Griff bekommene Impulskontrolle ermöglicht soziale Beziehungen, ja schränkt sogar die zuweilen auftretende Gefährlichkeit/ Aggressivität jener ADHS-Kinder, die ihre Impulse nur schwer kontrollieren können, erheblich ein.
Ein Medikament, dessen genaue Wirkweise ebenso unbekannt wie dessen Langzeitwirkungen (Abhängigkeit?) ist, was aber gleichzeitig dem Betroffenen in den meisten Fällen einen fast normalen Alltag ermöglicht. Hier stehen die Rechte des Kindes einerseits und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Normen andererseits auf dem Prüfstand. Darf die Gesundheit und Persönlichkeit des Kindes/ Jugendlichen um den Preis seines Funktionierens in der Gesellschaft aufs Spiel gesetzt werden?
Die UN-Kinderrechtskonvention stellt das Wohl des Kindes vornean; sich dem anschließend wird hier ethisch zu prüfen sein, ob die medikamentöse Behandlung von Kindern/ Jugendlichen mit ADHS ihrem Wohl dienlich sein kann und wenn ja, unter welchen Bedingungen.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Wohle des Kindes..........
- Das ethische Problem
- ADHS gibt es
- und gibt es nicht?..\nSituationsanalyse
- Etablierung eines Krankheitsbildes...\nWissenschaftstheoretische Einwände......\nMarktwirtschaftliche Fakten und Zahlen..\nUnheilbar!?...........\nUrsachenforschung anhand der Bindungstheorie..\n„Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen“.\nBiblisch-theologischer Befund
- Der Mensch als Gemeinschaftswesen...\nGottes Wirken am und durch den Menschen........\nAnthropologische Grundpositionen der Schöpfungsberichte..\nKrankenheilungen und Dämonenaustreibungen als Zeichenhandlungen..\nDer Mensch als Dreiheit..........\nDes Menschen Aufgabe...\nKinder in der Bibel.....
- Hilfe zum Leben..........\nPrüfung von Normen und Gütern
- Zur Beziehung berufen..........\nUrteilsentscheid
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die ethische Frage der medikamentösen Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS aus christlicher Perspektive. Sie beleuchtet dabei die komplexe Problematik der Diagnose, die soziale Stigmatisierung und die ethischen Konflikte, die mit der Einnahme von Medikamenten wie Ritalin® verbunden sind.
- Das ethische Dilemma der medikamentösen Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen
- Die Auswirkungen der Diagnose ADHS auf die Lebenswelt der Betroffenen
- Die kritische Analyse der wissenschaftlichen Grundlagen der Diagnose ADHS
- Die Rolle der Pharmaindustrie und der wirtschaftlichen Interessen bei der Behandlung von ADHS
- Die ethische Bewertung der Medikamenteneinnahme im Hinblick auf die Rechte des Kindes und die gesellschaftlichen Normen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt das ethische Problem der medikamentösen Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen vor. Es zeigt die komplexe Situation auf, die durch die Diagnose, die Einnahme von Medikamenten und die damit verbundenen ethischen Konflikte entsteht.
- Im zweiten Kapitel werden die Entstehung und Verbreitung der Diagnose ADHS untersucht. Die Autorin beleuchtet kritisch die wissenschaftlichen Grundlagen der Diagnose, die Rolle der Pharmaindustrie und die marktwirtschaftlichen Faktoren, die zur Verbreitung der Diagnose ADHS beitragen.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob die medikamentöse Behandlung von ADHS im Einklang mit der christlichen Anthropologie steht. Es beleuchtet die biblische Sicht auf den Menschen, seine Aufgabe in der Welt und die Frage nach der Gottesebenbildlichkeit im Kontext der Krankheit und Heilung.
Schlüsselwörter
ADHS, Medikamentöse Behandlung, Kinder, Jugendliche, Ritalin®, Ethik, christliche Anthropologie, Diagnose, Stigma, Gesellschaftliche Normen, Pharmaindustrie, Rechte des Kindes, Wohl des Kindes, Bindungstheorie, Gottesebenbildlichkeit, Schöpfungsgeschichte, Krankenheilung, Dämonenaustreibung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Risiken birgt die medikamentöse Behandlung von Kindern mit ADHS?
Da sich Kinder noch in der Entwicklung befinden, sind Langzeitfolgen auf das Gehirn oft unbekannt. Zudem handelt es sich bei vielen Medikamenten um Amphetamine mit hohem Suchtfaktor, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.
Kann Ritalin® betroffenen Kindern zu einem normalen Leben verhelfen?
Ja, jahrelange Erfahrungen zeigen, dass Medikamente die Konzentration steigern und die Impulskontrolle verbessern können. Dies ermöglicht vielen Kindern erst die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Schule und Familie.
Was ist das ethische Dilemma bei der ADHS-Medikation?
Das Dilemma liegt in der Abwägung: Darf die Gesundheit und Persönlichkeit eines Kindes aufs Spiel gesetzt werden, nur damit es gesellschaftlichen Normen entspricht und „funktioniert“?
Wie beurteilt die christliche Anthropologie die Diagnose ADHS?
Die christliche Sicht betrachtet den Menschen als Gottes Ebenbild und Gemeinschaftswesen. Hierbei wird hinterfragt, ob die medikamentöse Behandlung dem Wohl des Kindes dient oder lediglich einer marktwirtschaftlich orientierten Leistungsgesellschaft.
Welche Rolle spielt die Stigmatisierung bei ADHS?
Die Diagnose und die tägliche Medikamenteneinnahme können dem Kind suggerieren, es sei „krank“ oder „nicht richtig“. Dieses Stigma kann die Identitätsentwicklung und das Selbstwertgefühl des Jugendlichen negativ beeinflussen.
- Quote paper
- Janka Vogel (Author), 2011, Christlich-ethische Überlegungen zur medikamentösen Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187971