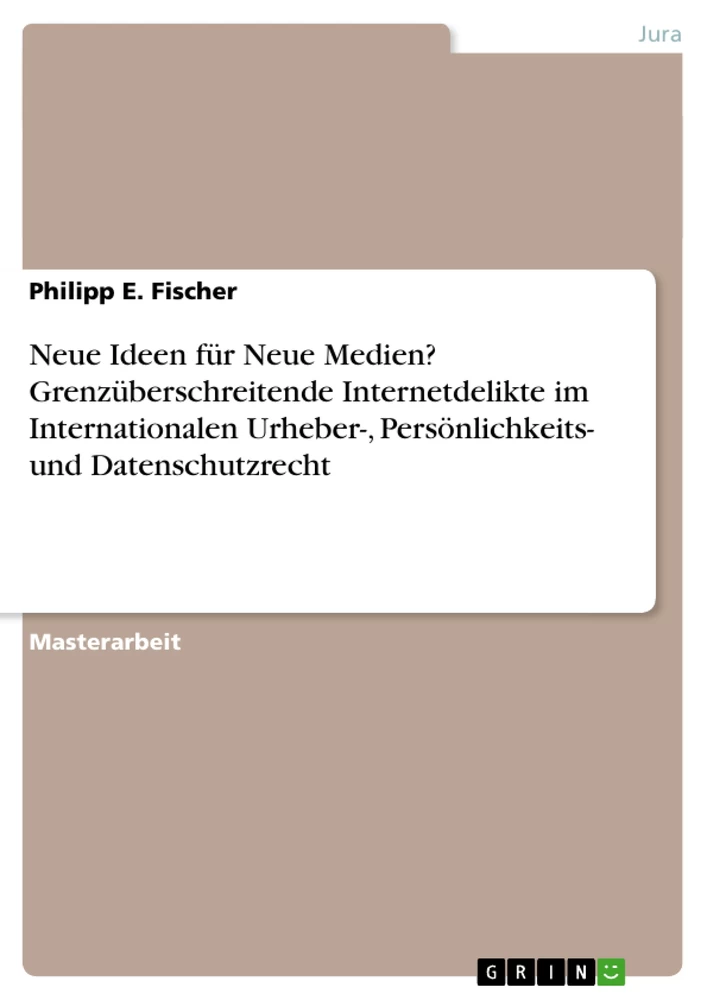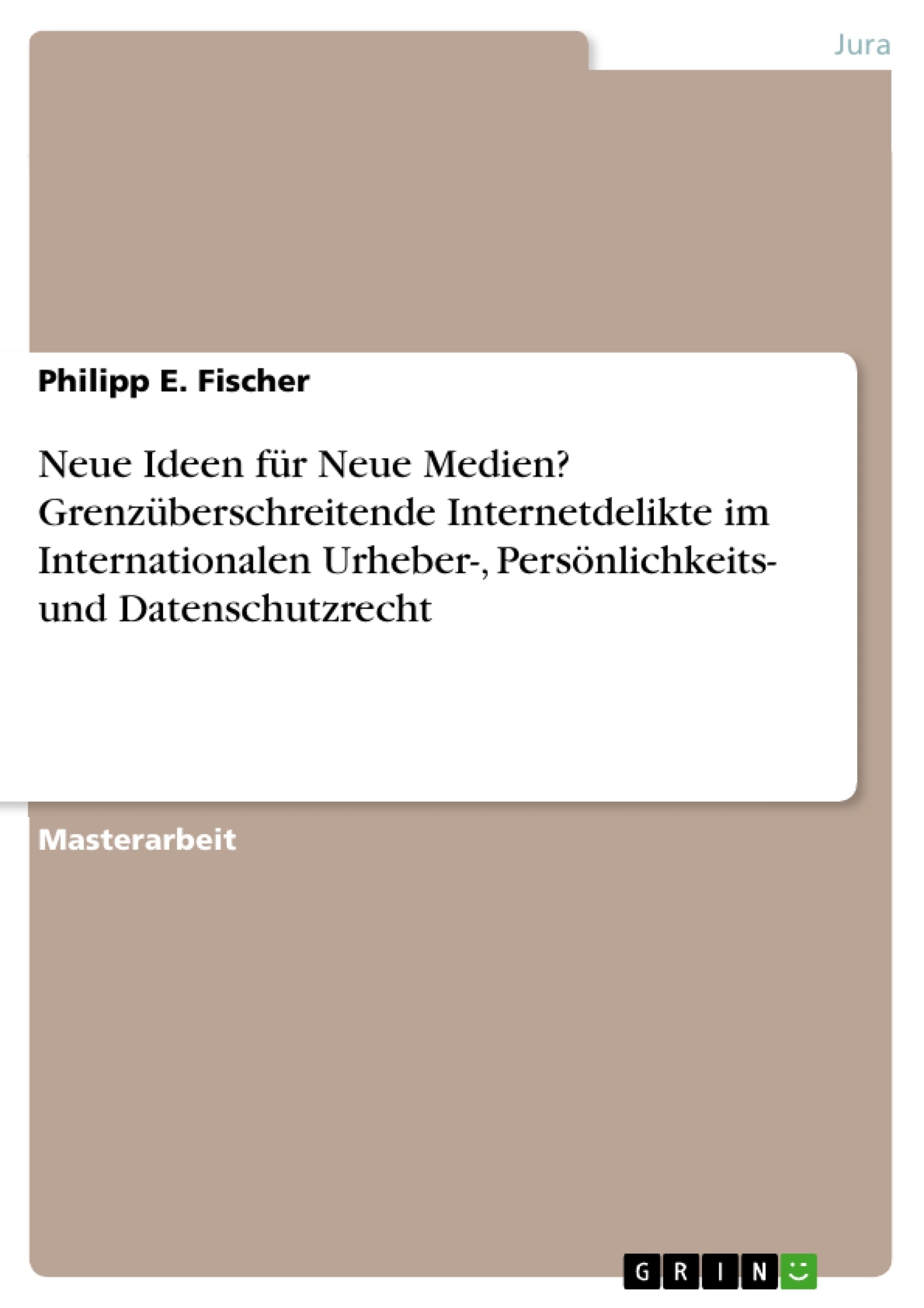"Immaterialgüterrechte machen nicht an den Staatsgrenzen halt". Besonders im Bereich des Internet haben die nationalen Grenzen daher ihre Bedeutung verloren, "cyberspace knows no national borders".
Im Zeitalter der weltweiten Vernetzung durch neue Informationstechnologien sind internationale Bezüge von erheblicher Bedeutung. Die klassische Telekommunikation und das Internet sind weltweite Netze, deren Datenströme in Bruchteilen einer Sekunde die Staatsgrenzen überschreiten. An diesem "free flow of data" hängen versinnbildlicht ausgedrückt auch Immaterialgüter, bei jeder Übertragung ist die Verletzung eines Immaterialgüterrechts denkbar.
Es stellen sich vielfältigste Fragen, die es in dieser Arbeit zu beantworten gilt. Begonnen werden muss mit der Beurteilung, welche Schutzgüter im Recht des Geistigen Eigentums durch Handlungen im Bereich des Informationstechnologierechts (IT-Recht) sein können und welchen sachrechtlichen Rechtsgebieten diese unterfallen. Dabei werden nur deliktsrechtliche Handlungen betrachtet, die im Medium Internet begangen werden können (Internetdelikte). Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen werden Wertungen nicht in rechtsvergleichender Hinsicht angestellt, sondern allenfalls auf das deutsche Sachrecht bezogen.
Der Autor wird die Frage zu beantworten haben, in welchem Land in einem derartigen Fall Klage erhoben werden kann. Diese Frage muss nach dem Internationale Zivilverfahrensrecht (IZVR) untersucht werden.
Sachrechtlich geprüft wird ein solcher Rechtsstreit von einem nationalen, durch das IZVR zuvor berufenen Gericht. Insofern hat das IZVR auf die spätere Entscheidung einen gewissen Einfluss, auch wenn der Autor den oft verwendeten Ausdruck "Vorentscheidung" nicht teilt. Dieses berufene Gericht, das sogenannte Forum, hat für die Prüfung ein nationales Sachrecht anzuwenden. Dieses zu bestimmen ist Aufgabe des Internationalen Privatrechts (IPR).
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1: Einleitung
- A. Aktualität der Problematik
- B. Fragestellungen
- C. Gedankengang
- Teil 2: Charakteristika der Delikte im Medium Internet
- A. Platzdelikt, Distanzdelikt und Streudelikt
- B. Ubiquität
- C. (De)territorialisierung
- D. Mobilität
- E. Anonymität
- Teil 3: Zuständigkeits- und kollisionsrechtliche Leitprinzipien und Interessen
- A. IZVR
- I. Leitprinzipien
- II. Interessen
- 1. Parteiinteressen
- a. Interessen des Klägers
- b. Interessen des Beklagten
- 2. Staatsinteressen
- 3. Gerichtsinteressen
- 1. Parteiinteressen
- B. IPR
- I. Leitprinzipien
- 1. Territorialitäts- und Schutzlandprinzip (lex loci protectionis)
- 2. Universalitäts- und Herkunftslandprinzip (lex originis)
- II. Interessen
- 1. Parteiinteressen
- a. Interessen des Klägers
- b. Interessen des Beklagten
- 2. Staatsinteressen
- 3. Gerichtsinteressen
- 1. Parteiinteressen
- I. Leitprinzipien
- C. Zwischenergebnis
- A. IZVR
- Teil 4: Internationales Urheberrecht
- A. Merkmale des Internationalen Urheberrechts im Internet
- I. Urheberrechtlich geschützte Werke im Internet
- II. Grenzüberschreitende Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke
- 1. Handlungen der Anbieter
- 2. Handlungen der Nutzer
- B. Rechtsgrundlagen
- I. Internationale Verträge
- 1. RBÜ
- 2. TRIPS, WCT, WPPT und WUA
- II. Gemeinschaftsrecht
- 1. EUGVO
- 2. Rom-II-VO
- III. Deutsches Sachrecht
- 1. Art. 40 EGBGB
- 2. §§ 120 ff. UrhG
- I. Internationale Verträge
- C. IZVR
- I. Ausgangssituation: Auswirkungen der Ubiquität des Internet
- 1. Faktisch fehlende Steuerbarkeit der Gerichtspflichtigkeit
- 2. Faktischer Klägergerichtsstand
- II. Ziel: Einschränkung der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis
- III. Lösungen?
- 1. EuGH-Urteil ,,Shevill''
- a. Entscheidung
- b. Übertragung auf das Internationale Urheberrecht und Kritik
- 2. Weitere Modelle
- 1. EuGH-Urteil ,,Shevill''
- I. Ausgangssituation: Auswirkungen der Ubiquität des Internet
- D. IPR
- I. Anknüpfung an die lex loci protectionis
- 1. Territorialitätsprinzip vs. Universalitätsprinzip
- 2. Abgrenzung zu alternativen Anknüpfungsregeln
- a. lex fori
- b. lex loci delicti commissi
- c. lex originis
- II. Besonderheiten des Mediums Internet
- 1. Auswirkungen des Schutzlandprinzips
- a. Streudelikt und Mosaikbetrachtung
- b. Begründung der Kommission
- 2. Eingriffslokalisierung
- a. Tatort
- b. Lokalisierung auf kollisionsrechtlicher Ebene
- c. Lokalisierung auf sachrechtlicher Ebene
- 1. Auswirkungen des Schutzlandprinzips
- I. Anknüpfung an die lex loci protectionis
- E. Zwischenergebnis
- I. Status quo
- II. Eingrenzung der Handlungsorte
- III. Beschränkung der Kognitionsbefugnis
- A. Merkmale des Internationalen Urheberrechts im Internet
- Teil 5: Internationales Persönlichkeits- und Datenschutzrecht
- A. Rechtsnatur und Schutzbereich im Sachrecht
- I. Allgemeines und besonderes Persönlichkeitsrecht im deutschen Sachrecht
- 1. Allgemeines Persönlichkeitsrecht
- 2. Besondere Persönlichkeitsrechte
- a. Fallgruppen
- b. Insbesondere: Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- II. Gemeinschaftsrecht
- 1. EMRK
- 2. EG-Datenschutzrichtlinie
- III. Zuordnung zu den Schutzgütern des Immaterialgüterrechts
- 1. Persönlichkeitsrecht
- 2. Datenschutzrecht
- I. Allgemeines und besonderes Persönlichkeitsrecht im deutschen Sachrecht
- B. Erscheinungsformen und Gefahren im Internet
- I. Erscheinungsformen des Web 2.0
- 1. User generated content
- a. Videoportale / Internet-Archive
- b. Blogs
- c. Social Networking
- 2. (Flash-)Cookies
- 3. Datenschutz und Terrorabwehr
- 4. Cloud Computing
- 1. User generated content
- II. Besondere Gefährdungslage
- I. Erscheinungsformen des Web 2.0
- C. Rechtsgrundlagen
- I. IZVR
- II. IPR
- 1. Rom-II-VO
- 2. E-Commerce-Richtlinie
- 3. Art. 40 EGBGB
- D. IZVR
- I. Ausgangssituation: Ubiquität
- II. Ziel: Einschränkung der gerichtliche Entscheidungsbefugnis
- III. Lösungen?
- 1. EuGH-Urteil ,,Shevill''
- 2. BGH-Vorlagebeschluss „Sedlmayr“
- 3. BGH-Urteil „New York Times“
- A. Rechtsnatur und Schutzbereich im Sachrecht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die rechtlichen Herausforderungen, die sich aus der grenzüberschreitenden Begehung von Internetdelikten im internationalen Urheber-, Persönlichkeits- und Datenschutzrecht ergeben. Sie analysiert die Besonderheiten des Mediums Internet und deren Einfluss auf die Anwendung internationaler Rechtsprinzipien.
- Die Auswirkungen der Ubiquität des Internets auf die internationale Zuständigkeit und die kollisionsrechtliche Anknüpfung
- Die Anwendung internationaler Rechtsprinzipien auf die im Internet begehbaren Delikte, insbesondere im Urheber-, Persönlichkeits- und Datenschutzrecht
- Die Bedeutung der Territorialitäts- und Universalitätsprinzipien im Kontext des Internet
- Die Herausforderungen der Lokalisierung von Internetdelikten und die Frage der Zuständigkeit
- Die Relevanz von internationalen Verträgen und Gemeinschaftsrecht für die Lösung der aufgeworfenen Probleme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Aktualität und Relevanz der Problematik von grenzüberschreitenden Internetdelikten dar und skizziert die Fragestellungen, die im Laufe der Arbeit untersucht werden sollen.
Kapitel 2 beleuchtet die Charakteristika von Delikten im Medium Internet, insbesondere die Ubiquität, (De)territorialisierung, Mobilität und Anonymität.
Kapitel 3 analysiert die internationalrechtlichen Leitprinzipien und Interessen, die bei der Beurteilung von grenzüberschreitenden Internetdelikten relevant sind. Es befasst sich mit den Prinzipien des Internationalen Zivilprozessrechts (IZVR) und des Internationalen Privatrechts (IPR).
Kapitel 4 untersucht das internationale Urheberrecht im Kontext des Internets. Es analysiert die Anwendung des Urheberrechts auf Werke im Internet, die grenzüberschreitende Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke und die relevanten Rechtsgrundlagen.
Kapitel 5 widmet sich dem internationalen Persönlichkeits- und Datenschutzrecht im Internet. Es untersucht die Rechtsnatur und den Schutzbereich dieser Rechte, die Erscheinungsformen und Gefahren im Internet sowie die relevanten Rechtsgrundlagen.
Schlüsselwörter
Grenzüberschreitende Internetdelikte, internationales Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Datenschutzrecht, Ubiquität, (De)territorialisierung, Territorialitätsprinzip, Universalitätsprinzip, lex loci protectionis, lex originis, IZVR, IPR, EuGH-Urteil „Shevill“, BGH-Vorlagebeschluss „Sedlmayr“, BGH-Urteil „New York Times“
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Herausforderungen bei Internetdelikten?
Die Hauptprobleme sind die Grenzlosigkeit des Internets (Ubiquität), die Anonymität der Nutzer und die Schwierigkeit, einen physischen Tatort für die rechtliche Verfolgung festzulegen.
Welches Recht ist bei grenzüberschreitenden Urheberrechtsverletzungen anwendbar?
In der Regel gilt das Schutzlandprinzip (lex loci protectionis), wonach das Recht des Staates angewendet wird, für dessen Territorium der Schutz beansprucht wird.
Was bedeutet "Ubiquität" im Kontext von Internetrecht?
Ubiquität bedeutet Allgegenwärtigkeit. Da Inhalte im Internet überall gleichzeitig abrufbar sind, kann eine Rechtsverletzung theoretisch in jedem Land der Welt gleichzeitig eintreten.
Wie wird die gerichtliche Zuständigkeit bei Internetdelikten bestimmt?
Die Zuständigkeit wird durch das Internationale Zivilverfahrensrecht (IZVR) bestimmt, wobei oft das EuGH-Urteil „Shevill“ als Orientierung dient, um die Kognitionsbefugnis einzuschränken.
Welche Rolle spielt das Web 2.0 im Persönlichkeitsrecht?
Durch "User Generated Content" in Blogs und sozialen Netzwerken entstehen neue Gefahren für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und den Datenschutz.
- Arbeit zitieren
- Philipp E. Fischer (Autor:in), 2010, Neue Ideen für Neue Medien? Grenzüberschreitende Internetdelikte im Internationalen Urheber-, Persönlichkeits- und Datenschutzrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187984