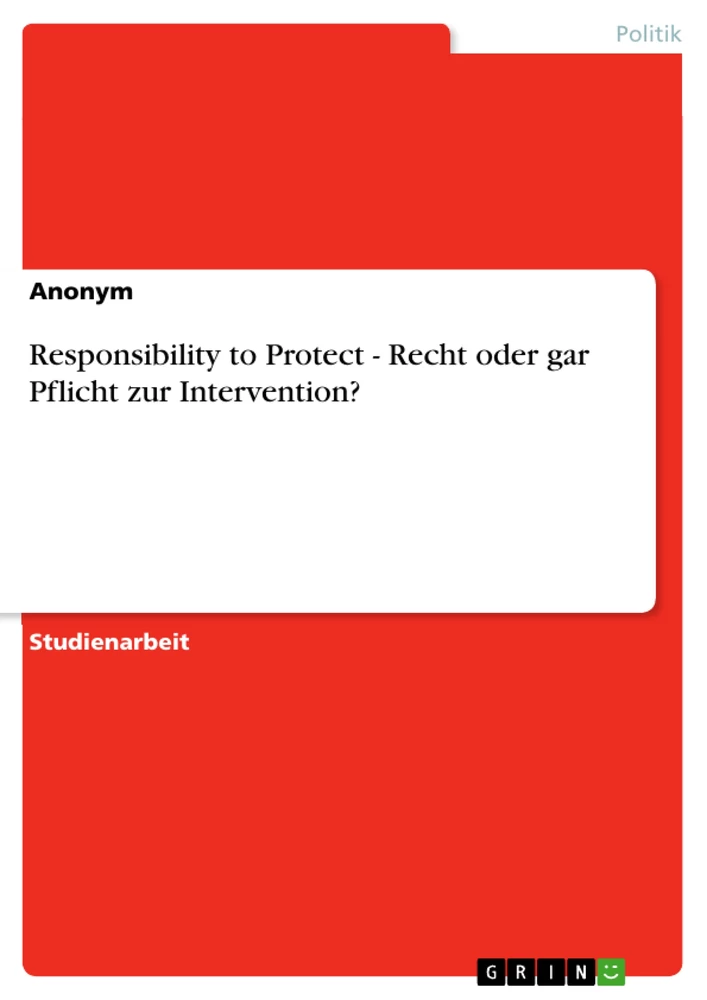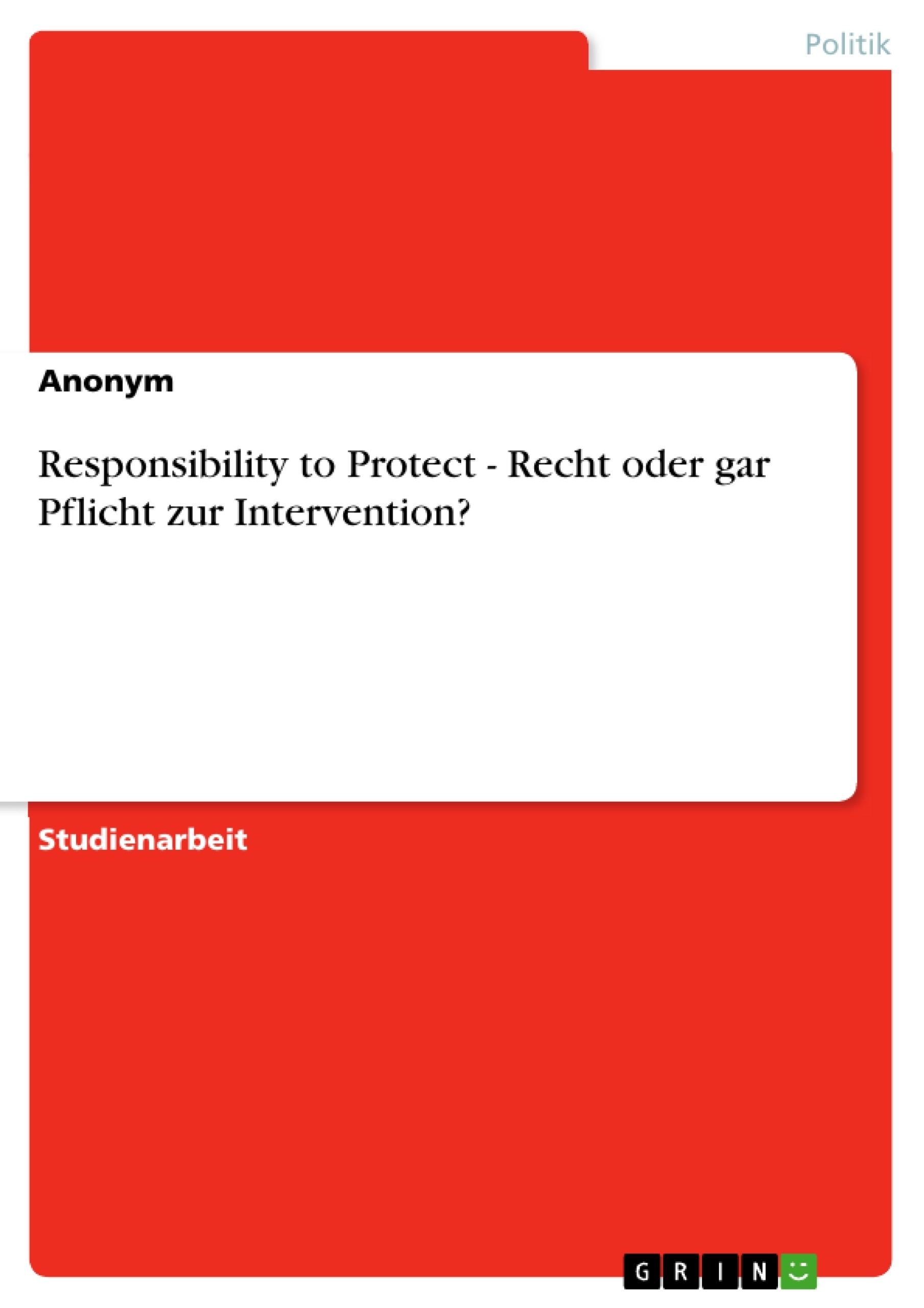Die Idee, dass jeder Staat für das Wohlergehen - im Sinne des Ausbleibens schwerer Menschenrechtsverletzungen - seines Volkes verantwortlich ist, ist mitnichten eine Erfindung des 21. Jahrhunderts und im Völkervertrags- und -gewohnheitsrecht fest verankert. Neu ist ebensowenig der Gedanke, dass darüber hinaus die Internationale Gemeinschaft für die Wahrung der Menschenrechte bzw. deren Wiederherstellung verantwortlich sein könnte, wenn der entsprechende Staat dazu nicht in der Lage oder nicht Willens ist. Allerdings stellte dies bisher eher eine empfundene moralische Verantwortung ohne völkerrechtliche Verankerung dar und hat folglich aufgrund der fehlenden Legitimierung Humanitärer Interventionen und dem damit einhergehenden Bruch des Schutzes der staatlichen Souveränität erhebliche Probleme aufgeworfen. Deutlich wurde dies an der nicht durch den UN-Sicherheitsrat mandatierten NATO-Operation in Kosovo im März 1999. Dieses Dilemma sollte durch völkerrechtliche Verankerung gelöst werden. Gleichzeitig belegt das traurige Beispiel der Ohnmacht der Vereinten Nationen, die Völkermorde in Ruanda zu unterbinden, die Notwendigkeit, aus einem Recht eine Pflicht zu machen. Entsprechender Gegenwind entstand auf Seiten von Staaten, die willkürliche Einschränkungen staatlicher Souveränität unter dem Deckmantel Humanitärer Interventionen befürchteten.
Auch Artikel I der Charta der Vereinten Nationen zeigt, dass der Friedens- und Sicherheitsgedanke lange Zeit von inter-nationaler Sichtweise - für ein friedliches Zusammenleben der Völker - geprägt war, intra-nationale Greueltaten standen nicht gerade im Mittelpunkt. Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, dass Kriege zwischen Nationen zugunsten innerstaatlicher Konflikte immer weniger als Bedrohung der Sicherheit empfunden werden, führte
dazu, dass als zu schützendes Subjekt allmählich verstärkt das Individuum empfunden wurde und weniger der Staat.
Politische Verankerung erreichte die „Responsibility to Protect“ im Abschlussdokument des World Summit 2005. Diese Arbeit soll den Fragen nachgehen, inwieweit die Responsibility to Protect mittlerweile auch eine völkerrechtliche Verankerung und damit Verbindlichkeit erlangt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung des Konzeptes der R2P
- Aktueller Stand der Implementierung
- Verankerung der R2P im Völkervertragsrecht
- R2P als Völkergewohnheitsrecht
- Opinio juris
- State practice
- Mediale Wahrnehmung im Lichte der Demonstrationen in Libyen
- Chancen weiterer Verankerung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der "Responsibility to Protect" (R2P), einer internationalen Norm, die die Verpflichtung der Staaten zur Verhinderung von schweren Menschenrechtsverletzungen innerhalb ihres Territoriums und die Pflicht der internationalen Gemeinschaft zum Eingreifen in Fällen staatlichen Versagens umfasst.
- Die Entstehung des R2P-Konzeptes und seine historische Einordnung
- Die rechtliche Verankerung von R2P im Völkervertragsrecht und im Völkergewohnheitsrecht
- Die aktuelle Umsetzung von R2P und ihre Herausforderungen
- Die Chancen einer stärkeren Verankerung des R2P-Konzeptes im internationalen Rechtssystem
- Die Rolle der Medien im Kontext von R2P
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Inwieweit hat die "Responsibility to Protect" eine völkerrechtliche Verankerung und damit Verbindlichkeit erlangt? Sie beleuchtet den historischen Kontext und das Dilemma zwischen staatlicher Souveränität und der Durchsetzung von Menschenrechten.
Entstehung des Konzeptes der R2P
Dieses Kapitel zeichnet die Entstehung des R2P-Konzeptes nach, ausgehend vom Bericht des damaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan im Jahr 1999 bis hin zum World Summit 2005, bei dem R2P erstmals politische Verankerung erreichte.
Aktueller Stand der Implementierung
Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Implementierung von R2P, insbesondere im Hinblick auf seine Verankerung im Völkervertragsrecht und im Völkergewohnheitsrecht. Es beleuchtet die Bedeutung von Opinio Juris und State Practice im Zusammenhang mit R2P. Weiterhin betrachtet es die mediale Wahrnehmung von R2P am Beispiel der Demonstrationen in Libyen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Verantwortung zum Schutz (Responsibility to Protect, R2P), Völkervertragsrecht, Völkergewohnheitsrecht, Opinio Juris, State Practice, Humanitäre Intervention, staatliche Souveränität, Menschenrechte, UN-Sicherheitsrat, World Summit 2005, mediale Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Responsibility to Protect“ (R2P)?
R2P ist ein völkerrechtliches Konzept, das besagt, dass die internationale Gemeinschaft eine Schutzverantwortung hat, wenn ein Staat sein Volk nicht vor schweren Menschenrechtsverletzungen schützen kann oder will.
Ist R2P bereits völkerrechtlich verbindlich?
Die Arbeit untersucht, inwieweit R2P durch den World Summit 2005 und die nachfolgende Staatspraxis bereits den Status von Völkergewohnheitsrecht erlangt hat.
Wie verhält sich R2P zur staatlichen Souveränität?
R2P definiert Souveränität nicht mehr als Privileg, sondern als Verantwortung. Bei schwerem Versagen des Staates tritt die Souveränität hinter den Schutz des Individuums zurück.
Welche Rolle spielte die NATO-Operation im Kosovo für R2P?
Die Operation von 1999 verdeutlichte das Dilemma illegaler, aber moralisch legitimierter Interventionen und beschleunigte die Suche nach einer völkerrechtlichen Verankerung.
Was sind die Voraussetzungen für eine Intervention unter R2P?
Voraussetzung sind schwerste Verbrechen wie Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie ein Mandat des UN-Sicherheitsrates.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2011, Responsibility to Protect - Recht oder gar Pflicht zur Intervention?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188226