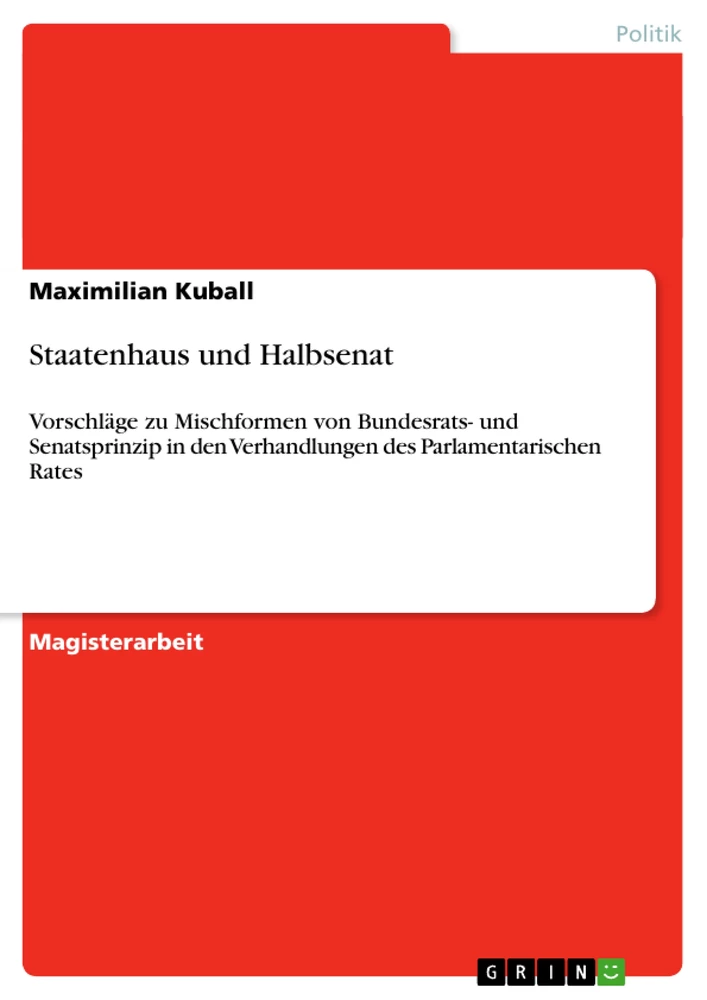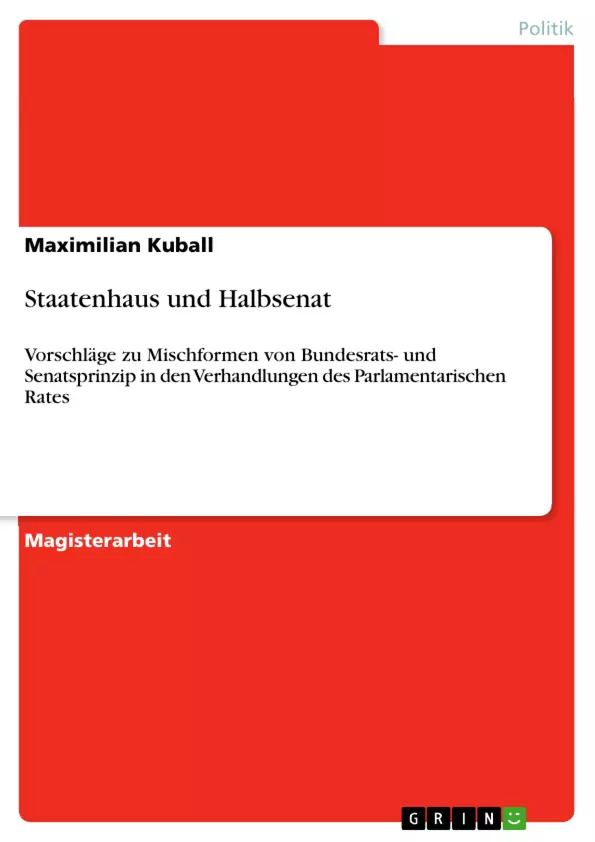„Die Verfassunggebende Versammlung wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die am besten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder herzustellen, und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentralinstanz schafft und die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält.“
Aufgrund dieser im ersten der Frankfurter Dokumente enthaltenen Maßgabe der Alliierten trat am 1. September 1948 in Bonn der Parlamentarische Rat zusammen, um für die deutschen Länder der drei westlichen Besatzungszonen eine föderalistische Verfassung auszuarbeiten. Schon vor Arbeitsbeginn des Rates wurde deutlich, daß dem Verfassungsabschnitt, der die Ausgestaltung des Föderalismus bestimmte, eine besondere Bedeutung zukommen würde. Und wirklich gehörten die späteren Grundgesetzartikel 50 bis 53 zum Bundesrat schon bei den Verfassungsberatungen zu „den umstrittensten Teilen des Grundgesetzes“. Der Streit drehte sich dabei um die zukünftige Gestalt der Länderkammer, die als Bundesrat oder als Senat konstituiert werden konnte. Beide Prinzipien hatten ihre entschiedenen Anhänger, ohne daß sich zunächst eines der beiden durchsetzen konnte. Keine Konstruktion schien eine Mehrheit bekommen zu können.
Auf der Suche nach einem Kompromiß entwickelten die Fraktionen sowie einzelne Abgeordnete eine Reihe von Mischkonzeptionen, die eine wachsende Zahl von Befürwortern hinter sich vereinen konnten. Zwar kam es nie zur Einigung auf ein konkretes Modell, trotzdem stand eine gemeinsame Idee hinter allen Konzepten. „Wenn zwei derartige Auffassungen sich schroff gegenüberstehen, so liegt es nahe, daß vermittelnd ein weiterer Vorschlag zum Ausdruck gekommen ist, ein Gedanke, der das Für und Wider beider Systeme reiflich abwägt und versucht, das Beste und Wertvollste aus ihnen zu einem Vermittlungsvorschlag zu vereinigen.“ Damit sollte eine möglichst breite Zustimmung zum Grundgesetzentwurf unter den Abgeordneten erreicht werden.
Obwohl alles darauf zuzulaufen schien, konnte sich durch eine überraschende Wende letztlich doch keines der gemischten Modelle durchsetzen. Das nach langwierigen und schwierigen Verhandlungen erstellte Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland enthielt wiederum den – für Deutschland fast schon traditionellen – Bundesrat. Mit der Verabschiedung der Verfassung am 8. Mai 1949 endete die Arbeit des Parlamentarischen Rates.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand
- Abgrenzung
- Quellen
- Literatur
- Forschungsstand
- Bundesrat und Senat
- Das Bundesratsprinzip
- Vorläufer des Bundesrats
- Das Senatsprinzip
- Das Staatenhaus von 1848
- Die Vorgeschichte des Grundgesetzes
- Londoner Empfehlungen und Frankfurter Dokumente
- Föderalismusdiskussion der Parteien
- Vorbereitungen der CDU/CSU
- Die Menzel-Entwürfe der SPD
- Bundesstaatskonzepte der kleinen Parteien
- Der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee
- Der Herrenchiemsee-Bericht
- Der Parlamentarische Rat
- Zusammensetzung und organisatorischer Aufbau
- Verlauf der Verhandlungen
- Beginn der Beratungen
- Das Gespräch Ehard - Menzel
- Die Verhandlungen in der Krise
- Erneuter Einspruch und Verabschiedung
- Beurteilung des Ergebnisses
- Die Argumentation zur Länderkammer
- Bundesratsprinzip
- Senatsprinzip
- Mischformen
- Mischkonzepte der CDU/CSU
- Die Entwicklung der Diskussion
- Lehr-Entwürfe
- Süsterhenn-Entwürfe
- Vorschlag Dr. de Chapeaurouge
- Entwurf Laforet
- Drei-Kammer-System
- Mischkonzepte der anderen Parteien
- Mischkonzepte der FDP
- Antrag Dehler
- Der Fraktionsantrag
- „Zum Präsidialsystem”
- Drucksache Nr. 694
- Kompromißvorschlag der SPD?
- Vorschlag des Zentrums
- Vorschlag der DP
- Zusammenfassung und Vergleich
- Die gegenwärtige Kritik am Bundesrat
- Problemlage des deutschen Föderalismus
- Konzepte zur Umgestaltung des Bundesrates
- Hypothetische Überlegungen zum Halbsenat
- Ausblick
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Entstehung des Bundesrates im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Verhandlungen des Parlamentarischen Rates und insbesondere die Diskussion um die Ausgestaltung der Länderkammer. Die Arbeit untersucht die Vorgeschichte des Grundgesetzes, die verschiedenen Modelle für die Länderkammer, sowie die Argumente und Kompromissvorschläge der beteiligten Parteien.
- Das Bundesratsprinzip und das Senatsprinzip als zwei alternative Modelle für die Länderkammer
- Die Entwicklung verschiedener Mischformen zwischen Bundesrat und Senat während der Verfassungsberatungen
- Die Rolle der verschiedenen Parteien und ihrer Positionen zur Ausgestaltung der Länderkammer
- Die Herausforderungen und Kompromisse, die während des Verhandlungsprozesses des Grundgesetzes entstanden sind
- Die Relevanz der Diskussion um die Länderkammer für die Funktionsweise des deutschen Föderalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand der Untersuchung sowie die Abgrenzung des Themas, die Quellen, die Literatur und den Forschungsstand darlegt. Anschließend werden die beiden Grundprinzipien des Bundesrats und des Senats im Detail vorgestellt.
Im dritten Kapitel wird die Vorgeschichte des Grundgesetzes beleuchtet, wobei die Londoner Empfehlungen, die Frankfurter Dokumente und die föderalismusbezogene Diskussion der verschiedenen Parteien analysiert werden. Auch der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee, der einen wichtigen Meilenstein in den Verhandlungen darstellte, wird untersucht.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Parlamentarischen Rat. Die Zusammensetzung und der organisatorische Aufbau des Rates sowie der Verlauf der Verhandlungen werden im Detail dargestellt. Die Arbeit analysiert die wichtigsten Diskussionspunkte und die Entscheidungen des Rates in Bezug auf die Länderkammer.
Im fünften Kapitel werden die Argumente der verschiedenen Parteien für die jeweiligen Modelle der Länderkammer, also das Bundesratsprinzip, das Senatsprinzip und Mischformen, dargestellt und miteinander verglichen.
Die Arbeit fokussiert im sechsten Kapitel auf die Mischkonzepte der CDU/CSU, die als eine der maßgeblichen Parteien an den Verhandlungen beteiligt waren. Die verschiedenen Entwürfe und Kompromissvorschläge werden beleuchtet.
Im siebten Kapitel werden die Mischkonzepte der anderen Parteien, wie der FDP, der SPD, des Zentrums und der DP, vorgestellt und gegenübergestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Bundesrat, Senat, Parlamentarischer Rat, Grundgesetz, Länderkammer, Föderalismus, Mischformen, Verfassungsgebung, CDU/CSU, SPD, FDP, Zentrum, DP.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Hauptstreitpunkt bei der Länderkammer im Grundgesetz?
Der Streit drehte sich darum, ob die Länderkammer als Bundesrat (Regierungsvertreter) oder als Senat (gewählte Vertreter) konstituiert werden sollte.
Was ist das Bundesratsprinzip?
Hierbei werden die Mitglieder der Länderkammer von den Landesregierungen entsandt und sind an deren Weisungen gebunden.
Was sah das Senatsprinzip vor?
Ein Senat bestünde aus direkt oder indirekt gewählten Vertretern der Länder, die unabhängig von ihren Regierungen entscheiden könnten.
Welche Mischkonzepte wurden im Parlamentarischen Rat diskutiert?
Es gab Entwürfe für ein „Staatenhaus“ oder einen „Halbsenat“, die versuchten, Elemente beider Systeme zu vereinen, um einen Kompromiss zu finden.
Warum setzte sich letztlich der Bundesrat durch?
Nach langwierigen Verhandlungen kehrte man zum traditionellen deutschen Modell zurück, um die Rechte der Landesregierungen direkt zu wahren.
- Citation du texte
- Maximilian Kuball (Auteur), 2005, Staatenhaus und Halbsenat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188227