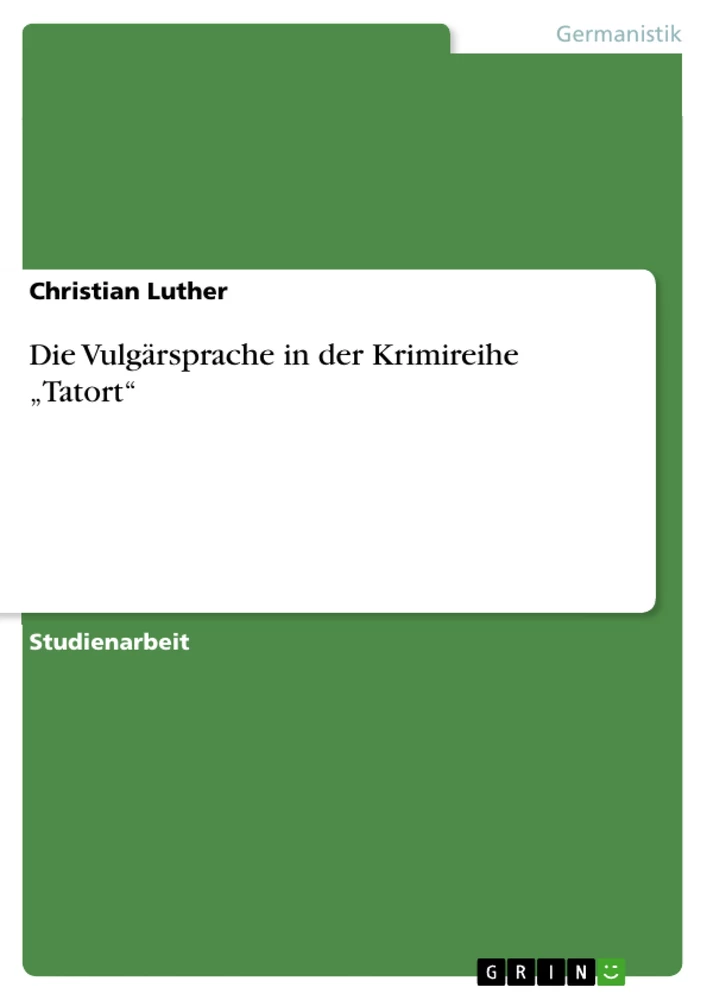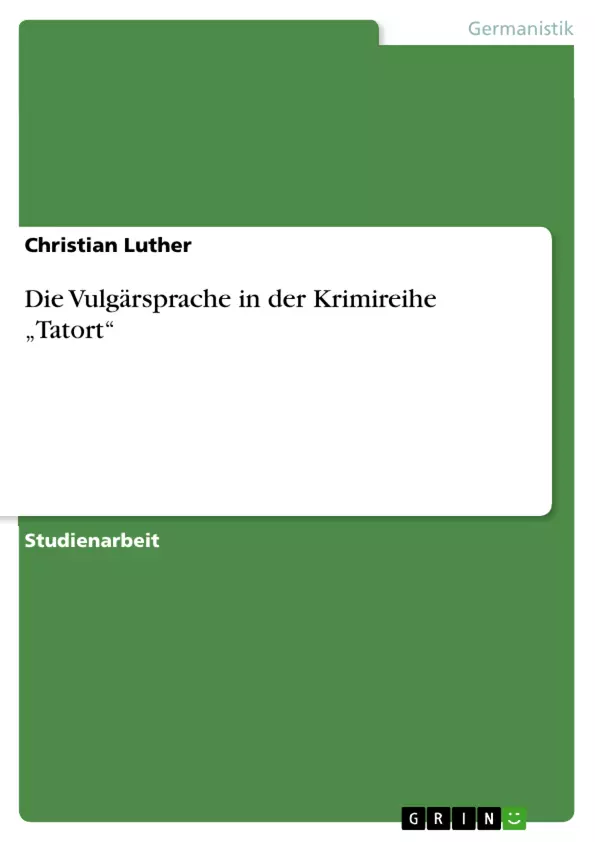"Unsere Jugendsprache ist obszön, unschön und amerikanisiert - sie zeigt, wie versaut und unappetitlich unsere Kultur geworden ist! Die Jugend hat sich völlig verändert. Vulgäre, obszöne Ausdrücke sind an der Tagesordnung. Das fördern die Medien, die offen mit der Fäkalsprache umgehen. In TV-Shows werden Jugendliche von Leuten wie Dieter Bohlen fertig gemacht. Gleichzeitig kupfern diese 'alten Herren' ihre Sprache von den Jugendlichen ab, weil sie cool sein wollen. Bei mir ist das Wort 'geil' verboten - das Wort ist aufdringlich."
(Powelz 2010)
So lautet die Aussage Götz Georges, der als Kommissar Schimanski vor allem aufgrund seiner rohen Sprachverwendungsweise, bekannt geworden ist. Ein paradoxer Umstand, wenn man die von Fäkal- und Schimpfworten geprägte, Sprache der Figur in den 80er-Jahren bedenkt. Tatsächlich ist seitdem fast ein Viertel Jahrhundert vergangen und „Vulgäre und obszöne Ausdrücke“ sind aus unserer heutigen Medienlandschaft nicht mehr weg zu denken und erst recht keine Randerscheinung mehr, meint der Ex-Tatort-Kommissar.
Wurde Schimanskis Sprache damals noch aufgrund seiner Exzentrik als markiert und durch diesen Umstand gerechtfertigt als Sonderfall gesehen, spricht die deutsche Schauspielerin Mimin Anneke Kim Sarnau auf Nachfrage innerhalb einer Pressekonferenz, bezüglich ihrer von Fluchworten durchzogenen Sprache, davon, dass sie sich als Prolet auf hohem Niveau verstehe (Rösch, 2010). Die britische Aufsichtsbehörde Ofcom berichtet währenddessen von einer wachsenden Akzeptanz des Fernsehpublikums gegenüber der Vulgärsprache. Ausdrücke dieser, wie Scheiße und Schwuchtel, seien mittlerweile gängig (Zettel, 2010).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wissenschaftlicher Hintergrund
- 3. Hypothese(n) und Methodik
- 4. Ergebnisse und Auswertung
- 5. Zusammenfassung und Forschungsausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Akzeptanz vulgärer Sprache im deutschen Fernsehen, speziell in der Krimireihe „Tatort“. Das Ziel ist es, die Veränderung der Verwendung von Vulgarismen in verschiedenen Episoden und Jahrzehnten zu analysieren und die Hypothese zu überprüfen, ob die Verwendung vulgärer Sprache bei Tatort-Kommissaren nach 2005 selbstverständlicher geworden ist.
- Entwicklung der Vulgärsprache im deutschen Fernsehen
- Vergleich der Sprachverwendung von Tatort-Kommissaren verschiedener Jahrzehnte
- Wandel der gesellschaftlichen Akzeptanz von Vulgarismen
- Einfluss der Medien auf die Verwendung und Wahrnehmung von Vulgärsprache
- Untersuchung konstruierter Sprachsituationen im Fernsehen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Entwicklung und Akzeptanz von Vulgärsprache im „Tatort“ vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen und der sich verändernden Medienlandschaft dar. Sie kontrastiert die kontroverse Wahrnehmung vulgärer Sprache anhand von Zitaten von Götz George (Schimanski) und Anneke Kim Sarnau, und der britischen Aufsichtsbehörde Ofcom. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Vulgärsprache in vier ausgewählten „Tatort“-Episoden.
2. Wissenschaftlicher Hintergrund: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert den Begriff „Tabu“ im Kontext von Sprache und gesellschaftlichen Normen, basierend auf den Arbeiten von Caroline Mayer. Es wird erläutert, wie Tabus und gesellschaftliche Werte die Verwendung von Vulgärsprache beeinflussen und diese als dynamische, sich verändernde Größe definiert. Der Begriff „Vulgärsprache“ wird präzisiert, indem die Komponenten, wie z.B. Fäkalsprache und Sexualwortschatz, erläutert werden.
3. Hypothese(n) und Methodik: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Hypothese, dass Tatort-Kommissare nach 2005 Vulgärsprache selbstverständlicher verwenden als ihre Vorgänger. Die Hypothese wird in den Kontext der These von Mayer gestellt, wonach die Akzeptanz von früher schockierenden Vulgärausdrücken gestiegen ist. Der Einfluss des Alters der Zuschauerschicht und die Verschiebung der Bedeutung fäkalsprachlicher Ausdrücke in der Kommunikation werden diskutiert. Die Arbeit berücksichtigt, dass es sich beim „Tatort“ um konstruierte Sprachsituationen handelt und thematisiert die These von Neuland, dass Medien eine „medial konstruierte Jugendsprache“ kreieren.
Schlüsselwörter
Vulgärsprache, Tatort, Mediensprache, Sprachwandel, Tabu, gesellschaftliche Akzeptanz, Fäkalsprache, Jugendsprache, konstruierte Sprachsituationen, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Vulgärsprache im Tatort
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Entwicklung und Akzeptanz vulgärer Sprache im deutschen Fernsehen, insbesondere in der Krimireihe „Tatort“. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Sprachverwendung von Tatort-Kommissaren über verschiedene Jahrzehnte und der Überprüfung der Hypothese, ob die Verwendung vulgärer Sprache nach 2005 selbstverständlicher geworden ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Wissenschaftlicher Hintergrund, Hypothesen und Methodik, Ergebnisse und Auswertung, sowie Zusammenfassung und Forschungsausblick. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor, der wissenschaftliche Hintergrund liefert theoretische Grundlagen, die Methodik beschreibt den Forschungsansatz, die Ergebnisse werden ausgewertet und die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Hypothesen werden untersucht?
Die zentrale Hypothese lautet, dass Tatort-Kommissare nach 2005 Vulgärsprache selbstverständlicher verwenden als ihre Vorgänger. Diese Hypothese wird im Kontext der These von Mayer (Akzeptanz früher schockierender Vulgärausdrücke) und dem Einfluss des Alters der Zuschauerschicht diskutiert. Die Arbeit berücksichtigt auch die konstruierte Natur der Sprachsituationen im „Tatort“ und die These von Neuland zur medial konstruierten Jugendsprache.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewandte Methodik im Kapitel „Hypothesen und Methodik“. Die genaue Vorgehensweise bei der Analyse der Vulgärsprache in den ausgewählten „Tatort“-Episoden wird detailliert dargestellt. Die Anzahl der Episoden und der Zeitraum der Analyse sind in der Arbeit spezifiziert (vier ausgewählte Episoden).
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Das Kapitel „Wissenschaftlicher Hintergrund“ legt die theoretischen Grundlagen dar. Es definiert den Begriff „Tabu“ im Kontext von Sprache und gesellschaftlichen Normen, basierend auf den Arbeiten von Caroline Mayer. Der Begriff „Vulgärsprache“ wird präzisiert, und es wird erläutert, wie Tabus und gesellschaftliche Werte die Verwendung von Vulgärsprache beeinflussen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse und deren Auswertung sind im Kapitel „Ergebnisse und Auswertung“ detailliert beschrieben. Die Arbeit präsentiert eine Analyse der Sprachverwendung in den ausgewählten „Tatort“-Episoden und prüft, ob die aufgestellte Hypothese bestätigt werden kann. Die genauen Ergebnisse sind im Haupttext der Arbeit aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit charakterisieren, sind: Vulgärsprache, Tatort, Mediensprache, Sprachwandel, Tabu, gesellschaftliche Akzeptanz, Fäkalsprache, Jugendsprache, konstruierte Sprachsituationen, Soziolinguistik.
Welche Quellen werden zitiert?
Die Arbeit zitiert unter anderem Arbeiten von Caroline Mayer und Neuland. Weitere Quellen werden im Literaturverzeichnis detailliert aufgeführt. Die Zitate von Götz George (Schimanski) und Anneke Kim Sarnau, sowie der britischen Aufsichtsbehörde Ofcom dienen als Beispiele für kontroverse Wahrnehmungen von Vulgärsprache.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die Themen Sprachwandel, Mediensprache, Soziolinguistik und die gesellschaftliche Akzeptanz von Vulgärsprache interessiert. Sie ist für die akademische Nutzung und die Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise konzipiert.
- Citation du texte
- Christian Luther (Auteur), 2011, Die Vulgärsprache in der Krimireihe „Tatort“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188262