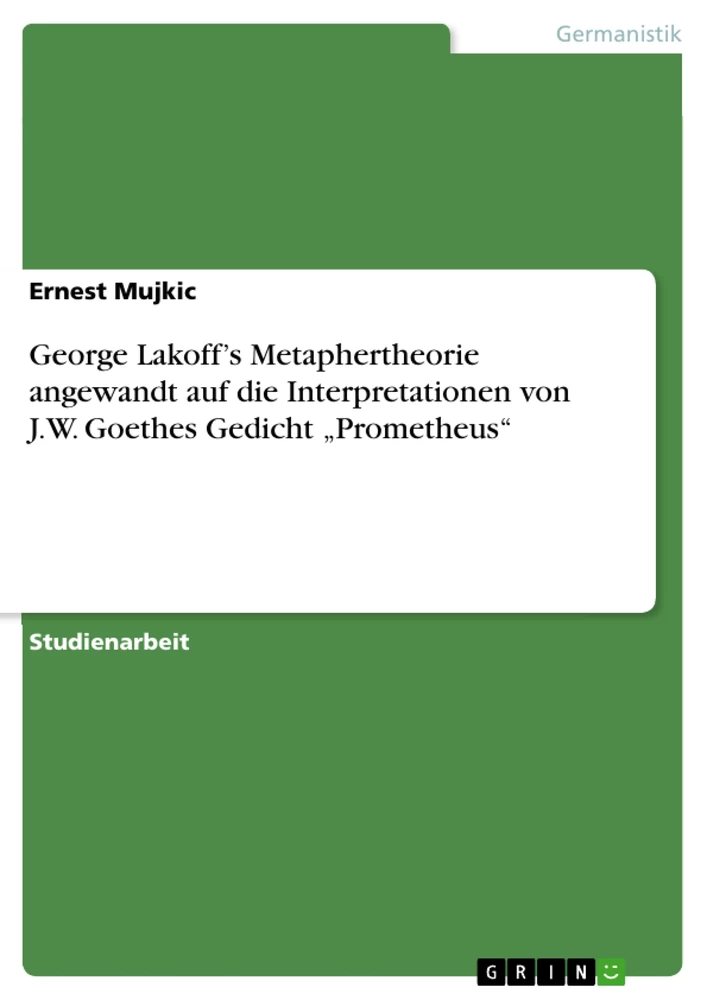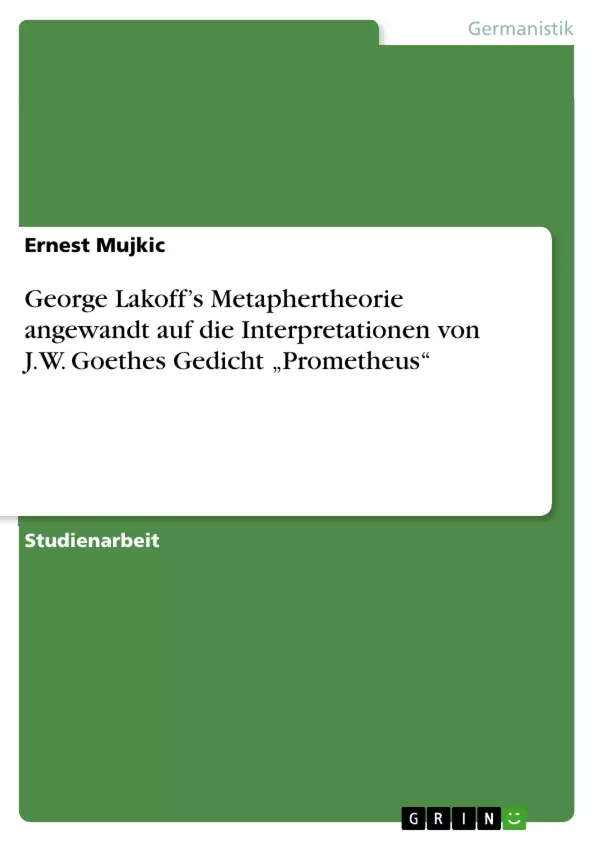Lakoff, Johnson und Turner kritisieren die Position von Platon und Hobbes sowie zahlreichen anderen Vertreter der These, dass metaphorisches Denken die Wirklichkeit nicht wiedergebe. Dabei zeigen sie auf, interessanterweise in gewisser Hinsicht auf die von Platon in seiner Dichterkritik formulierte Wirkung der Herstellung von Beziehungen durch Metaphern zurückgreifend, dass Metaphern die zentrale Funktion innerhalb der Sprache zukommt, nämlich die Wirklichkeit zu strukturieren. Da Menschen mit Metaphern auf Wirklichkeiten bzw. auf die Erfahrungen von Dingen zurückgreifen und zwischen diesen Bezüge herstellen, gehöre das Sprechen in Metaphern zur Tiefenstruktur der Wirklichkeits-wahrnehmung und –Konstruktion von Menschen. Die Metaphern, so Lakoff und Johnson, seien unter anderem auch ein besonders wichtiges Verfahren der Politik, die durch Hervorhebung des einen Erfahrungsaspekts stets die Exklusion des anderen und damit eine neue (Be-)Deutung der Wirklichkeit zu bewirken sucht , d.h. auch die Gründungsmythen der politischen Philosophen Platon und Hobbes sind als Metaphern im doppelten Sinn zu bezeichnen: zum einen als Beschreibungsform und zum anderen als Konstruktionswerkzeug gesellschaftlich-politischer Ordnungen.
In der vorliegenden Arbeit wird deshalb der Versuch unternommen, die empirische Praktikabilität der theoretischen Annahmen zu Metaphern aufzuzeigen. Ausgehend von der Darstellung der theoretischen Grundannahmen zur Bildung von konventionellen Metaphern in George Lakoff’s und Mark Johnson’s Werk Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern (Kap. 2) sowie der theoretischen Diskussion zur Bildung von poetischen Metaphern im Werk von Lakoff und Turner More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor (Kap. 3), werden die metaphorischen Annahmen verschiedener Interpretationen zu Goethes Gedicht Prometheus untersucht (Kap. 4). Das Ziel ist zu überprüfen, ob Lakoff, Johnson und Turner mit ihrer Annahme, dass grundsätzlich alle Metaphern nur deshalb und nur dann verstanden werden können, weil bzw. wenn sie vor dem Hintergrund ihres empi-rischen Erfahrungsgehalts gedeutet werden, ein theoretisches Gerüst für das Verstehen der poetischen Metaphern bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Die Wirklichkeit der Metapher
- Die Wirkungsmacht des „metaphorischen Konzept“
- Bildung von metaphorischen Konzepten
- Das menschliche Verstehen als metaphorischer Prozess
- Poetische Metaphern
- Die Bildung von poetischen Metaphern
- Kreative Metapher als Ergebnis der Poetisierung der konventionellen Metapher
- Interpretationen zu Goethes Gedicht „Prometheus“
- Barbara Neymeyrs Interpretationsansatz
- Peter Müllers Interpretationsansatz
- David E. Wellberys Interpretationsansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die empirische Praktikabilität der theoretischen Annahmen zu Metaphern im Kontext von Goethes Gedicht „Prometheus“. Dabei wird die Theorie von George Lakoff und Mark Johnson, wie konventionelle Metaphern gebildet werden, auf die Interpretationen des Gedichts angewendet. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Lakoff, Johnson und Turner mit ihrer Annahme, dass Metaphern vor dem Hintergrund ihrer empirischen Erfahrungsbasis verstanden werden, ein theoretisches Gerüst für das Verstehen poetischer Metaphern liefern können.
- Die Rolle von Metaphern in der Wahrnehmung und Konstruktion der Wirklichkeit
- Die Bildung von metaphorischen Konzepten und ihre Bedeutung für das menschliche Denken und Handeln
- Die Anwendung der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson auf die Interpretation von poetischen Texten
- Die Interpretation des Gedichts „Prometheus“ im Lichte verschiedener Ansätze
- Die Frage, ob das Verständnis von Metaphern von ihrem empirischen Erfahrungsgehalt abhängt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Wirklichkeit der Metapher
Dieses Kapitel beleuchtet die Kritik an Metaphern durch Platon und Hobbes, die Metaphern als Ausdruck der Rhetorik ansehen, die die Wahrheit nur nachahmen kann. Lakoff, Johnson und Turner hingegen argumentieren, dass Metaphern die zentrale Funktion innerhalb der Sprache haben, die Wirklichkeit zu strukturieren. Sie greifen auf die von Platon in seiner Dichterkritik formulierte Wirkung der Herstellung von Beziehungen durch Metaphern zurück und betonen, dass Metaphern die Tiefenstruktur der Wirklichkeitswahrnehmung und -Konstruktion von Menschen bilden.
Die Wirkungsmacht des „metaphorischen Konzept“
Bildung von metaphorischen Konzepten
Lakoff und Johnson widerlegen die These, dass metaphorische Sprache unabhängig von menschlicher Wahrnehmung und Denken betrachtet werden kann. Sie argumentieren, dass das metaphorische Sprechen mit unserer Wahrnehmung, unserem Denken und Handeln strukturell zusammenhängt. Metaphorisches Sprechen ist demnach ein Ausdruck des metaphorischen Denkens, das wiederum zeigt, dass Menschen durch metaphorische Wahrnehmung das Wahrgenommene verstehen können.
Das menschliche Verstehen als metaphorischer Prozess
Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept des „metaphorischen Konzept“, welches beschreibt, wie Menschen eine Sache oder einen Vorgang in Begriffen einer anderen Sache oder eines anderen Vorgangs verstehen und erfahren. Lakoff und Johnson betonen, dass metaphorische Konzepte als Strukturierungsinstrumente menschlicher Wahrnehmung zu verstehen sind, die sich auch im Handeln niederschlagen. Ein Beispiel dafür ist das metaphorische Konzept „Argumentieren ist Krieg“, welches sowohl die Art und Weise beschreibt, wie Menschen über Sachverhalte sprechen, als auch Einfluss auf die Art und Weise hat, wie sie über bestimmte Sachverhalte argumentieren.
Schlüsselwörter
Metapher, Metapherntheorie, George Lakoff, Mark Johnson, konventionelle Metaphern, poetische Metaphern, Interpretation, Gedicht, Goethe, Prometheus, Wirklichkeitswahrnehmung, metaphorische Konzepte, empirischer Erfahrungsgehalt.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt George Lakoffs Metaphertheorie?
Lakoff argumentiert, dass Metaphern nicht nur schmückendes Beiwerk der Sprache sind, sondern unsere gesamte Wirklichkeitswahrnehmung und unser Denken strukturieren.
Wie hängen Metaphern mit empirischer Erfahrung zusammen?
Laut Lakoff und Johnson verstehen wir abstrakte Konzepte nur deshalb, weil wir sie auf körperliche und empirische Grunderfahrungen zurückführen (z. B. "Argumentieren ist Krieg").
Was ist ein "metaphorisches Konzept"?
Es ist ein mentales Werkzeug, mit dem wir eine Sache in Begriffen einer anderen verstehen, was sich direkt in unserem Handeln und Sprechen niederschlägt.
Wie wird die Theorie auf Goethes "Prometheus" angewendet?
Die Arbeit untersucht, ob die poetischen Metaphern im Gedicht vor dem Hintergrund ihrer empirischen Erfahrungsbasis gedeutet werden können und wie verschiedene Interpreten dies umsetzen.
Warum kritisierte Platon Metaphern?
Platon sah in Metaphern eine Form der rhetorischen Nachahmung, die die eigentliche Wahrheit eher verschleiere als wiederzugeben.
- Quote paper
- Ernest Mujkic (Author), 2011, George Lakoff’s Metaphertheorie angewandt auf die Interpretationen von J.W. Goethes Gedicht „Prometheus“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188266