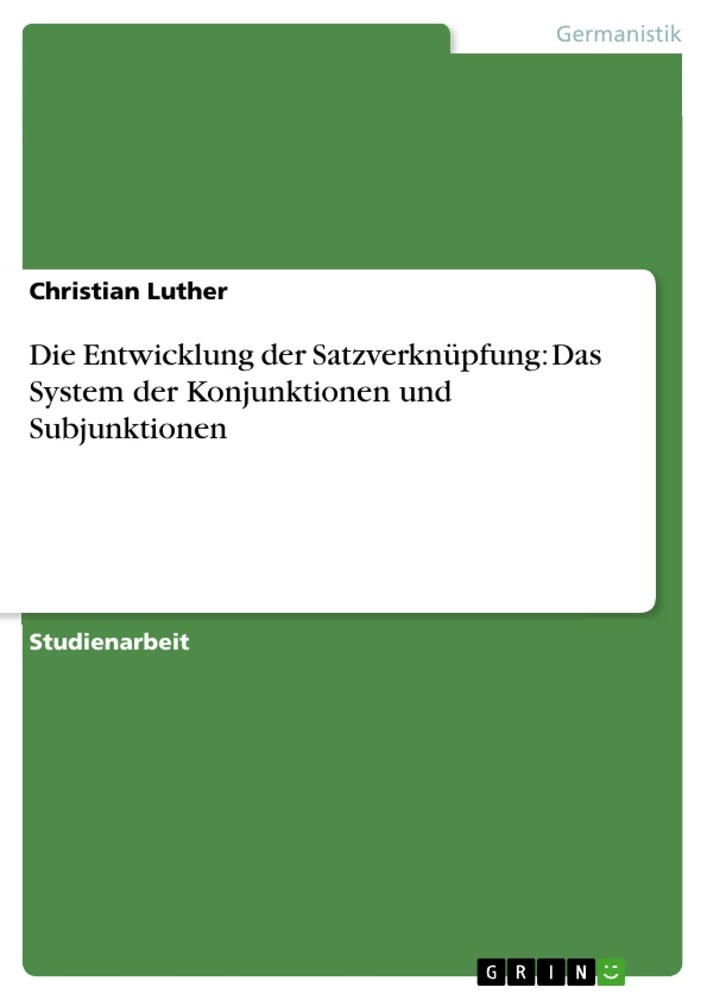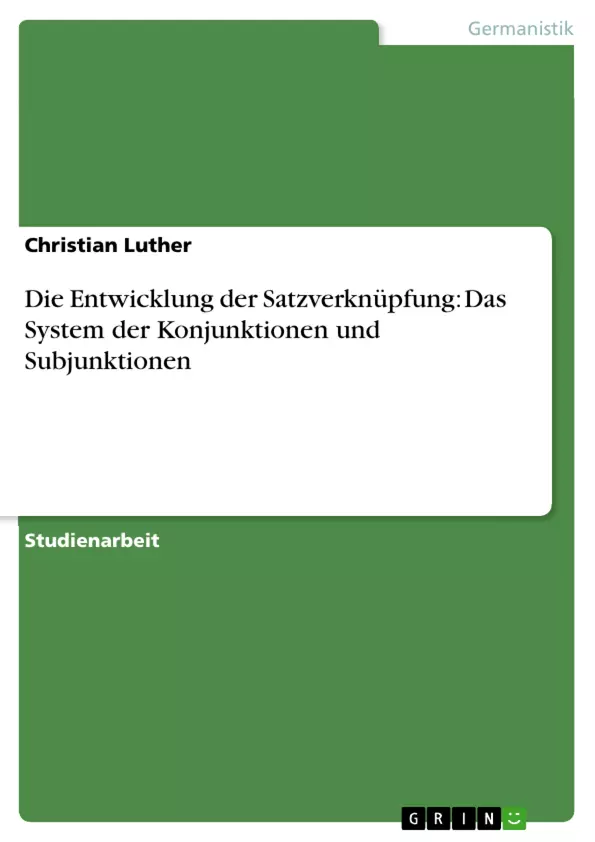Die folgende Arbeit mit dem Thema „Die Entwicklung der Satzverknüpfung: Das System der Konjunktionen und Subjunktionen “ entstand im Sommersemester 2011 im Seminar „Historische Varietäten des Deutschen“ bei Prof. Dr. Hans Ulrich Schmid und baut auf dem Referat im gleichnamigen Kolloquium auf.
Sie wird durch vier Bereiche thematisch voneinander getrennt. Im Grundlagenteil, der sich wiederum in zwei Teile untergliedert, werden Entwicklungen vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen thematisiert, die für das Verständnis des Umbaus des Subjunktionssystems nötig sind. In einem zweiten Schritt wird hier auf die Klasse der Konjunktion und Subjunktionen eingegangen und der Begriff definitorisch abgesteckt.
Der Hauptteil der Arbeit besteht in einem ersten Schritt aus der Darstellung der Ausgangslage als Grundlage der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Daran schließt sich die Betrachtung der Veränderungen im System an. Dies geschieht unter dem Rückgriff auf heutige Verhältnisse im heutigen System. Es ist klar, dass dies im Rahmen der Arbeit nur exemplarisch geschehen kann. Daher legt die Arbeit den Fokus im weiteren Verlauf auf drei Prozesse, die innerhalb der Neustrukturierung des Systems der Konjunktionen und Subjunktionen zu beobachten sind – Abbau von Polyfunktionalität, Univerbierung und den Wechsel der semantischen Kategorie am Beispiel der Konjunktion weil.
Den dritten Teil der Arbeit bildet die Hinterfragung der Ursachen für die Entwicklung bzw. Herausbildung des neu strukturierten Systems. Hier wird vor allem die Rolle der Schriftlichkeit eine wichtige Rolle spielen.
Den Schluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung der in der Arbeit vorgestellten Prozesse und Entwicklungen im Bereich der Konjunktionen und Subjunktionen.
An diesem Punkt bietet es sich an, auf nicht thematisierte Punkte der Arbeit Bezug zu nehmen, diese für die weitere Beschäftigung mit der Thematik anzureißen und somit Anreize für eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Rekapitulation 1: Entwicklungen vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen
- 2.2 Rekapitulation 2: Konjunktionen und Subjunktionen - koordinierend und subordinierend
- 3. Das System der Konjunktionen und Subjunktionen im Frühneuhochdeutschen
- 3.1 Ausgangslage im Althochdeutschen/Mittelhochdeutschen
- 3.2 Veränderungen zum Frühneuhochdeutschen
- 3.2.1 Abbau von Polyfunktionalität
- 3.2.2 Univerbierung
- 3.2.3 Wechsel der semantischen Kategorie am Beispiel weil (von der temporalen zur kausalen Konjunktion)
- 4. Ursachen?
- 5. Zusammenfassung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Satzverknüpfung im Frühneuhochdeutschen, insbesondere das System der Konjunktionen und Subjunktionen. Sie analysiert die Veränderungen im System ausgehend von der Ausgangslage im Althochdeutschen/Mittelhochdeutschen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Entwicklungsprozesse und der Erforschung möglicher Ursachen.
- Entwicklung des Systems der Konjunktionen und Subjunktionen vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen
- Analyse von Veränderungen wie dem Abbau von Polyfunktionalität, Univerbierung und semantischen Kategoriewechseln
- Untersuchung der syntaktischen Veränderungen im Frühneuhochdeutschen und deren Einfluss auf die Satzverknüpfung
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Konjunktion und Subjunktion
- Diskussion möglicher Ursachen für die beobachteten Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie gliedert sich in vier Teile: Grundlagen (Entwicklungen vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen und Definition von Konjunktion und Subjunktion), Ausgangslage und Veränderungen im System der Konjunktionen und Subjunktionen, Ursachen der Entwicklung und abschließende Zusammenfassung. Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale Prozesse: Abbau von Polyfunktionalität, Univerbierung und den semantischen Wandel bei der Konjunktion „weil“.
2. Grundlagen: Dieser Abschnitt legt die Basis für die weitere Analyse. Erstens wird ein Überblick über die Entwicklungen vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen gegeben, insbesondere die syntaktischen Veränderungen, wie den Ausbau der Nominal- und Verbalgruppen, die Differenzierung syntaktischer Strukturen und die zunehmende formale Unterscheidung von Haupt- und Nebensätzen. Zweitens werden die Begriffe „Konjunktion“ und „Subjunktion“ definiert, wobei auf ihre Funktion als Bindemittel, ihre semantischen und syntaktischen Eigenschaften und ihre morphologische Unflektierbarkeit eingegangen wird. Die Vielfältigkeit der Ursprünge der Konjunktionen wird ebenfalls erwähnt.
3. Das System der Konjunktionen und Subjunktionen im Frühneuhochdeutschen: Dieser zentrale Teil der Arbeit beginnt mit der Darstellung der Ausgangslage im Althochdeutschen/Mittelhochdeutschen. Anschließend werden die Veränderungen im System detailliert beschrieben, unter anderem der Abbau der Polyfunktionalität von Konjunktionen, der Prozess der Univerbierung und der semantische Wandel am Beispiel von „weil“, der von einer temporalen zu einer kausalen Konjunktion wechselte. Die Analyse vergleicht dabei auch mit dem modernen Sprachgebrauch.
4. Ursachen?: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Ursachen der beschriebenen Entwicklungen im System der Konjunktionen und Subjunktionen. Die Rolle der Schriftlichkeit wird hierbei als besonders wichtig hervorgehoben, obwohl weitere Faktoren implizit angesprochen werden.
Schlüsselwörter
Frühneuhochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Satzverknüpfung, Konjunktionen, Subjunktionen, Syntax, Polyfunktionalität, Univerbierung, semantischer Wandel, Schriftlichkeit.
FAQ: Entwicklung der Satzverknüpfung im Frühneuhochdeutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Satzverknüpfung im Frühneuhochdeutschen, insbesondere das System der Konjunktionen und Subjunktionen. Sie analysiert Veränderungen im System vom Althochdeutschen/Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen und erforscht mögliche Ursachen dieser Entwicklungen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Beschreibung der Entwicklungsprozesse und die Erforschung möglicher Ursachen. Im Detail werden folgende Aspekte behandelt: der Abbau von Polyfunktionalität bei Konjunktionen, der Prozess der Univerbierung und semantische Kategoriewechsel (am Beispiel von „weil“). Die Arbeit beleuchtet auch die syntaktischen Veränderungen im Frühneuhochdeutschen und deren Einfluss auf die Satzverknüpfung sowie die Definition und Abgrenzung der Begriffe Konjunktion und Subjunktion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Grundlagen, die detaillierte Analyse des Systems der Konjunktionen und Subjunktionen im Frühneuhochdeutschen, einen Abschnitt zu den Ursachen der Entwicklung und eine Zusammenfassung. Die Einleitung beschreibt den Aufbau der Arbeit und die Zielsetzung. Die Grundlagen wiederholen kurz die Entwicklungen vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen und definieren die Begriffe Konjunktion und Subjunktion. Der Hauptteil analysiert die Veränderungen im System der Konjunktionen und Subjunktionen. Der Abschnitt zu den Ursachen diskutiert mögliche Gründe für die beobachteten Entwicklungen, wobei die Rolle der Schriftlichkeit besonders hervorgehoben wird.
Welche Veränderungen im System der Konjunktionen und Subjunktionen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Abbau der Polyfunktionalität von Konjunktionen, den Prozess der Univerbierung und semantische Kategoriewechsel. Als Beispiel für einen semantischen Wandel wird die Entwicklung der Konjunktion „weil“ von einer temporalen zu einer kausalen Konjunktion untersucht.
Welche Rolle spielt die Schriftlichkeit?
Die Rolle der Schriftlichkeit wird im Abschnitt zu den Ursachen der Entwicklungen als besonders wichtig hervorgehoben, obwohl weitere Faktoren implizit angesprochen werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Frühneuhochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Satzverknüpfung, Konjunktionen, Subjunktionen, Syntax, Polyfunktionalität, Univerbierung, semantischer Wandel, Schriftlichkeit.
Welche Rekapitulationen werden im Grundlagenteil gegeben?
Der Grundlagenteil beinhaltet zwei Rekapitulationen: Erstens eine Rekapitulation der Entwicklungen vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen und zweitens eine Rekapitulation zu Konjunktionen und Subjunktionen – koordinierend und subordinierend.
Wie wird die Ausgangslage beschrieben?
Die Ausgangslage wird im Kapitel zum System der Konjunktionen und Subjunktionen im Frühneuhochdeutschen beschrieben. Dieser Abschnitt beschreibt die Situation im Althochdeutschen/Mittelhochdeutschen als Ausgangspunkt für die Analyse der Veränderungen zum Frühneuhochdeutschen.
Wie wird der moderne Sprachgebrauch berücksichtigt?
Die Analyse im Hauptteil vergleicht die Entwicklungen im Frühneuhochdeutschen auch mit dem modernen Sprachgebrauch.
- Citar trabajo
- B.A. Christian Luther (Autor), 2011, Die Entwicklung der Satzverknüpfung: Das System der Konjunktionen und Subjunktionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188280