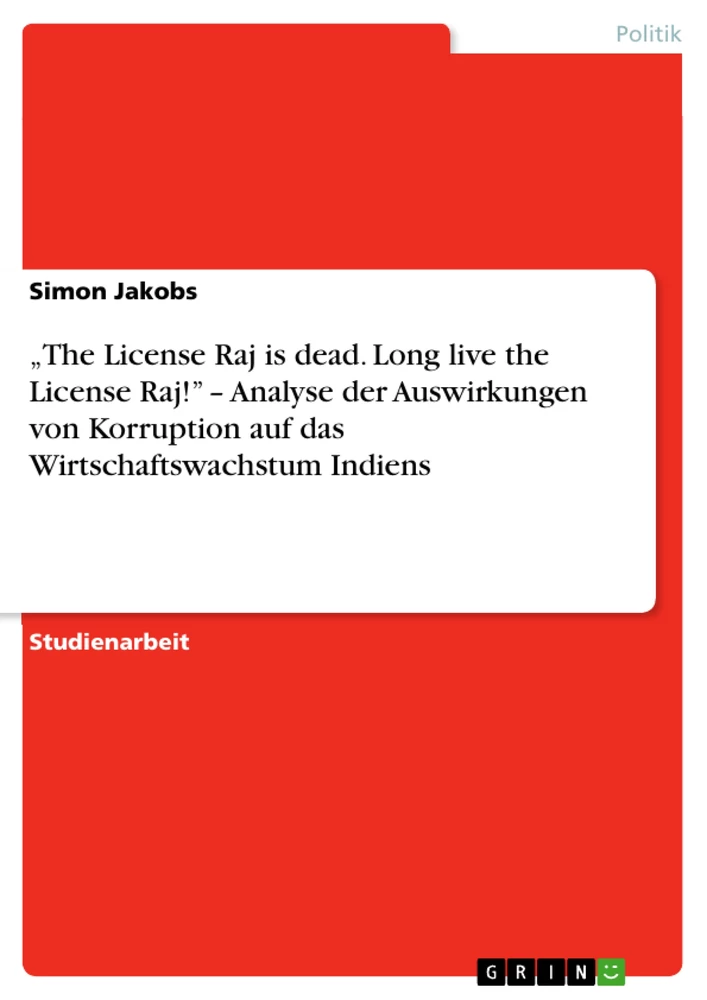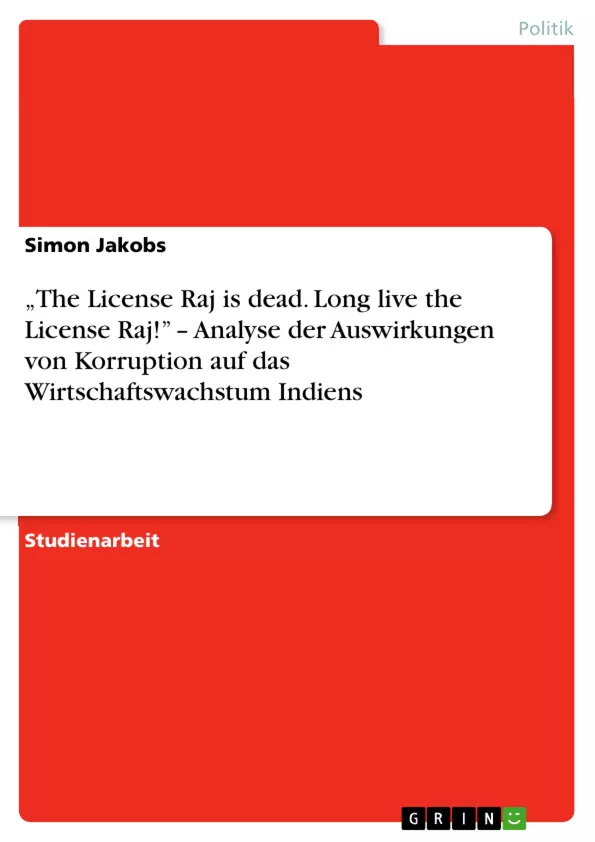Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem weit gefassten Thema der Korruption in Indien. Wie vor allem in jüngster Zeit bekannt wurde, ist das Land geprägt von spektakulären Bestechungsfällen, korrupten Bürokraten und einem überfrachteten, ineffektiven Verwal-tungsapparat. Dennoch folgt Indien seit der Liberalisierung im Jahre 1991 einem stetigen Wachstumstrend und wird nach China als der BRIC-Staat angesehen, der bis zum Jahr 2050 die USA als nächststärkere Wirtschaftsmacht überholen kann1. Auf der anderen Seite jedoch ist das Land durch weit verbreitete Armut und ein schlechtes Bildungs- und Gesundheitssys-tem gekennzeichnet, wobei nicht wenige Forscher gerade dafür die schon angesprochene Kor-ruption als Ursache der sich immer weiter vergrößernden Einkommensschere in Indien sehen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die direkten Auswirkungen der Korruption in Indien zu untersuchen und dabei zu erfragen, ob diese das Wirtschaftswachstum auch in Zukunft nachhaltig behin-dern kann. Die dabei aufgestellten Hypothesen sind zum einen, dass Korruption in Indien nur deshalb zum Tagesgeschäft gehört, da das bis 1991 bestehende planwirtschaftliche „licence-raj-System“ den optimalen Nährboden dafür bot und Korruption zu einem gängigen und legi-timen Mittel zur Beschleunigung planwirtschaftlich gelenkter Verfahren machte, Korruption also quasi ein kulturelles ‚Erbe‘ in Indien darstellt. Zum anderen wird die Hypothese aufge-stellt, dass es sich bei der in Indien gängigen Form der Korruption um eine wachstumsfeindli-che handelt, diese also Wachstum nachhaltig mindern wird und die indische Regierung im Gegenzug konsequent Anti-Korruptions-Maßnahmen vorantreiben muss. Zur Klärung dieser Fragen wird in einem ersten Schritt eine genaue Untersuchung des Begriffs ‚Korruption‘ an-gestellt, woraufhin dann die Fallstudie ‚Korruption in Indien‘ folgt, in der geklärt werden soll, welche Art der Korruption in Indien vorherrscht, wer von ihr in besonderem Maße betroffen ist und welche Auswirkungen sie auf das Wirtschaftswachstum hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Korruption - ein facettenreicher Begriff
- Arten der Korruption und ihre Messbarkeit
- Gründe für korruptes Verhalten
- Direkte Auswirkungen von Korruption
- Direkte Auswirkungen von Korruption auf das Wirtschaftswachstum
- Direkte Auswirkungen von Korruption auf FDI und Investoren
- Direkte Auswirkungen von Korruption auf public services
- Direkte Auswirkungen von Korruption auf Armutsbekämpfung
- Fallstudie: Korruption in Indien
- Das Erbe des licence-raj-Systems
- Versuch einer Messung und Erklärungsansätze für die Korruption in Indien
- Auswirkungen der Korruption in Indien
- Jüngere Fallbeispiele in Indien und ihre mediale Bedeutung
- Betroffene Bevölkerungsschichten und vorherrschende Art von Korruption in Indien
- Direkte Auswirkungen der Korruption in Indien für Investoren und FDI
- Diskussion: Warum stetige Wachstumsraten und florierende Korruption in Indien kein Paradox darstellen
- Lösungsvorschläge
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen von Korruption auf das Wirtschaftswachstum Indiens. Das Ziel der Arbeit ist es, die direkten Auswirkungen der Korruption in Indien zu untersuchen und zu erfragen, ob diese das Wirtschaftswachstum auch in Zukunft nachhaltig behindern kann.
- Die Auswirkungen von Korruption auf das Wirtschaftswachstum Indiens.
- Die Rolle des „licence-raj-Systems“ für die Verbreitung von Korruption in Indien.
- Die verschiedenen Arten von Korruption in Indien und deren Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsschichten.
- Die Bedeutung von Anti-Korruptions-Maßnahmen für das Wirtschaftswachstum Indiens.
- Die Frage, ob stetige Wachstumsraten und florierende Korruption in Indien ein Paradox darstellen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Korruption in Indien vor und skizziert die Zielsetzung, die Hypothese und den Aufbau der Untersuchung. Sie beleuchtet den Widerspruch zwischen dem stetigen Wirtschaftswachstum Indiens und der weit verbreiteten Korruption.
- Korruption - ein facettenreicher Begriff: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse des Korruptionsbegriffs. Es werden verschiedene Arten von Korruption definiert, ihre Messbarkeit diskutiert und Gründe für korruptes Verhalten aufgezeigt. Außerdem werden die direkten Auswirkungen von Korruption auf das Wirtschaftswachstum, FDI, öffentliche Dienstleistungen und die Armutsbekämpfung beleuchtet.
- Fallstudie: Korruption in Indien: Dieses Kapitel befasst sich mit der spezifischen Situation der Korruption in Indien. Es analysiert das Erbe des „licence-raj-Systems“, untersucht verschiedene Mess- und Erklärungsansätze für die Korruption in Indien und beleuchtet die Auswirkungen der Korruption auf das Land. Hierbei werden auch jüngere Fallbeispiele sowie die betroffenen Bevölkerungsschichten und die Auswirkungen auf Investoren und FDI beleuchtet. Zudem wird diskutiert, ob stetige Wachstumsraten und florierende Korruption ein Paradox darstellen. Abschließend werden Lösungsvorschläge zur Bekämpfung der Korruption in Indien aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Korruption, Wirtschaftswachstum, Indien, „licence-raj-System“, FDI, Investoren, öffentliche Dienstleistungen, Armutsbekämpfung, Anti-Korruptions-Maßnahmen und Paradox.
Häufig gestellte Fragen
Was war das "Licence-Raj-System" in Indien?
Es war ein bis 1991 bestehendes planwirtschaftliches System von Lizenzen und bürokratischen Hürden, das als idealer Nährboden für Korruption gilt.
Behindert Korruption das Wirtschaftswachstum Indiens nachhaltig?
Die Arbeit untersucht, ob die gängige Form der Korruption wachstumsfeindlich ist und trotz aktueller Erfolge das Potenzial hat, Indiens Aufstieg zur Weltwirtschaftsmacht zu bremsen.
Warum wächst Indien trotz hoher Korruption so stark?
Die Arbeit diskutiert dieses scheinbare Paradoxon und analysiert, warum stetige Wachstumsraten und florierende Korruption in Indien nebeneinander existieren können.
Welche Auswirkungen hat Korruption auf ausländische Direktinvestitionen (FDI)?
Korruption wirkt oft als versteckte Steuer, die Investitionskosten erhöht, Unsicherheit schafft und potenzielle Investoren abschrecken kann.
Wer ist in Indien am stärksten von Korruption betroffen?
Besonders betroffen sind die ärmeren Bevölkerungsschichten, da Korruption den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen erschwert und die Armutsbekämpfung behindert.
- Quote paper
- Simon Jakobs (Author), 2011, „The License Raj is dead. Long live the License Raj!” – Analyse der Auswirkungen von Korruption auf das Wirtschaftswachstum Indiens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188300