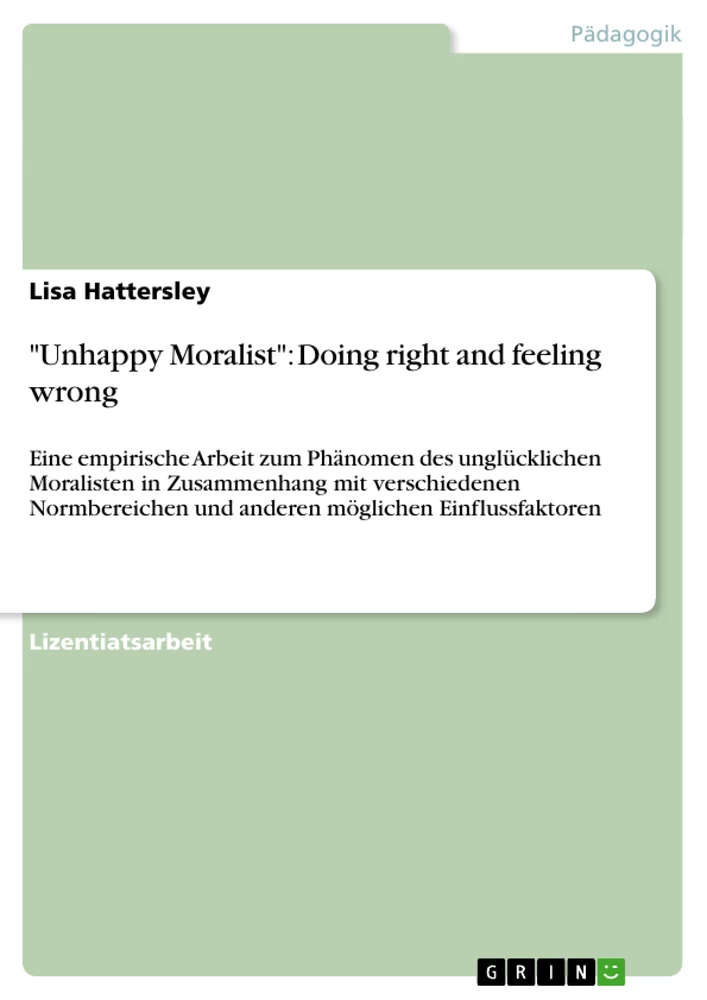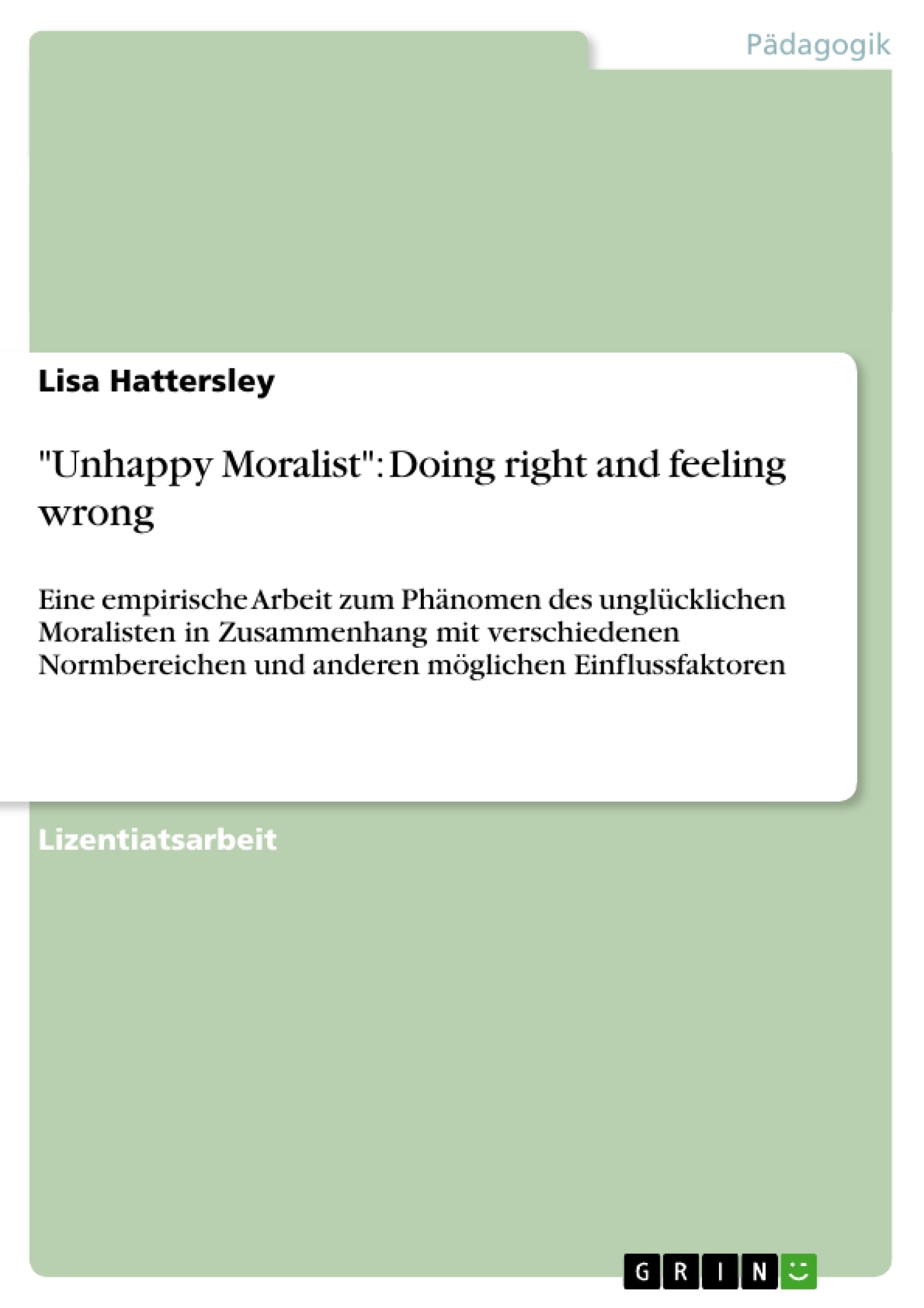In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie man sich fühlt, wenn man in unterschiedlichen Normbereichen moralisch handelt und dabei ein persönliches Bedürfnis oder einen potentiellen Profit in den Hintergrund stellt. Ausgehend von Nunner-Winklers (z.B. 1989, 1993) Untersuchungen und den Befunden von Oser und Reichenbach (2000) nimmt die vorliegende Arbeit an, dass eine Person, die dem moralisch Korrekten den Vorrang vor ihren persönlichen Bedürfnissen gibt, mit der Situation unzufrieden sein wird. Ferner wird vermutet, dass diese Unzufriedenheit mit der Stärke der einzuhaltenden Norm zusammenhängt. Gewisse Normen werden ohne weiteres befolgt und ihre Befolgung ruft kein unangenehmes Gefühl hervor. Andere hingegen werden befolgt, was moralisch gesehen „richtig“ ist, man fühlt sich dabei oder danach jedoch schlecht.
Die beiden Ausgangspunkte dieser Arbeit sind einerseits die Annahme von Oser und Reichenbach (2000), dass es ein Phänomen des „unhappy moralist“ gibt, und andererseits Normen im Allgemeinen bzw. verschiedene Normbereiche. Anhand des Scheidungsfalls „Winter gegen Winter“, den Oser und Reichenbach mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihrer Verhandlungskurse durchspielten, wurde festgestellt, dass diejenigen Personen, die sich moralisch verhielten, oft mit dem Ergebnis ihres Handelns unzufrieden waren. Offensichtlich reicht das Wissen, moralisch oder korrekt gehandelt zu haben nicht aus, um die Unzufriedenheit über den eingebüssten Profit oder Erfolg in den Hintergrund zu rücken. Diese Befunde führten Oser und Reichenbach (2000, 218ff) zu der Vermutung, dass es komplementär zu Nunner-Winklers „happy victimizer“ einen „unhappy moralist“ gibt.
Als Anstoss für den zweiten Ausgangspunkt, die verschiedenen Normgruppen, diente das Bereichsmodell des moralischen Tuns nach Garz (1999). Garz nimmt eine Unterteilung der Alltagsnormen in fünf Bereiche vor, unter anderem die Bereiche der starken und der schwachen Normen.
In der vorliegenden Arbeit sollen nun einige der noch ungeklärten Aspekte und Umstände des „unhappy moralist“ Phänomens aufgegriffen und untersucht werden. Folgende Fragen liegen der Arbeit zugrunde: Innerhalb welcher Normbereiche kommt das Phänomen des „unhappy moralist“ vor? Gibt es Unterschiede bezüglich schwacher und starker Normen? Sind innerhalb der schwachen Normen weitere Unterschiede zu finden? Welche weiteren Einflussfaktoren auf das Phänomen des „unhappy moralist“ sind nebst dem Einfluss der Normbereiche denkbar?
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Grundlagen des “unhappy moralist” Phänomens
1.1 Definition von Moral
1.2 Nunner-Winkler: „The happy victimizer phenomenon”
1.3 Oser und Reichenbach: „Unhappy moralist“: Das Phänomen des unglücklichen Moralisten
1.4 Zusammenfassung und weiterführende Gedanken
2 Emotionen und der „unhappy moralist“
2.1 Annäherung an den Begriff „Emotion“
2.2 Glück oder Zufriedenheit?: Zum „unhappy“ im „unhappy moralist“
2.3 Die wichtigsten moralischen Emotionen
2.3.1 Empathie - oder die Anteilnahme an den Emotionen anderer
2.3.2 Empörung - oder der Schuldvorwurf gegenüber anderen
2.3.3 Scham - oder die Erschütterung des Selbst
2.3.4 Schuld - oder der Schuldvorwurf an sich selbst
2.4 Zusammenfassung und Relevanz von Emotionen für das Phänomen des „unhappy moralist“
3 Normen und der „unhappy moralist“
3.1 Allgemeine Definition von Normen
3.2 Exkurs: Verschiedene Sichtweisen des Normbegriffs je nach Fachgebiet...
3.2.1 Philosophischer Exkurs - Kategorischer Imperativ vs. Utilitarismus
3.2.2 Soziologischer Exkurs
3.2.3 Psychologischer Exkurs
3.2.4 Rechtlicher Exkurs - Normen aus der Sicht der „Theorie des Rechts“ nach Koller
3.2.5 Zusammenfassung
3.3 Garz: Bereichsmodell des moralischen Tuns
3.4 Moralische, rechtliche, schwache und starke Normen
3.4.1 Moralische vs. rechtliche Normen und ihre weitere Unterteilung in Anlehnung an die Domänen-Theorie
3.4.2 Starke vs. schwache Normen
3.4.3 Zusammenfassung der Normbereiche: Moralisch-rechtliche / nonmoralisch rechtliche / non-rechtlich moralische Normen, starke / schwache Normen und der „unhappy moralist“
4 „Unhappy moralist“: Weitere potentielle Einflüsse - von der moralischen Urteilsstufe über moralische Bilanz zu sozialem Vergleich und Persönlichkeit
4.1 Moralische Urteilsentwicklung, moralisches Urteil und Handeln
4.1.1 Theorie der Entwicklung des moralischen Urteils nach Kohlberg
4.1.2 Moralische Motivation nach Nunner-Winkler
4.1.3 Moralisches Urteil und moralisches Handeln - Modelle des UrteilHandlungs-Zusammenhangs
4.2 Nisan: Das Modell der moralischen Bilanz - Ein Beitrag zum Phänomen des „unhappy moralist“
4.2.1 Die moralische Entscheidung
4.2.2 Moralische Bilanz, starke / schwache Normen und das Phänomen des „unhappy moralist“
4.3 Sozialer Vergleich
4.4 Persönlichkeitsmerkmale und ihr möglicher Einfluss
4.5 Zusammenfassung der für die vorliegende Arbeit zentralen Folgerungen...
5 Fragestellungen, Hypothesen und Annahmen
5.1 Fragestellungen, Hypothesen und Annahmen zur Beziehung des Phänomens des „unhappy moralist“ zu den Normbereichen
5.2 Fragestellungen, Hypothesen und Annahmen zu verschiedenen möglichen Einflussfaktoren auf das Phänomen des „unhappy moralist“
5.2.1 Fragestellungen, Hypothesen und Annahmen zum möglichen Einfluss der moralischen Bilanz nach Nisan
5.2.2 Fragestellungen, Hypothesen und Annahmen zum möglichen Einfluss des sozialen Vergleichs
5.2.3 Fragestellungen, Hypothesen und Annahmen zum möglichen Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen
5.2.4 Fragestellungen und Hypothesen zum möglichen Einfluss der moralischen Urteilsstufe nach Kohlberg
5.3 Hypothesenmodell
6 Methode
6.1 Die Stichprobenstruktur
6.2 Durchführung der Untersuchung
6.3 Die Erhebungsinstrumente
6.3.1 Eigener Fragebogen
6.3.1.1 Geschichten
6.3.1.2 Fragen
6.3.1.3 Testdurchlauf
6.3.2 Drei Skalen zur Psychischen Gesundheit (SPG) nach Tönnies, Plöhn & Krippendorf (1996)
6.3.3 Defining Issues Test (DIT) nach Rest (1979)
6.4 Prüfung der teststatistischen Qualität
6.4.1 Eigener Fragebogen
6.4.2 SPG (Tönnies, Plöhn & Krippendorf, 1996)
6.4.3 DIT (Rest, 1979)
7 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
7.1 Überprüfung der Hypothesen und deskriptive Befunde zu den Annahmen zur Beziehung des Phänomens des „unhappy moralist“ zu den Normbereichen
7.1.1 Deskriptive Befunde zu den Annahmen 1a und 1b
7.1.2 Überprüfung von Hypothese 1
7.1.3 Überprüfung von Hypothese 2
7.1.4 Deskriptive Befunde zu Annahme 2
7.1.5 Überprüfung von Hypothese 3
7.2 Überprüfung der Hypothesen und deskriptive Befunde zu den Annahmen zu verschiedenen möglichen Einflussfaktoren auf das Phänomen des „unhappy moralist“
7.2.1 Überprüfung der Hypothesen und Deskriptive Befunde zu den Annahmen zum möglichen Einfluss der moralischen Bilanz nach Nisan
7.2.1.1 Deskriptive Befunde zu den Annahmen 3a und 3b
7.2.1.2 Überprüfung von Hypothese 4
7.2.1.3 Deskriptive Befunde zu den Annahmen 4a und 4b
7.2.1.4 Überprüfung von Hypothese 5
7.2.2 Überprüfung der Hypothesen und Deskriptive Befunde zu den Annahmen zum möglichen Einfluss des sozialen Vergleichs
7.2.2.1 Deskriptive Befunde zu den Annahmen 5a und 5b
7.2.2.2 Überprüfung von Hypothese 6
7.2.2.3 Deskriptive Befunde zu den Annahmen 6a und 6b
7.2.2.4 Überprüfung von Hypothese 7
7.2.3 Überprüfung der Hypothese 8 zum möglichen Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen
7.2.3.1 Hypothese 8.1 und Subhypothesen
7.2.3.2 Hypothese 8.2 und Subhypothesen
7.2.3.3 Hypothese 8.3 und Subhypothesen
7.2.4 Überprüfung der Hypothesen zum möglichen Einfluss der moralischen Urteilsstufe nach Kohlberg
7.2.4.1 Hypothese 9
7.2.4.2 Hypothese 10
7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
8 Diskussion
8.1 Methodenkritische Diskussion
8.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
8.2.1 Interpretation und Diskussion zu den Hypothesen und Annahmen zur Beziehung des Phänomens des „unhappy moralist“ zu den Normbereichen
8.2.2 Interpretation und Diskussion zu den Hypothesen und Annahmen zu verschiedenen möglichen Einflussfaktoren auf das Phänomen des „unhappy moralist“
8.2.2.1 Interpretation und Diskussion zu den Hypothesen und Annahmen zum möglichen Einfluss der moralischen Bilanz
8.2.2.2 Interpretation und Diskussion zu den Hypothesen und Annahmen zum möglichen Einfluss des sozialen Vergleichs
8.2.2.3 Interpretation und Diskussion zu den Hypothesen zum möglichen Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen
8.2.2.4 Interpretation und Diskussion zu den Hypothesen zum möglichen Einfluss der moralischen Urteilsstufe nach Kohlberg
8.3 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
8.4 Abschliessende Kommentare zur Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
9 Reflexion über erzieherische Konsequenzen
Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang: Fragebogen
Einleitung
Wir alle werden im Alltag, im Leben und in der Erziehung immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen eine Entscheidung darüber getroffen werden muss, ob die moralische bzw. korrekte Handlung gewählt werden soll oder nicht. Verhält sich eine Person moralisch, wird sie entweder mit ihrer Wahl zufrieden sein, weil sie sich an ihr moralisches Wissen und ihre Grundsätze gehalten hat, oder sie wird unzufrieden sein, weil sie durch die moralische Wahl ihre Bedürfnisse zurückgestellt hat.
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie man sich fühlt, wenn man in unterschiedlichen Normbereichen moralisch handelt und dabei ein persönliches Bedürfnis oder einen potentiellen Profit in den Hintergrund stellt. Ausgehend von Nunner-Winklers (z.B. 1989, 1993) Untersuchungen und den Befunden von Oser und Reichenbach (2000) nimmt die vorliegende Arbeit an, dass eine Person, die dem moralisch Korrekten den Vorrang vor ihren persönlichen Bedürfnissen gibt, mit der Situation unzufrieden sein wird. Ferner wird vermutet, dass diese Unzufriedenheit mit der Stärke der einzuhaltenden Norm zusammenhängt. Gewisse Normen werden ohne weiteres befolgt und ihre Befolgung ruft kein unangenehmes Gefühl hervor. Andere hingegen werden befolgt, was moralisch gesehen „richtig“ ist, man fühlt sich dabei oder danach jedoch schlecht. Wie würde ich mich beispielsweise fühlen, wenn ich eine im Ausland erhaltene Busse - der nicht nachgegangen werden würde - bezahle, und zwar mit dem Geld, das ich eigentlich für ein neues Autoradio gespart hatte? Werde ich zufrieden sein, wenn ich den Verkäufer darauf hinweise, dass er mir anstatt auf einen Fr. 20 Geldschein auf einen Fr. 50 Geldschein Wechselgeld gegeben hat? Werde ich hingegen unzufrieden sein, dass ich heute trotz grosser Schulden keine Bank ausgeraubt habe?
Die beiden Ausgangspunkte dieser Arbeit sind einerseits die Annahme von Oser und Reichenbach (2000), dass es ein Phänomen des „unhappy moralist“ gibt, und andererseits Normen im Allgemeinen bzw. verschiedene Normbereiche.
Anhand des Scheidungsfalls „Winter gegen Winter“, den Oser und Reichenbach mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihrer Verhandlungskurse durchspielten, wurde festgestellt, dass diejenigen Personen, die sich moralisch verhielten, oft mit dem Ergebnis ihres Handelns unzufrieden waren. Sie glaubten, weniger erreicht zu haben, als erwartet oder möglich gewesen wäre. Offensichtlich reicht das Wissen, moralisch oder korrekt gehandelt zu haben nicht aus, um die Unzufriedenheit über den eingebüssten Profit oder Erfolg in den Hintergrund zu rücken. Diese Befunde führten Oser und Reichenbach (2000, 218ff) zu der Vermutung, dass es komplementär zu Nunner-Winklers „happy victimizer“ einen „unhappy moralist“ gibt. Als Anstoss für den zweiten Ausgangspunkt, die verschiedenen Normgruppen, diente das Bereichsmodell des moralischen Tuns nach Garz (1999). Garz nimmt eine Unterteilung der Alltagsnormen in fünf Bereiche vor, unter anderem die Bereiche der starken und der schwachen Normen. Starke Normen sind klare Zwangsnormen, an die sich praktisch jede Person hält. Sie sind allgemein verbindlich und können bei einem Verstoss hohe Konsequenzen und Sanktionen zur Folge haben. Schwachen Normen wird hingegen nicht so viel Bedeutung beigemessen. In diesem Bereich sind oft kleinere Vergehen und Verstösse zu finden, die zu begehen man viel eher in Versuchung kommt, gerade weil auch die Konsequenzen in Kauf genommen werden können und somit dem Bedürfnis Vorrang gegeben werden kann.
In der vorliegenden Arbeit sollen nun einige der noch ungeklärten Aspekte und Umstände des „unhappy moralist“ Phänomens aufgegriffen und untersucht werden. Folgende Fragen liegen der Arbeit zugrunde: Innerhalb welcher Normbereiche kommt das Phänomen des „unhappy moralist“ vor? Gibt es Unterschiede bezüglich schwacher und starker Normen? Sind innerhalb der schwachen Normen weitere Unterschiede zu finden? Welche weiteren Einflussfaktoren auf das Phänomen des „unhappy moralist“ sind nebst dem Einfluss der Normbereiche denkbar?
Es wird unter anderem ausführlicher dem Einfluss der moralischen Bilanz nach Nisan (1986) nachgegangen. Das in dieser Arbeit eingehend behandelte Modell der moralischen Bilanz besagt, dass jede Person eine persönliche moralische Bilanz besitzt, die sich aus den guten und schlechten Handlungen der Person ergibt. Je günstiger, d.h. positiver die moralische Bilanz einer Person liegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich eine Übertretung oder einen Normbruch erlauben kann bzw. wird, ohne unter ihr persönlich akzeptables moralisches Mindestniveau zu fallen und umgekehrt. Daraus lässt sich die Annahme ableiten, dass je eher man sich ein Vergehen aufgrund der vorhandenen positiven moralischen Bilanz „leisten“ kann, dieses jedoch nicht ausübt und damit persönliche Bedürfnisse zurückstellt, desto unzufriedener wird man sein.
Als weitere potentielle Einflussfaktoren werden die moralische Urteilsstufe nach Kohlberg, der soziale Vergleich und Persönlichkeitsmerkmale untersucht.
Im theoretischen Teil der Arbeit soll zuerst das wissenschaftliche Fundament gelegt und der theoretische Hintergrund der Forschungsfragen erarbeitet werden. Im ersten Kapitel wird auf das Phänomen des „happy victimizer“ und auf das Phänomen des „unhappy moralist“ eingegangen, da die restliche Arbeit auf diesem Verständnis aufbaut und immer wieder auf das im Zentrum stehende Phänomen des „unhappy moralist“ Bezug nimmt. Das zweite Kapitel behandelt Emotionen und ihre Bedeutung für das Phänomen des „unhappy moralist“. Im dritten Kapitel wird ein weiterer Schwerpunktbereich dieser Arbeit beleuchtet: Normen und die für die vorliegende Arbeit relevanten Normbereiche, die wiederum mit dem Phänomen des „unhappy moralist“ in Beziehung gesetzt werden. Im vierten und letzten Kapitel des theoretischen Teils werden verschiedene weitere mögliche Einflussfaktoren auf das Phänomen des „unhappy moralist“ aufgegriffen: das moralische Urteil nach Kohlberg, Modelle des Urteil-Handlungs-Zusammenhangs, die moralische Bilanz nach Nisan als eines der Urteil-Handlungs-Modelle, der soziale Vergleich und Persönlichkeitsmerkmale.
Die weiteren Kapitel umfassen den empirischen Teil dieser Arbeit. Im fünften Kapitel werden zunächst die Fragestellungen, Hypothesen und Annahmen hergeleitet und vorgestellt. Im Anschluss daran wird im sechsten Kapitel die Methode mit der Stichprobe, der Durchführung der Untersuchung, den Erhebungsinstrumenten und der Prüfung der teststatistischen Qualität dargestellt. Danach folgen in Kapitel 7 die Auswertung und die Darstellung der Ergebnisse. Im achten Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert. Den Abschluss bildet ein Kapitel, in dem die erzieherischen Konsequenzen aufgegriffen werden.
1 Grundlagen des “unhappy moralist” Phänomens
In diesem Kapitel soll zunächst versucht werden, den Begriff „Moral“ zu definieren. Anschliessend wird auf das Phänomen des „happy victimizers“ eingegangen, um dann zur ausführlicheren Behandlung des angenommenen Phänomens des „unhappy moralist“ überzugehen.
1.1 Definition von Moral
Der Begriff „Moral“ ist vom lateinischen Wort „mos“ (moris) abgeleitet, was so viel bedeutet wie Sitte, Brauch, Gewohnheit oder Charakter. Seit dem 16. Jahrhundert wird „Moral“ als „sittliche Nutzanwendung; Sittlichkeit“ und seit dem 17. Jahrhundert zusätzlich als Synonym für „Sittenlehre“ verwendet (vgl. Heidbrink, 1991, 4).
Der Duden (Das grosse Fremdwörterbuch, 2003, 897) beschreibt Moral anhand der folgenden fünf Begriffsunterscheidungen:
1. „Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden.
2. (ohne Plur.) Stimmung, Kampfgeist; Bereitschaft, sich einzusetzen; Disziplin; gefestigte innere Haltung, Selbstvertrauen.
3. philos. Lehre von der Sittlichkeit.
4. das sittliche Verhalten eines Einzelnen od. einer Gruppe.
5. (ohne Plur.) lehrreiche Nutzanwendung.“
Für die vorliegende Arbeit sind v.a. der erste, der dritte und der vierte Punkt von Bedeutung. Die Punkte 2 und 5 können in diesem Zusammenhang ausser Acht gelassen werden. Bei Punkt 1 steht die verhaltensregulierende Funktion der Moral im Mittelpunkt. Bayertz (2002) zufolge bezeichnet der Begriff der Moral „ein System von Regeln, Idealen oder Tugenden, dessen Funktion v.a. darin besteht, Handlungen zu verhindern, die den elementaren Interessen anderer Menschen abträglich sind. Es gehört beispielsweise zu den elementaren Interessen jedes Individuums, nicht betrogen, nicht verletzt und nicht getötet zu werden; und aus genau diesem Grund verbietet es die Moral, andere Menschen zu betrügen, zu verletzen oder zu töten“ (Bayertz, 2002, 12f). Moral ist aus Sicherheitsgründen notwendig. Auch wenn moralische Regeln als Freiheitseinschränkung erlebt werden können, gewährleisten sie zugleich die Möglichkeit eines relativ sicheren Lebens (vgl. a. a. O., 22f). In der Definition wird Moral sowohl für die Normen einer Gesellschaft (Punkt 1) wie auch für die Moral eines Individuums (Punkt 4) verwendet. Da die Moral einer Person - ihr Verhalten, aber auch ihre moralischen Denk- und Bewusstseinsprozesse - nicht unabhängig von gesellschaftlichen Normen existiert, sind beide Sichtweisen notwendig. Die Normen und Regeln einer Gesellschaft oder eines Individuums hängen mit der jeweiligen Kultur, Land oder Religion zusammen. Moral im Sinne moralischen Bewusstseins und Verhaltens wird als individuelle Rekonstruktion gesellschaftlicher Moral aufgefasst. Folglich wird angenommen, dass sich moralisches Bewusstsein und moralisches Handeln in einem interaktiven Prozess zwischen Individuum und Umwelt entwickeln, und dass sich die moralischen Regeln, an denen wir uns orientieren, im Laufe des Lebens verändern (vgl. Heidbrink, 1991, 4f).
1.2 Nunner-Winkler: „The happy victimizer phenomenon”
Nunner-Winkler und Sodian haben im Rahmen einer von Weinert geleiteten Längsschnittstudie untersucht, welche Emotionen Kinder hypothetischen Übeltätern zuschreiben (vgl. Nunner-Winkler, 1989, 584). Ein Ziel der Untersuchung war es zu zeigen, dass die moralische Entwicklung ein zweistufiger Prozess ist. Wie später in Abschnitt 4.1.2 erläutert werden soll, widerlegt diese Annahme Kohlbergs Hypothese der kognitiv-affektiven Parallelität.
213 Kindern im Alter von 4-5 Jahren sowie je 20 4-, 6- und 8-jährigen Kindern wurden Bildergeschichten vorgelegt, in denen einfache moralische Regeln von einem Protagonisten übertreten werden, so z.B. Süssigkeiten eines anderen Kindes stehlen oder sein Getränk nicht mit einem durstigen Mitschüler teilen. Die Protagonisten in diesen Bildergeschichten haben also gleichzeitig ein Bedürfnis befriedigt und eine Norm übertreten. Anschliessend wurden die Kinder gefragt, wie sich der Protagonist fühlt, d.h. welche Emotionen sie dem Protagonisten attribuieren würden. Mit dieser Zuschreibung („Wie fühlt sich der Protagonist?“) wird ersichtlich, ob das Kind Regelübertretung oder Bedürfnisbefriedigung als bedeutungsvoller ansieht. Die Ergebnisse zeigten, dass jüngere Kinder dem Protagonisten positive Gefühle zuschrieben, obwohl sie wussten, dass Regeln nicht übertreten werden sollen. Etwa die Hälfte der Kinder im Alter von 6-7 Jahren und etwa 60% der 4-5-jährigen erwarteten, dass sich der Protagonist gut fühlen werde. Mehrheitlich glauben jüngere Kinder, dass sich eine Person gut fühlen wird, wenn sie genau das tut, was sie tun will, auch wenn dafür eine Regelübertretung in Kauf genommen werden muss. Entsprechend erwarten sie auch, dass sich eine Person schlecht fühlen wird, wenn sie nicht das tut, was sie will oder etwas tut, was sie nicht will. Ältere Kinder erwarten - wie auch Erwachsene - dass sich der Protagonist schlecht fühlen wird, da er ein Vergehen begangen hat. Nunner-Winkler zufolge kann eine solche Emotionszuschreibung bei jüngeren Kindern (bis 6-7 Jahre) die moralische Motivation[1] anzeigen. Die Kinder attribuieren die Gefühle so, wie sie glauben, selber in einer solchen Situation zu empfinden. Dadurch wird die relative Bedeutung der beiden Aspekte „Regelübertretung“ und „Bedürfnisbefriedigung“ ersichtlich (Nunner- Winkler, 1993, 282; 2001, 176ff). Emotionszuschreibung als Indikator für moralische Motivation wird von den Annahmen abgeleitet, dass Emotionen kognitive Urteile beinhalten, und dass sich diese Urteile auf die Aspekte einer Situation beziehen, die subjektiv eine besonders starke Bedeutung haben. D.h. es wird die Bereitschaft ersichtlich, Normen, die bekannt und verstanden sind, im Handeln umzusetzen, auch wenn man dabei kürzer tritt (Nunner-Winkler, 1993, 278, 281 f, 287). Bei älteren Kindern gilt dies nicht mehr, denn ab ca. 10 Jahren schrieben alle Kinder dem „Bösewicht“ negative Emotionen zu. Diese festgestellte Bereitschaft jüngerer Kinder, einem Übeltäter positive Emotionen zuzuschreiben, wird als „happy victimizer phenomenon“ bezeichnet (Nunner-Winkler, 1993, 282; 2001, 176ff).
Diesen Ergebnissen zufolge scheint sich in der Kindheit im Bereich der moralischen Emotionszuschreibung eine Entwicklung abzuzeichnen. Keller, Lourenço, Malti und Saalbach (2003) konnten in ihrer Untersuchung mit deutschen und portugiesischen Kindern ähnliche Ergebnisse verzeichnen. Jüngere Kinder orientieren sich trotz moralischem Regelwissen stärker an der Bedürfnisbefriedigung, ältere Kinder hingegen geben zum Teil bereits der Normbefolgung Vorrang vor dem Bedürfnis.
1.3 Oser und Reichenbach: „Unhappy moralist“: Das Phänomen des unglücklichen moralisten
Das Phänomen des „unhappy moralist“ kann als „Gegenstück“ zu Nunner-Winklers „happy victimizer“ Phänomen gesehen werden. Dieses beschreibt, wie bereits ausgeführt, die Bereitschaft jüngerer Kinder einem Übeltäter positive Emotionen zuzuschreiben. Ein „happy victimizer“ fühlt sich ungeachtet seines unmoralischen Verhaltens glücklich bzw. zufrieden. Er kennt die moralischen Regeln und Normen, verletzt oder bricht diese aber, um seinen Bedürfnissen Vorrang zu geben und fühlt sich gut dabei. Nunner-Winkler und Sodian gingen aufbauend auf den obigen Ergebnissen der Frage nach, welche Gefühle Kinder einem Protagonisten zuschreiben, der durch die Befolgung der Regel moralisch handelt und dadurch seine Bedürfnisse zurückstellt und diese somit nicht befriedigt. Zur Untersuchung dieser Fragestellung legten sie Kindern Geschichten vor, in denen der Protagonist trotz seiner Bedürfnisse einer Versuchung widersteht und konnten zeigen, dass Kinder einer solchen Person schlechte Gefühle zuschreiben, da sie nicht erreicht hat, was sie eigentlich wollte (vgl. Nunner-Winkler, 1999a, 325).
In einer weiteren Untersuchung mit 17-jährigen Jugendlichen verzeichnete Nunner- Winkler (2001) ähnliche Ergebnisse. Für mehrere moralische Konfliktsituationen sollten die Jugendlichen erklären und begründen, wie sie handeln und wie sie sich sowohl als Täter wie auch als das betroffene Opfer fühlen würden. Beispielsweise sollten sich die Jugendlichen vorstellen, dass sie ihr Moped verkaufen wollen und sich von einem ersten Kunden auf einen Preis herunterhandeln lassen, dem sie aber zustimmen. Dieser erste Kunde hat das Geld nicht dabei, weswegen er es erst holen muss und eine halbe Stunde später mit dem Geld zurückkehren wird. In der Zwischenzeit kommt ein zweiter Kunde, der sich bereit erklärt, den vollen Preis zu bezahlen. Diejenigen Jugendlichen, die angaben, dass sie auf den ersten Kunden warten würden, antworteten auf die Frage, wie sie sich dabei fühlen würden, fast ausschliesslich, dass es ihnen schlecht gehen würde, da sie viel Geld eingebüsst hätten. Diese Ergebnisse widersprechen dem „warm-glow-effect“, der bezeichnend ist für das Wohlgefühl nach der Ausführung einer moralischen Handlung (vgl. Nunner-Winkler, 2001, 178, 182f).
Oser und Reichenbach (2000) berichteten ähnliche Ergebnisse wie Nunner-Winkler. Sie liessen im Rahmen eines Verhandlungskurses die Kursteilnehmenden den Scheidungsfall „Winter gegen Winter“ aushandeln, bei dem es v.a. darum geht, welcher Elternteil das Sorgerecht für die fünf gemeinsamen Kinder erhält. Dazu fungierte jeweils eine Hälfte der Teilnehmenden als Anwälte des Mannes und die andere Hälfte übernahm die Rolle des Anwalts von Frau Winter. Beide Parteien erhielten vertrauliche Informationen über ihren Mandanten bzw. ihre Mandantin, wobei den Anwälten von Herrn Winter neutrale Informationen, den Anwälten von Frau Winter hingegen sehr negative Informationen über ihre Klientin und deren Umgang mit ihren Kindern vorgelegt wurden. Es wurde den Anwälten überlassen, wie sie mit diesen wichtigen negativen Informationen umgingen. Die Anwälte müssen also eine Entscheidung treffen: Sie haben einerseits die Möglichkeit, die Information in die Verhandlung einzubringen und im Sinne der Kinder zu handeln, was aber den Verhandlungszielen ihrer Klientin schaden würde. Auf der anderen Seite können sie das Wissen für sich behalten, um sich ganz für Frau Winters Interessen und somit einem Verhandlungssieg einzusetzen (vgl. Oser & Reichenbach, 2000, 212ff). An diesem Punkt soll festgehalten werden, dass sich die Autoren im Klaren darüber sind, dass solche Verhandlungen nur eine Nachahmung wirklicher Lebenssituationen und des Verhaltens darin darstellen (vgl. a. a. O., 215). Es ist möglich, dass sich die Personen unter realen Umständen anders verhalten würden und gewisse Risiken oder Opfer etc. nur eingehen, weil sie wissen, dass sie im Grunde nichts zu verlieren haben, da die Verhandlungssituation eine Imitation einer möglichen wirklichen Verhandlung ist. Die Autoren halten aber auch fest, dass das Verheimlichen der Wahrheit und Verhinderung von Gerechtigkeit sowohl in der Realität wie auch in der Nachahmung als moralisch fragwürdig betrachtet werden kann (vgl. a. a. O., 215). Zudem stellt sich auch die Frage, ob die gespielten Anwälte die Verhandlung so sehen, dass es ums Gewinnen, also um einen Verhandlungssieg geht, oder ob sie die Aufgabe so auffassen, dass sie sich möglichst so verhalten sollen, wie sie es auch tatsächlich in einer realen Verhandlungssituation tun würden.
Nach der Verhandlung waren diejenigen Anwälte, die die Information verschwiegen hatten, der Ansicht, ihren Auftrag erfüllt zu haben und waren zufrieden, dass sie die Interessen ihrer Klientin erfolgreich verteidigt hatten. Diejenigen, die die Informationen in die Verhandlung eingebracht hatten und diese somit gegen die vordergründigen Interessen ihrer Klientin dafür aber zum Wohl der Kinder einsetzten, waren oft unzufrieden mit dem Ergebnis ihrer Arbeit. Sie glaubten, die Erwartungen an eine gute Verhandlungsperson nicht erfüllt zu haben und erlebten sich selbst dann als nicht erfolgreich, wenn sie überzeugt waren, das Richtige getan zu haben. Die Personen, die sich aus moralischer Sicht fragwürdig verhalten hatten, erachteten das Ergebnis ihrer Handlung trotzdem als moralisch korrekt und waren damit zufrieden, während diejenigen, die gemäss ihrem moralischen Empfinden gehandelt hatten, sich schlecht, unglücklich bzw. unzufrieden oder unsicher fühlten. Die Moral und das Wissen darüber, was moralisch korrekt ist, behindert die Wahl des Weges, der zum „Erfolg“ führen würde. Die mögliche Freude an der moralischen Wahl wird dann durch den nicht erreichten Erfolg eingeschränkt oder sogar verhindert. Diese Befunde liessen Oser und Reichenbach (2000) vermuten, dass es komplementär zu Nunner-Winklers „happy victimizer“ einen „unhappy moralist“ gibt, der als moralisch resiliente Person verstanden wird (vgl. a. a. O., 218ff).
Moralische Resilienz wird nach Oser und Reichenbach (2000) definiert als einerseits „ Widerstand gegen das Erlangen oder Akzeptieren eines Gutes, wenn Anzeichen vorliegen, dass dessen Beschaffung mit negativen bzw. moralisch fragwürdigen Konsequenzen verbunden ist1 und andererseits als „Widerstand gegen Druck aus der Öffentlichkeit selbst dann, wenn das Engagement für benachteiligte oder verfolgte Menschen bedeuten kann, dass das moralische Subjekt beschädigt werden könnte“ (a. a. O., 204). Die Überzeugungen moralisch resilienter Personen halten also innerem und äusserem Druck stand.
Der Begriff „unhappy moralist“ beschreibt nach Oser und Reichenbach demnach eine Person, die unglücklich darüber ist, dass sie ihren moralischen Standpunkt nicht mit ihrer Erfolgsorientierung vereinbaren kann. Sie fühlt sich zwischen zwei in Konflikt stehenden Wertorientierungen, zum einen der Orientierung am Erfolg, zum anderen der Fürsorge und der Vermeidung von Ungerechtigkeit, hin und her gerissen (vgl. a. a. O., 220f). Ein „unhappy moralist“ verhält sich moralisch gesehen richtig, fühlt sich dabei aber nicht etwa glücklich, sondern unzufrieden und ist so gesehen eben ein unglücklicher Moralist. Bayertz (2002) zufolge ist jede handelnde Person der Spannung zwischen dem von der Moral und dem von den eigenen Interessen und Bedürfnissen Geforderten ausgesetzt. Jede Moral legt, so Bayertz, „den handelnden Individuen Beschränkungen auf; sie verbietet ihnen daher bestimmte Handlungen, deren Ausführung in ihrem Interesse wäre und gebietet ihnen Handlungen, deren Ausführung nicht in ihrem Interesse liegt, um auf diese Weise die Interessen anderer zu schützen“ (Bayertz, 2002, 13). Ein Beispiel zur Veranschaulichung dieser entstehenden Diskrepanz: Zwei Personen (Herr A und Herr B) sitzen in einem
Zugabteil. Beim Verlassen des Zuges vergisst Herr A seinen MP3-Spieler auf dem Tisch. Herr B, der nicht aussteigt, bemerkt erst, was passiert ist, als der Zug weiterfährt und es bereits zu spät ist, Herrn A darauf aufmerksam zu machen. Da bis zu der Haltestelle von Herrn B kein Kontrolleur vorbeikommt, dem er den MP3- Spieler hätte übergeben können, nimmt Herr B das Gerät beim Aussteigen mit. Es ist ein sehr moderner Spieler mit der neusten Ausstattung und viel Speicherplatz. Herr B weiss, dass er den MP3-Spieler im Fundbüro abgeben sollte, obwohl es in seinem Interesse wäre, das Gerät zu behalten, da er sich bereits seit längerem ein solches Gerät wünscht und sich bisher aber keines leisten konnte. Gibt Herr B den MP3- Spieler im Fundbüro ab, hat er zwar moralisch und korrekt gehandelt, dem Phänomen des „unhappy moralist“ zufolge wird er aber trotz seines korrekten, aus eigenem Willen geschehenen Handelns nicht zufrieden mit sich sein. Für Herrn B wird nicht seine moralische Stärke im Zentrum stehen, sondern der Verlust der Aussicht auf einen MP3-Spieler, was ihn zu einem unglücklichen Moralisten werden lässt.
Evi Schmid (2003) konnte in ihrer Untersuchung die Phänomene des „happy victimizer“ und des „unhappy moralist“ bestätigen. Sie liess 7 bis 15 Jahre alte Kinder und Jugendliche moralisch und unmoralisch handelnde Protagonisten verschiedener Geschichten Emotionen attribuieren und konnte zeigen, dass Kinder einem moralischen Übeltäter vorwiegend positive, einer moralisch handelnden Person hingegen negative Gefühle zuschreiben (vgl. Schmid, 2003, 139).
Oser und Reichenbach (2000) definieren „unhappy moralist“ in einer Verhandlungssituation für den Bereich des Erfolgs. Sie erklären, dass simulierte Verhandlungen deshalb prototypische Situationen darstellen, um versteckte oder offensichtliche moralische Fragwürdigkeit von Handlungen zu analysieren, weil die Handlungen in solchen Verhandlungssituationen eben legal sind und weil ausser einem schlechten Gewissen selten weitere Konsequenzen befürchtet werden müssen (vgl. Oser & Reichenbach, 2000, 207). D.h. die Anwälte von Frau Winter „dürfen“ sich für die Ziele ihrer Mandantin einsetzen und dabei unmoralisch handeln und bewegen sich mit ihrer Handlung trotzdem nicht im Bereich des Verbotenen.
Für die vorliegende Arbeit soll die Definition auf andere Bereiche oder Situationen ausgeweitet werden, um sie somit auch auf den Alltag anwenden zu können. „Unhappy moralist“ soll im Rahmen dieser Arbeit nicht nur eine Person beschreiben, bei der Erfolgsorientierung und die Vermeidung von Ungerechtigkeit in Konflikt stehen, sondern eine, die v.a. zwischen persönlichem Profit, Bedürfnissen und Eigeninteresse zum einen und der Einhaltung des moralisch Korrekten zum anderen hin und her gerissen ist. Dadurch, dass das moralisch Korrekte gewählt und damit das persönliche Bedürfnis in den Hintergrund gestellt wird, fühlt sich die Person, so die Hypothese, unzufrieden.
1.4 Zusammenfassung und weiterführende Gedanken
Unter Moral wird ein System von Regeln verstanden, welches das Verhalten der Mitglieder einer Gesellschaft untereinander ordnet und dadurch auch eine gewisse Sicherheit gewährleistet. Moral kann einerseits auf die Gesellschaft und andererseits auf das Individuum bezogen werden, es sind aber beide Sichtweisen erforderlich, da sie voneinander abhängen.
Im Bereich der moralischen Emotionszuschreibung konnte festgestellt werden, dass jüngere Kinder glauben, Personen, die eine Norm verletzt haben, fühlen sich gleichwohl gut, weil sie das taten, was sie tun wollten, d.h. ihre Bedürfnisse befriedigt haben. Nunner-Winkler (1993, 282) bezeichnet diese Bereitschaft jüngerer Kinder, einem Übeltäter positive Emotionen zuzuschreiben, als „happy victimizer phenomenon“. Komplementär dazu haben Oser und Reichenbach (2000, 220f) das Phänomen des „unhappy moralist“ beschrieben. Demzufolge fühlt sich eine Person unglücklich wenn sie es nicht schafft, ihren moralischen Standpunkt mit ihrer Erfolgsorientierung zu vereinbaren. Diese Definition wurde für die vorliegende Arbeit dahingehend verallgemeinert, dass der Konflikt einer Person zwischen persönlichen Bedürfnissen einerseits und andererseits der Einhaltung des moralisch Korrekten besteht. Indem die Person dem moralisch Korrekten den Vorrang gibt, fühlt sie sich unglücklich bzw. unzufrieden. Es wird jedoch bezweifelt, ob davon ausgegangen werden darf, dass diese Person wirklich unglücklich ist. Daher kann vorwegnehmend mit Verweis auf Abschnitt 2.2 festgehalten werden, dass für diese Arbeit unter einem „unhappy moralist“ ein unzufriedener Moralist verstanden werden soll und kein unglücklicher.
Über die Art des Bezuges des „happy victimizer“ Phänomens zum Phänomen des „unhappy moralist“ wird in Abschnitt 4.1.2 im Zusammenhang mit der moralischen Motivation diskutiert.
Im Zusammenhang mit dem angenommenen Phänomen des „unhappy moralist“ drängen sich viele noch ungeklärte Fragen auf, da die Literatur und Forschung auf diesem Gebiet noch sehr jung und sehr spärlich vorhanden sind. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, u.a. wichtige Fragen in Bezug auf diese Theorie und damit Zusammenhängendes aufzuwerfen, weiterführende Gedanken zu verfolgen und Neues über das angenommene Phänomen in Erfahrung zu bringen.
In diesem Sinne stellt sich die Frage, ob nun das Phänomen des „unhappy moralist“ ein fester, immer wiederkehrender Zustand, sozusagen eine Persönlichkeitseigenschaft einer Person („trait“) ist. Falls ja, würde dies bedeuten, dass manche Menschen immer unzufriedene Moralisten sind, wenn sie in Situationen, in denen ein potentieller Profit dem moralischen Handeln gegenübersteht, die moralische Norm über den persönlichen Bedürfnissen wählen? Wenn dem so ist, gibt es auf der anderen Seite auch Personen, die, egal wie gross der persönliche Profit sein könnte und unabhängig von der Stärke der Norm, sich immer für die Befolgung der Norm entscheiden und sich dabei gut fühlen, sozusagen „happy moralists“ bzw. zufriedene Moralisten sind?
Oder ist die Unsicherheit und Unzufriedenheit eines „unhappy moralist“ eher eine Momentaufnahme? Es würde sich somit um Emotionen handeln, die auf gewisse Situationen bezogen sind („state“), und wiederkehren können, aber nicht bei jedem Konflikt zwischen Moral und Bedürfnissen, wenn die Entscheidung für die Moral ausfällt, wiederkehren müssen.
Nisans (1986) Modell der moralischen Bilanz könnte dafür sprechen, dass es sich bei den Unzufriedenheitsgefühlen eines „unhappy moralist“ um einen Zustand bzw. „state“ handelt, worauf aber erst später in Abschnitt 4.2.2 eingegangen werden soll. Eine weitere Frage, die zu stellen meines Erachtens gerechtfertigt ist, betrifft die Dauer der Gefühle eines „unhappy moralist“. Es wird vermutet, dass die durch eine bestimmte Situation ausgelösten Empfindungen eines „unhappy moralist“ nicht ewig andauern werden. Aber wann klingen sie ab? Oder kommen sie immer wieder auf, wenn man sich die auslösende Situation in Erinnerung ruft und wieder lebendig werden lässt? Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird es nicht möglich sein, allen aufkommenden Fragen durch eine empirische Überprüfung gerecht zu werden. Dies gilt auch für die eben angeführten Fragen. Dennoch halte ich es für wichtig, diese Fragen zu stellen und aufzugreifen, um die Möglichkeit offen zu lassen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt weiterverfolgt werden können.
2 Emotionen und der „unhappy moralist“
Wie bereits am Namen des in dieser Arbeit zentral behandelten Phänomens des „unhappy moralist“ erkennbar ist, spielen Emotionen eine bedeutende Rolle. Es geht darum, wie sich Menschen fühlen, deren Eigeninteresse mit dem moralisch Korrektem in Konflikt steht und die das Eigeninteresse dem Moralischen unterordnen. Sie fühlen sich dem behaupteten Phänomen zufolge „unhappy“. In diesem Kapitel soll erst auf den Begriff „Emotion“ eingegangen werden, anschliessend wird eine Annäherung an die Konstrukte Glück und Zufriedenheit bzw. Unglück und Unzufriedenheit vorgenommen, um danach auf moralische Gefühle und die Relevanz von Emotionen für das Phänomen des „unhappy moralist“ einzugehen. Dieses Kapitel soll v.a. auch dazu dienen, die Emotionen eines „unhappy moralist“ etwas genauer zu definieren, da sich die Frage stellt, ob es sich bei diesem Phänomen wirklich um Unglücklichsein und nicht eher um Unzufriedensein handelt.
2.1 Annäherung an den Begriff „Emotion“
In der Literatur lassen sich je nach Schwerpunkt verschiedenste Emotionsdefinitionen finden, es scheint aber keine einheitliche zu geben. Otto et al. (2000) drücken dies zu Beginn ihres Handbuchs der Emotionspsychologie wie folgt aus: „Definitionen bereiten zwar in allen Bereichen der Psychologie Probleme, scheinen aber in der Emotionspsychologie besonders widerspenstig zu sein“ (Otto, Euler & Mandl, 2000, 11). Fehr und Russell gehen soweit zu behaupten, dass alle wissen, was eine Emotion[2] sei, bis sie dafür eine Definition geben sollen (vgl. a. a. O., 11).
Kleinginna und Kleinginna (1981) versuchten eine Vielzahl von Definitionen zusammenzufassen, um eine einheitliche Emotionsdefinition aufstellen zu können. Das Ergebnis behindert aber meines Erachtens eher das Verständnis des Emotionskonstruktes, als dass es dieses unterstützt:
„Emotion ist ein komplexes Interaktionsgefüge subjektiver und objektiver Faktoren, das von neuronal/hormonalen Systemen vermittelt wird, die (a) affektive Erfahrungen, wie Gefühle der Erregung oder Lust/Unlust, bewirken können; (b) kognitive Prozesse, wie emotional relevante Wahrnehmungseffekte, Bewertungen, Klassifikationsprozesse, hervorrufen können; (c) ausgedehnte physiologische Anpassungen an die erregungsauslösenden Bedingungen in Gang setzen können; (d) zu Verhalten führen können, welches oft expressiv, zielgerichtet und adaptiv ist“ (Kleinginna & Kleinginna, 1981, zit. nach Otto et al., 2000, 15).
Ulich (1989) versucht anstelle einer zusammenfassenden Begriffserklärung eine Auflistung von 10 Bestimmungsmerkmalen von Emotionen[3], die von unterschiedlichem Gewicht sind und von denen keines ausschliesslich kennzeichnend ist. In ihrer Konstellation aber sind die Bestimmungsmerkmale charakteristisch für „Emotion“, wobei ein typisches Merkmal nicht in allen Fällen emotionalen Erlebens vorkommt. Es sind also immer nur einige Merkmale pro Fall vorhanden. Die Gesamtheit aller Merkmale stellt die ideale Erscheinungsform von Emotion dar, die in der Realität zwar nicht vorkommt, die Zuordnung wirklicher Einzelfälle aber ermöglichen soll (vgl. Ulich, 1989, 31ff). Zusammenfassend können die 10 Bestimmungsmerkmale von Ulich wie folgt beschrieben werden:
1. Merkmal: Die „leib-seelische Zuständigkeit1 (a. a. O., 34) und nicht eine Sache steht beim Erleben einer Emotion im Zentrum des Bewusstseins.
2. Merkmal: Selbstbetroffenheit, als das wohl einzige immer vorhandene
Bestimmungsmerkmal. Emotionen entstehen nur, wenn eigene Ziele, Interessen und Bedürfnisse betroffen sind.
3. Merkmal: Emotionen erscheinen häufig wie von selbst, können aber umgekehrt auch verdrängt werden, worauf sie sogar mit grosser Anstrengung nicht wieder hervorgerufen werden können.
4. Merkmal: Emotionen widerfahren uns und liegen somit nicht in unserem Verantwortungsbereich. Wir empfinden uns als passiv.
5. Merkmal: Erleben von Emotionen kann zu physiologischen Erregungen führen, was wiederum die emotionale Beteiligung erkennen lässt.
6. Merkmal: Jede erlebte Emotion ist einmalig und unverwechselbar, auch wenn in bestimmten Situationen bestimmte Emotionen wahrscheinlicher sind.
7. Merkmal: Emotionen bestimmen das individuelle Bewusstsein und verleihen ihm Kontinuität.
8. Merkmal: Emotionen sind selbstgenügsam. Sie sind da, um erlebt zu werden.
9. Merkmal: Bezeichnend für Emotionen ist das Ausdrücken und Verstehen über nicht-verbale Kommunikationskanäle.
10. Merkmal: Die Emotionen sind besonders stark in zwischenmenschlichen Beziehungen vernetzt (vgl. a. a. O., 34-40).
Montada (1993) versteht Emotionen ähnlich wie Ulich als Widerfahrnisse, die durch bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Situationen ausgelöst werden und vom Subjekt passiv ertragen werden müssen (vgl. Montada, 1993, 266f). Emotionen werden also nicht als aktive, frei gewählte Handlungsweisen erfahren (Brandstädter, 1985, zit. nach Montada, 1993, 266).
Zimbardo und Weber (1997) zufolge ist eine Emotion ein komplexes Muster von physischen und psychischen Veränderungen, die physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und Verhaltensreaktionen auf eine persönlich bedeutsame Situation beinhalten (vgl. Zimbardo & Weber, 1997, 287).
Brumlik (2002) definiert Emotionen als „ganzheitliche und übergreifende, auf Evidenz und Handlungsorientierung bezogene Haltungen. Ausserdem strukturieren sie intersubjektive Handlungsbezüge, indem sie das Feld des Handelns insgesamt ergreifen“ (Brumlik, 2002, 66).
Eine neuere Emotionstheorie von Solomon (2000) besagt, dass Emotionen[4] zugleich persönliche Urteile sind, „mittels deren wir die Welt unseren Absichten gemäss strukturieren, uns ein eigenes Universum gestalten, die real gegebenen Tatsachen ermessen und letzten Endes nicht nur unsere Realität, sondern auch uns selber erschaffen“ (Solomon, 2000, XXIV). Er stellt die Behauptung auf, dass Emotionen rational sind, und dass sie der Betrachtung und Gestaltung der Welt dienen. Bereits in seiner 1976 erschienenen englischen Ausgabe „The Passions. Emotions and the Meaning of Life.“ ging es Solomon darum, eine Logik der Emotionen möglichst genau darzustellen und von einem rein biologischen Charakter wegzukommen. Solomon zufolge passiert uns unser Gefühlsleben nicht, wir sind nicht passiv, wie dies unter anderem Ulich (1989) in seinen 10 Bestimmungsmerkmalen oder Montada (1993) annehmen, sondern gestalten unser Gefühlsleben aktiv, erzeugen unsere Emotionen sogar, und sind somit auch für sie verantwortlich (vgl. Solomon, 2000, Xf, 36).
Emotionen sind also vernünftig und beabsichtigt und werden genauso gewählt, wie man eine Handlung wählt (vgl. Solomon, 1984, 306). Sie erfordern „hohes Differenzierungsvermögen, einen ausgewachsenen Selbst-Entwurf, ein gewisses Abstraktionsniveau, beträchtliche Klugheit und Selbstachtung und können ausgesprochen zweckorientiert nach sehr elaborierten Regeln und Strategien verfahren“ (Solomon, 2000, 239).
Auch wenn gewisse Emotionen nach Aussen hin irrational erscheinen mögen, hält Solomon fest, dass die so genannte „Irrationalität“ der Emotionen meistens eher mit der Wahl eines falschen Zeitpunktes oder der falschen Mittel zu tun hat, denn die Emotionen selbst seien völlig rational (vgl. a. a. O., 249).
Emotionen als wertende Urteile hängen auch stark von Meinungen und Überzeugungen ab, d.h. wenn eine Meinung ändert, werden auch die Emotionen beeinflusst. Solomons Sicht von Emotionen unterscheidet sich von dem üblichen Bild. Die meisten Autoren sind der Ansicht, dass Emotionen aus Urteilen folgen, oder lassen dann den Urteilsbegriff komplett weg, da sie Emotionen als Reaktionen auf bestimmte Ereignisse verstehen. Solomon argumentiert aber, dass Ereignisse eine Emotion nicht erklären können, da jede Emotion immer eine persönliche Wertung beinhaltet, was auch zu erklären vermag, weshalb verschiedene Personen auf dieselbe Situation emotional unterschiedlich reagieren (vgl. a. a. O., 173). Wir sind es selber, die uns ärgerlich, traurig oder verliebt machen, nur müssen wir uns dessen bewusst werden (vgl. a. a. O., 179).
Manche Autoren wie Ulich (1989) oder Montada (1993) sind also der Ansicht, dass uns Emotionen widerfahren, dass wir demnach passiv sind. Neuerer Forschung zufolge soll jedoch das Gegenteil zutreffen. Solomon (2000) nimmt an, dass wir aktiv an unserem Gefühlsleben beteiligt und somit auch für unsere Emotionen verantwortlich sind. Da sich Nunner-Winkler in ihren Aufsätzen[5] zur moralischen Motivation (vgl. Abschnitt 4.1.2) und zum Phänomen des „happy victimizer“ zur Erklärung des Emotionsbegriffs auf die Theorie von Solomon stützt, erscheint es sinnvoll, auch in dieser Arbeit von Solomons Annahmen auszugehen.
2.2 Glück oder Zufriedenheit?: Zum „unhappy“ im „unhappy moralist“
Wenn versucht werden soll, sich dem Konstrukt „Glück“ anzunähern, muss als erstes festgehalten werden, dass „Glück” eine Doppelbedeutung besitzt, die im Englischen mit den beiden Begriffen „luck“ und „happiness“ deutlich gemacht wird. „Luck“ steht für Glück im Sinne von Zufall, „ich hatte Glück“. „Happiness“ steht für Glück als Erfüllung, die Bedeutungsvariante, die in dieser Arbeit verwendet werden soll (vgl. Mayring, 1991, 12). Somit gehören die folgenden Definitionen dieser letzteren Bedeutungsvariante an.
Brumlik beschreibt Glück als ein Leben, das zum einen von sinnvollen Zielen und befriedigenden menschlichen Beziehungen erfüllt ist und zum anderen materiell mehr oder weniger sorgenfrei ist (vgl. Brumlik, 2002, 17).
Ulich und Mayring verstehen unter Glück das „umfassendste Gefühl tiefen Wohlbefindens, das Menschen im Laufe ihres Lebens entwickeln“ (Ulich & Mayring, 2003, 175) und unterscheiden zwischen vier Theorieansätzen. Psychoanalytische Ansätze erwarten Glück, wenn Ich, Es und Über-Ich harmonieren, also keine Spannung vorhanden ist. Persönlichkeitskonzepte verstehen unter Glück die „Integriertheit der Person“, in der das Denken, Fühlen und Handeln zusammenwirken. Humanistisch-psychologische Ansätze gehen davon aus, dass Glück ein Erlebnis höchster Erfüllung ist „auf der Grundlage eines selbstaktualisierenden, eigene Fähigkeiten und Wünsche im sozialen Umfeld verwirklichenden Lebens“. Im vierten, entwicklungspsychologischen Ansatz wird Glück als kontinuierliche Erfüllung der eigenen Lebensziele im Lebenslauf verstanden (vgl. a. a. O., 176).
Mayring (1991) beschreibt Glück als „extrem starke positive Emotion“ und als „vollkommene[n], dauerhaften] Zustand intensivster Zufriedenheit1 (Mayring, 1991, 14). Dies deutet bereits an, wie Glück und Zufriedenheit zueinander stehen. Zufriedenheit scheint eine Voraussetzung für Glück zu sein. Letzteres wird viel extremer und intensiver erfahren als Zufriedenheit. Man kann also nicht glücklich sein, ohne zufrieden zu sein, was aber umgekehrt sehr wohl möglich ist. Mayring nennt als Gegenteil von Glück - d.h. Unglück -Trauer und Depression (vgl. Mayring, 2000, 222). Nun folgt die bereits angedeutete Überlegung, ob das „unhappy“ im „unhappy moralist“ tatsächlich wörtlich genommen werden sollte. Denn die Emotionen eines unglücklichen Moralisten können und sollten meines Erachtens nicht mit den intensiv negativen Emotionen der Trauer oder der Depression verglichen werden. Womöglich kommt es darauf an, in welchen Bereichen sich eine Person in einem Konflikt wieder findet und wie viel Bedeutung diese Bereiche für die Person und ihr Wohlergehen haben. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass ein Individuum in eine Depression fallen wird, weil sie das moralisch Korrekte gegenüber den damit in Konflikt stehenden persönlichen Interessen wählt.
Um diese Überlegung zu Ende zu führen, soll nun auch kurz auf das weniger intensive Zufriedenheits- bzw. Unzufriedenheitsgefühl eingegangen werden. Zufriedenheit wird Ulich und Mayring (2003) zufolge empfunden, wenn man seine Ziele erreicht hat, frei von Sorgen ist und Frieden gefunden hat. Zufriedenheit ist überdauernd und baut sich aus Erfahrungen positiver Situationen auf (vgl. Ulich & Mayring, 2003, 173).
Als Empfindung heisst die Zufriedenheit einen Zustand gut und erkennt das Ich zumindest teilweise an. Es ist, so Solomon, als ob man sagt: „Jetzt ist meine Welt so, wie sie sein sollte“ (Solomon, 2000, 377).
Nach Mayring (2000) stellt Zufriedenheit einen eher ruhigen, kognitiv gesteuerten Befindenszustand dar, das als Produkt von Abwägens- und Vergleichsprozessen verstanden wird (vgl. Mayring, 2000, 222). Zufriedenheit kann als subjektives Abwägen der eigenen Ziele und Ansprüche gegenüber dem Erreichten angesehen werden, was sich mit folgender Formel darstellen lässt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Formel für Zufriedenheit bzw. Glück nach Mayring (2000, 225f)[6]
Die Zufriedenheit steigt, je mehr Ziele erreicht werden (Vergrösserung des Zählers) oder je weniger unerreichte Ziele (Verringerung des Nenners) vorhanden sind (vgl. a. a. O., 225f). Für das Phänomen des „unhappy moralist“ bedeutet dies, dass je mehr Ziele oder persönliche Bedürfnisse existieren oder je weniger Ziele oder persönliche Bedürfnisse erreicht bzw. befriedigt werden, desto unzufriedener wird eine Person sein, wenn sie die moralische Handlung dem Eigeninteresse vorzieht.
In dieser Arbeit soll also, wie bereits weiter oben erwähnt wurde, unter einem „unhappy moralist“ ein unzufriedener Moralist („discontent moralist“) verstanden werden und kein unglücklicher.
Interessant an dieser Stelle zu erwähnen sind Ginters (1982) Erläuterungen zum Zusammenhang von Moralität und Glück. Er stellt sich die Frage, ob man moralisch sein muss, um wahrhaft glücklich sein zu können. Ginters kommt zu dem Schluss, dass Moralität keine notwendige Bedingung für Glück sei. Trotzdem stelle Moralität einen wichtigen Faktor dar, der zweifelsohne die Menschen eher glücklich als unglücklich mache. Genauso gelte dies aber auch für andere Faktoren, von denen er z.B. einen ausfüllenden Beruf oder ein harmonisches Familienleben als Beispiele nennt (vgl. Ginters, 1982, 225f).
2.3 Die wichtigsten moralischen Emotionen
Moralische Emotionen sind, so Montada (1993), Indikatoren für persönliche moralische Normen. Wird z.B. Schuld oder Empörung erlebt, wird eindeutig aufgezeigt, dass eine subjektiv für richtig gehaltene moralische Norm verletzt wurde. Die emotionale Reaktion belegt die persönliche Betroffenheit über die Normverletzung (vgl. Montada, 1993, 268). Moralische Emotionen zeigen demnach die psychische Existenz moralischer Normen an (vgl. a. a. O., 261).
Aber nicht in allen Situationen, in denen eine moralische Regel gebrochen oder eingehalten wird, werden moralische Emotionen auftreten. Wahrscheinlich wird Empörung empfunden werden, wenn beobachtet wird, wie eine Frau in einem Laden zwei Dosen vom Regal nimmt, in ihre Tasche packt und den Laden verlässt. Die Empörung wird aber nachlassen oder gar ganz schwinden, wenn man erfährt, dass die Frau fünf Kinder zuhause hat, die alle Hunger haben, oder dass sie die Dosen bereits bezahlt hatte und sie nur auswechselte, da die ersten beiden beschädigt waren usw. Es fliessen also mehrere Faktoren mit ein, nicht nur der Glaube, dass eine moralische Regel verletzt wurde. Bei moralischen Emotionen handelt es sich nicht um Bewertungen von abstrakten Regeln, sondern um Bewertungen von Normen in einem Handlungs- und Interaktionskontext (vgl. a. a. O., 271).
Brumlik (2002) nennt als wichtiges Merkmal moralischer Emotionen ihre ausschliessliche intersubjektive Geltung. Dies gilt auch für die Emotionen, die auf das Selbst bezogen empfunden werden, da der Selbstbezug „stets ein Selbstbezug unter Hinblick auf andere bzw. auf Normen, die andere betreffen“ (Brumlik, 2002, 66f) ist.
Im Folgenden sollen vier der wichtigsten moralischen Emotionen näher erläutert werden: Empathie, Empörung, Scham und Schuld.
2.3.1 Empathie - oder die Anteilnahme an den Emotionen anderer
Bei der Definition von Empathie werden je nach Autor verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Oft werden entweder nur die kognitiven Komponenten, wie Verständnis für soziale Situationen oder die Fähigkeit der Rollenübernahme, oder dann die affektiven Komponenten betont, wie die Übereinstimmung der eigenen Emotionen mit denen der anderen (vgl. Mussen & Eisenberg-Berg, 1979, 106). Feshbach bezieht in seiner Definition beide Aspekte mit ein, sowohl kognitive wie auch affektive. Als Voraussetzung für Empathie nennt er „(1) die Fähigkeit, affektive Zustände anderer zu erkennen und zu benennen, (2) die Fähigkeit, die Perspektive und Rolle des Anderen zu übernehmen, und (3) die emotionale Erlebnisfähigkeit, um das beobachtete Gefühl teilen zu können“ (Feshbach, 1978, 1986, zit. nach BischofKöhler, 1989, 13). Empathie ist somit das Erkennen und die Anteilnahme an den emotionalen Erlebnissen anderer Personen.
Auch Hoffmann (zit. nach Mussen & Eisenberg-Berg, 1979, 108) berücksichtigt kognitive und affektive Aspekte:
„Die zentrale Theorie...ist die: Da eine vollständige, entwickelte, empathische Reaktion eine internale Antwort auf Hinweise über die affektiven Zustände eines anderen ist, muss die empathische Reaktion stark vom kognitiven Wissen des Handelnden um das Verschiedensein des anderen abhängen, welches entwicklungsmässig dramatischen Änderungen unterworfen ist. Die Entwicklung dieses Wissens um den anderen.interagiert mit den früheren empathischen Reaktionen des Individuums (...).“
Empathie setzt demzufolge voraus, dass zwischen der eigenen Person und den anderen unterschieden wird, wodurch eine empathische Reaktion erfolgen kann.
2.3.2 Empörung - oder der Schuldvorwurf gegenüber anderen
Im Gegensatz zu Schuldgefühlen, die entstehen, wenn das Subjekt selber eine moralische Norm bricht, erfolgt Empörung, wenn andere eine moralische Norm verletzen. Bei der Empörung handelt es sich somit um einen Schuldvorwurf gegenüber anderen (vgl. Montada, 1993, 264f, 269).
Die Zuschreibung von Verantwortlichkeit ist für die moralische Emotion „Empörung“ von Bedeutung. Sie kann abnehmen, wenn die „schuldige“ Person Verantwortlichkeit ablegen oder akzeptable Rechtfertigungsgründe hervorbringen kann. Von wesentlicher Bedeutung ist auch, ob es ein Opfer des unmoralischen Verhaltens gibt und wie nahe man diesem Opfer steht (vgl. a. a. O., 264f).
Moralische Bewunderung kann als Gegenteil von Empörung angesehen werden. Sie kann auftreten, wenn andere Personen moralischen Normen entsprechend handeln und wir diese Personen für ihr Handeln bewundern. Moralische Bewunderung tritt aber nicht auf, wenn die Übereinstimmung von Handeln und Normen selbstverständlich oder zu erwarten ist (vgl. a. a. O., 262). Eine solche selbstverständliche Übereinstimmung kann im Bereich der starken Normen erwartet werden. Man wird wohl kaum Bewunderung dafür erhalten, dass man heute keine Bank ausgeraubt oder niemanden umgebracht hat.
2.3.3 Scham - oder die Erschütterung des Selbst
Scham kann, muss aber nicht immer ein moralisches Gefühl sein, und kann auch empfunden werden, wenn gar keine „intersubjektiv akzeptierten, wesentlichen moralischen Normen verletzt worden sind“ (Brumlik, 2002, 75).
Scham entsteht, wenn das Vertrauen in die Konsistenz und Kontinuität des Selbst erschüttert wird, egal ob diese Erschütterung nun selbstverschuldet ist oder nicht (vgl. a. a. O., 78). Es kommt zu einer Diskrepanz zwischen realem und idealem Selbst, wobei etwas aufgedeckt wird, was man lieber versteckt halten würde (vgl. Solomon, 2000, 355; Ulich & Mayring, 2003, 181). Scham resultiert demnach aus einer negativen Selbstbewertung. Ulich und Mayring sehen Scham an soziale Situationen gebunden, in denen etwas, was man lieber verborgen halten möchte, öffentlich wird (vgl. Ulich & Mayring, 2003, 182). Im Gegensatz dazu treten Schamgefühle Roos (2000) zufolge auch auf, wenn andere nichts vom persönlichen
Versagen mitkriegen. Betroffene glauben versagt zu haben und inkompetent zu sein und es kann sogar soweit kommen, dass ein Teil der Selbstachtung verloren geht (vgl. Roos, 2000, 267). Nunner-Winkler ist ebenfalls der Ansicht, dass Scham durch reine Antizipation der negativen Reaktionen eines innerlich gedachten Publikums erfolgen kann (vgl. Nunner-Winkler, 1999b, 151). Die Situation muss folglich nicht öffentlich werden, um Scham auszulösen, weil die Reaktionen der anderen antizipiert werden können oder aus früherer Erfahrung bekannt sind, und bereits dieses Wissen zu Schamgefühlen führen kann.
Nunner-Winkler zufolge setzt sich Scham aus drei Bestandteilen zusammen: Zunächst wird eine Handlung, die an einem als gültig akzeptierten Standard orientiert ist, negativ bewertet. Anschliessend wird mittels einer Kausalattribuierung das Handlungsergebnis allein dem Selbst zugeschrieben. Schliesslich ist Scham die Folge einer Selbstbewertung. In dieser werden antizipierte negative Fremdbewertungen durch reflexive Rollenübernahme auf das eigene Selbst bezogen (vgl. a. a. O., 169f).
Scham wird also in der ersten Person erfahren, wie Nunner-Winkler schreibt, als Täter. Empörung wird in der zweiten und dritten Person erlebt, d.h. als Opfer oder als Zuschauer. Scham und Empörung stehen demnach in Beziehung zueinander (vgl. a. a. O., 151).
Scham kann aber auch stellvertretend für eine andere Person oder Gruppe erlebt werden, je nachdem wie nahe die betroffene Person diesen steht (vgl. Roos, 2000, 268).
Als Gegenpol zur Scham kann der Stolz gesehen werden, der - im Gegensatz zur Scham - mit einer positiven Selbstevaluation zusammenhängt und somit eine Zunahme der Selbstachtung zur Folge haben kann (vgl. a. a. O., 268).
2.3.4 Schuld - oder der Schuldvorwurf an sich selbst
Vorab soll festgehalten werden, dass es Schuld und Schuldgefühle zu unterscheiden gilt. Zwar kann man rechtlich gesehen für schuldig erklärt werden, was aber nicht heisst, dass man sich gezwungenermassen auch schuldig fühlt (vgl. Solomon, 2000, 357).
Im Gegensatz zur Empörung, die entsteht, wenn andere eine moralische Norm brechen, entstehen Schuldgefühle, wenn ein Individuum erkennt, dass es selber durch eine Handlung oder eine Handlungsunterlassung eine moralische Norm verletzt hat, und dass es für diese Normverletzung verantwortlich ist. Um verantwortlich sein zu können, muss man die Freiheit der Wahl zwischen den verschiedenen Alternativen gehabt haben. Verantwortlichkeit ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für Schuld, denn es kann Situationen geben, in denen eine Normabweichung verantwortlich und gerechtfertigt ist, z.B. um ein noch grösseres Unrecht zu vermeiden (vgl. Montada, 1993, 263; Roos, 2000, 268). Bei Schuldgefühlen widersprechen die Handlungsergebnisse einer Person ihrem moralischen Sollwert. Durch das Gefühl, ein Versprechen sich selber gegenüber gebrochen zu haben, wertet man das Selbst ab, was in Schuldgefühlen resultiert (vgl. Roos, 2000, 269). Dies erinnert an Nisans Modell der moralischen Bilanz (vgl. Nisan, 1986a), welches später in Abschnitt 4.2 behandelt werden soll. Wenn eine Person ihren persönlichen moralischen Sollwert (nach Nisan: ihr persönlich akzeptables moralisches Mindestniveau) unterschreitet, womit gesamthaft gesehen ihre moralische Bilanz im negativen Bereich liegt, wird sie Roos zufolge von Schulgefühlen gequält werden. Vorangehendes könnte in Bezug auf den „unhappy moralist“ bedeuten, dass wenn die moralische Bilanz in den negativen Bereich fällt, wodurch Schuldgefühle zustande kommen könnten, das Phänomen des „unhappy moralist“ mit geringerer Wahrscheinlichkeit auftritt. Da das Wissen vorhanden ist, dass man bei unmoralischem Handeln von Schuldgefühlen geplagt worden wäre, wird man mit geringerer Wahrscheinlichkeit unzufrieden über die moralische Entscheidung und anschliessende moralisch korrekte Handlung sein.
Das Wissen, dass man hätte anders handeln müssen, hat ebenfalls einen Einfluss auf die Gefühle der Schuld (vgl. Roos, 2000, 269). „Ob Menschen Schuld empfinden oder nicht, hängt demnach von ihnen selbst und ihrem moralischen Wissen ab und tritt unabhängig davon ein, ob eine Zuwiderhandlung gegen eine akzeptierte Norm überhaupt bekannt und öffentlich geworden ist1 (Brumlik, 2002, 75). Schulgefühle hängen also nicht von einem Publikum ab. „Schuldig ist man immer nur „vor sich selbst“ (Solomon, 2000, 358).
Einen weiteren grossen Einfluss auf das Erleben von Schuldgefühlen haben die negativen Folgen für andere Personen. Diese negativen Handlungsfolgen müssen anerkannt und bedauert oder mitgefühlt werden. Anders als bei Schamgefühlen ist es für das Entstehen von Schuldgefühlen - wie auch für die Empörung - bedeutsam, ob es ein Opfer gibt und um wen es sich bei diesem Opfer handelt. Steht das Opfer dem „Täter“ nahe, ist meist mit stärkeren Schuldgefühlen zu rechnen. Dies ist auch der Fall, wenn das Opfer leidet oder verletzt ist (vgl. Roos, 2000, 268).
Opfer und Beobachter verspüren den Schuldigen gegenüber meist Zorn und Empörung. Diese Emotionen können durch glaubwürdiges Entziehen aus der Verantwortlichkeit oder durch Rechtfertigungen seitens des Schuldigen abgeschwächt werden (vgl. a. a. O., 269).
Das Gegenteil von Schuldgefühlen ist die moralische Befriedigung. Wer selber trotz innerer Widerstände, Kosten oder bestehender Versuchungen moralisch handelt, kann Montada zufolge moralische Befriedigung erwarten (vgl. Montada, 1993, 262). Dies widerspricht eigentlich dem Phänomen des „unhappy moralist“, demzufolge das Einhalten einer moralischen Norm trotz bestehenden normwidersprechenden Eigeninteressen zu negativen Gefühlen und Unzufriedenheit führt, wenn dabei persönliche Interessen in den Hintergrund gerückt werden.
2.4 Zusammenfassung und Relevanz von Emotionen für das Phänomen des „unhappy moralist“
Wie gezeigt wurde, verstehen einige Autoren wie Ulich (1989) oder Montada (1993) Emotionen als Widerfahrnisse und das Individuum selber demnach als passiv bzw. seinen Emotionen passiv ausgeliefert. Solomon (2000) hingegen nimmt an, dass wir unser Gefühlsleben aktiv gestalten. Emotionen sind ihm zufolge zugleich auch persönliche Urteile. Diese Annahme hat für die Forschung zum „happy victimizer“ Phänomen von Nunner-Winkler eine zentrale Bedeutung: Nunner-Winkler schliesst von den Emotionszuschreibungen von Kindern auf deren moralische Motivation, d.h. die Bereitschaft der Kinder, ihnen bekannte Normen im Handeln umzusetzen, auch wenn sie dabei „Verluste“ in Kauf nehmen müssen (Nunner-Winkler, 1993, 278, 281f, 287).
Nach neuerer Forschung „passieren uns“ unsere Emotionen also nicht, im Gegenteil, wir sind für sie verantwortlich. Das gilt auch für moralische Emotionen, welche auf moralische und persönliche Normen hinweisen, die für uns von Bedeutung sind. Unsere Urteile darüber, was wir und andere tun, können z.B. zu Empörung führen - die Betroffenheit über die Verletzung einer uns wichtigen Norm durch eine andere Person. Brechen wir hingegen selber eine moralisch bedeutende Norm, wird unser Urteil über die eigene Handlung bewirken, dass wir uns schuldig fühlen.
Für das Phänomen des „unhappy moralist“ sind Emotionen unerlässlich, worauf der Begriff „unhappy“ deutlich hinweist. Es geht darum, wie sich eine Person, die moralisch handelt und dabei den möglichen persönlichen Profit an zweite Stelle stellt, fühlt. Wie bereits festgestellt wurde, empfindet ein „unhappy moralist“ trotz korrektem Verhalten Unzufriedenheit und nicht etwa moralische Befriedigung oder Wohlgefühl, wie dies dem „warm-glow-effect“ zufolge zu erwarten wäre (vgl. Nunner-Winkler, 2001, 182). Diese empfundene Unzufriedenheit entstammt einem Konflikt zwischen Moral und persönlichem Bedürfnis. Die dargelegten Ausführungen begründen, wieso in dieser Arbeit unter einem „unhappy moralist“ ein unzufriedener und nicht etwa ein unglücklicher Moralist verstanden werden soll. Im Gegensatz zu einem „unhappy moralist“ gibt ein „happy victimizer“ seinem Bedürfnis Vorrang. Er scheint seinen moralischen Verstoss zu akzeptieren und fühlt sich trotz seiner „Tat“ zufrieden.
3 Normen und der „unhappy moralist“
Der zweite Schwerpunktbereich der vorliegenden Arbeit sind Normen und verschiedene Normgruppen. Ein zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es herauszufinden, in welchen Normbereichen das angenommene Phänomen des „unhappy moralist“ vorkommt.
Es gibt überall im Leben Normen und Regeln, ob im Berufsleben, in der Familie, in der Schule, man kommt nicht um sie herum. Im folgenden Kapitel wird als Erstes eine allgemeine Definition von Normen gesucht. Danach sollen zur Vertiefung des Verständnisses in einem Exkurs verschiedene Sichtweisen des Normbegriffs je nach Disziplin aufgegriffen werden. Im Anschluss daran wird das Bereichsmodell des moralischen Tuns nach Garz kurz dargestellt. Im Weiteren werden moralische, rechtliche, starke und schwache Normen unterschieden, um dann die Verbindung zum Phänomen des „unhappy moralist“ aufzuzeigen.
3.1 Allgemeine Definition von Normen
Der Begriff „Norm“ geht auf das lateinische Wort „norma“ zurück, was so viel wie Winkelmass des Zimmermanns bedeutet und im übertragenen Sinn als „Richtschnur“, „Regel“, „Vorschrift“ verstanden werden kann (vgl. Simon, 1987, 27). Der Duden (Das grosse Fremdwörterbuch, 2003, 935) unterscheidet wie folgt zwischen sechs Begriffsverwendungen des Wortes „Norm“:
1. „(Plur.) allgemein anerkannte, als verbindlich geltende Regel für das Zusammenleben der Menschen.
2. eigentlich übliche, den Erwartungen entsprechende Beschaffenheit, Grösse o. Ä.; Durchschnitt.
3. a) festgesetzte, vom Arbeitnehmer geforderte Arbeitsleistung; b) in der ehemaligen DDR als Richtwert geltendes Mass des für Produktion von Gütern notwendigen Aufwands an Arbeit, Material u. Arbeitsmitteln.
4. (von einem Sportverband) als Voraussetzung zur Teilnahme an einem Wettkampf vorgeschriebene Mindestleistung (Sport).
5. (in Wirtschaft, Industrie, Technik, Wissenschaft) Vorschrift, Regel, Richtlinie o. Ä. für die Herstellung von Produkten, die Durchführung von Verfahren, die Anwendung von Fachtermini o. Ä.
6. klein auf den unteren Rand der ersten Seite eines Druckbogens gedruckter Titel [u. Verfassername] eines Buches [in verkürzter od. verschlüsselter Form] (Druckw.).“
Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist v.a. der erste Punkt bedeutsam. Die Punkte 2 bis 6 tragen zwar zur Vollständigkeit der Definition bei, können aber in dieser Arbeit ausser Acht gelassen werden.
Der Duden (Fremdwörterbuch, 1974, 499) führt ferner noch den Punkt „das sittliche Gebot od. Verbot als Grundlage der Rechtsordnung, dessen Übertretung strafrechtlich geahndet wird (Rechtsw.)“ auf.
Normen sind demnach verbindlich geltende Regeln, die eigens erstellt wurden, um das auf Umwelt und Mitmenschen bezogene Tun und Lassen zu ordnen (vgl. Oldemeyer zit. nach Hermann, 1982, 30). Werden diese Regeln überschritten, muss mit Konsequenzen (z.B. Strafen) gerechnet werden. Es gibt in jeder Gemeinschaft Normen in Form von Ver- und Geboten, Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber dem Rest der Gemeinschaft. Eine funktionierende Gemeinschaft ist ohne gewisse Regeln wie z.B. „du sollst nicht töten“ nicht denkbar. Moralische Normen, Gesetze und Regeln bestimmen das Handeln und bieten Bewertungsmassstäbe für eigenes und fremdes Verhalten. Um diese Funktion zu gewährleisten, müssen die Normen aber erworben, verstanden, anerkannt, als berechtigt angesehen und befolgt werden (vgl. Montada, 2002, 619-622).
Popitz nennt drei Verhaltenssequenzen, die in normrelevanten Situationen auftreten können. Entweder wird die Norm befolgt, sie wird gebrochen und der Normbruch wird sanktioniert, oder die Norm wird gebrochen und es erfolgt keine Sanktion (vgl. Popitz, 1980, 34). Nur im ersten Fall kann es zum Phänomen des „unhappy moralist“ kommen, wenn also die Norm eingehalten wird. Im letzten Fall ist es möglich, dass das „happy victimizer“ Phänomen auftritt, d.h. die Norm gebrochen wird und man sich dabei gut fühlt.
Im Bereich der Pädagogik, so Schaub und Zenke (2000), sind Normen Handlungsvorschriften, denen erzieherisches oder unterrichtliches Denken und Tun folgen sollen. Solche Normen werden als Prinzipien verstanden, „deren Beachtung durch den Pädagogen dazu beitragen kann, dass der heranwachsende junge Mensch sein Denken, Wollen und Handeln bestimmten Sollensforderungen (i. S. von Normen) aus eigenem Entschluss unterstellt“ (Schaub & Zenke, 2000, 403).
Im nachfolgenden Kapitel soll nun aus der Sicht verschiedener Fachgebiete etwas näher auf den Normbegriff eingegangen werden, um ein umfassenderes Verständnis des Begriffs zu ermöglichen.
3.2 Exkurs: Verschiedene Sichtweisen des Normbegriffs je nach Fachgebiet
Im diesem Kapitel soll als erstes eine Annäherung an den philosophischen Normbegriff vorgenommen werden, da dieser der ursprünglichste ist. Danach soll „Norm“ aus der Sicht der Soziologie betrachtet werden, um anschliessend auf die psychologische und zuletzt auf die rechtliche Perspektive überzugehen.
3.2.1 Philosophischer Exkurs - Kategorischer Imperativ vs. Utilitarismus
Im folgenden Abschnitt soll relativ kurz - da eine umfassendere Auseinandersetzung mit der Philosophie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde - auf den Normbegriff aus der Sicht von Kant und des Utilitarismus eingegangen werden. Beide beschäftigen sich vorwiegend mit der Moral, also mit Normen aus moralischer Sicht.
Das meist anerkannte Kriterium der philosophischen Ethik ist die Universalisierbarkeit einer Norm. Diesem Universalisierungsgrundsatz zufolge ist eine Handlung moralisch erlaubt, „wenn die Folgen davon, dass sie unter diesen Bedingungen von allen nach Belieben ausgeführt werden kann, von einem unparteiischen Standpunkt allgemein annehmbar sind“ (Koller, 1997, 275). Eine Handlung ist dann moralisch geboten, wenn ihre Folgen allgemein für alle akzeptabel sind, das Unterlassen dieser Handlung für einige aber nicht erträglich ist. Moralisch verbotene Handlungen sind solche, deren Folgen allgemein nicht vertretbar sind (vgl. a. a. O., 275).
[...]
[1] Auf die moralische Motivation wird in dieser Arbeit in Abschnitt 4.1.2 eingegangen.
[2] Einige Autoren verstehen „Emotion“ als Oberbegriff für „Gefühl“ (z.B. Zimbardo & Weber, 1997) andere scheinen keinen Unterschied zu machen und verwenden die Worte synonym (z.B. Ulich, 1989). Da aus der Literatur kein Konsens hervorgeht, werde ich mich, um Unklarheiten zu vermeiden, in dieser Arbeit soweit möglich auf den Begriff „Emotion“ beschränken.
[3] Ulich verwendet in der Beschreibung seiner Merkmale sowohl den Begriff „Gefühl“ wie auch den der „Emotion“. Obwohl er sie synonym verwendet, werde ich mich auch hier an den Begriff „Emotion“ halten.
[4] In der deutschen Version von Solomons Buch „Gefühle und der Sinn des Lebens“ wird zwischen „Gefühl“ und „Emotion“ kein Unterschied gemacht. Wie aber auch bei Ulich, soll hier der Klarheit zuliebe ebenfalls soweit möglich der Begriff „Emotion“ verwendet werden.
[5] Z.B. Nunner-Winkler, G. (1989): Wissen und Wollen. Ein Beitrag zur frühkindlichen Moralentwicklung. In: A. Honneth, Th. McCarthy, C. Offe, A. Wellmer (Hrsg.): Zwischenbetrachtungen. Im Prozess der Aufklärung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 583.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Text untersucht das Phänomen des "unhappy moralist", bei dem Personen, die moralisch handeln und dabei persönliche Bedürfnisse zurückstellen, Unzufriedenheit empfinden. Der Text analysiert die Grundlagen dieses Phänomens, die Rolle von Emotionen und Normen, sowie weitere mögliche Einflussfaktoren wie moralische Urteilsstufen, moralische Bilanz, sozialer Vergleich und Persönlichkeit.
Was wird unter "Moral" verstanden?
Moral wird definiert als ein System von Regeln, Normen und Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft regulieren und als verbindlich akzeptiert werden. Sie dient dazu, Handlungen zu verhindern, die den elementaren Interessen anderer schaden.
Was ist das "happy victimizer phenomenon"?
Das "happy victimizer phenomenon" beschreibt die Beobachtung, dass jüngere Kinder (bis ca. 6-7 Jahre) Tätern, die eine moralische Regel verletzen, positive Emotionen zuschreiben, weil diese ihre Bedürfnisse befriedigt haben. Sie scheinen die Bedürfnisbefriedigung wichtiger zu finden als die Einhaltung der Regel.
Was ist das "unhappy moralist" Phänomen?
Das "unhappy moralist" Phänomen, als Gegenstück zum "happy victimizer" Phänomen, beschreibt eine Person, die sich unglücklich bzw. unzufrieden fühlt, weil sie ihren moralischen Standpunkt nicht mit ihren persönlichen Interessen vereinbaren kann. Sie entscheidet sich zwar für das moralisch Richtige, empfindet aber Unzufriedenheit darüber, dass sie ihre Bedürfnisse zurückstellen musste.
Welche Rolle spielen Emotionen bei dem Phänomen des "unhappy moralist"?
Emotionen spielen eine zentrale Rolle, da sie die Unzufriedenheit widerspiegeln, die ein "unhappy moralist" empfindet. Diese Unzufriedenheit entsteht durch den Konflikt zwischen moralischen Werten und persönlichen Bedürfnissen. Der Text argumentiert, dass es sich eher um Unzufriedenheit (discontent) als um tiefes Unglück (unhappiness) handelt.
Welche moralischen Emotionen werden im Text betrachtet?
Die wichtigsten moralischen Emotionen, die im Text betrachtet werden, sind Empathie, Empörung, Scham und Schuld. Diese Emotionen sind Indikatoren für persönliche moralische Normen und zeigen die psychische Existenz moralischer Normen an.
Welche Bedeutung haben Normen für das "unhappy moralist" Phänomen?
Normen sind ein zentraler Bestandteil der Analyse des "unhappy moralist" Phänomens. Der Text untersucht, in welchen Normbereichen dieses Phänomen auftritt und ob es Unterschiede zwischen schwachen und starken Normen gibt.
Welche weiteren Einflussfaktoren auf das Phänomen des "unhappy moralist" werden untersucht?
Neben den Normbereichen werden weitere mögliche Einflussfaktoren wie die moralische Urteilsstufe nach Kohlberg, das Modell der moralischen Bilanz nach Nisan, der soziale Vergleich und Persönlichkeitsmerkmale untersucht.
Was ist das Modell der moralischen Bilanz nach Nisan?
Das Modell der moralischen Bilanz nach Nisan besagt, dass jede Person eine persönliche moralische Bilanz besitzt, die sich aus den guten und schlechten Handlungen zusammensetzt. Je positiver die moralische Bilanz, desto eher kann sich die Person eine Übertretung erlauben, ohne ihr akzeptables moralisches Mindestniveau zu unterschreiten.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit gestellt?
Die zentralen Forschungsfragen umfassen die Normbereiche, in denen das "unhappy moralist" Phänomen vorkommt, Unterschiede zwischen schwachen und starken Normen sowie den Einfluss der moralischen Bilanz, des sozialen Vergleichs, der Persönlichkeitsmerkmale und der moralischen Urteilsstufe nach Kohlberg.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, der die Grundlagen und den theoretischen Hintergrund der Forschungsfragen erarbeitet, und einen empirischen Teil, der die Methode, die Ergebnisse und die Diskussion der Ergebnisse umfasst. Abschliessend werden die erzieherischen Konsequenzen aufgegriffen.
- Quote paper
- Lisa Hattersley (Author), 2005, "Unhappy Moralist": Doing right and feeling wrong, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188482