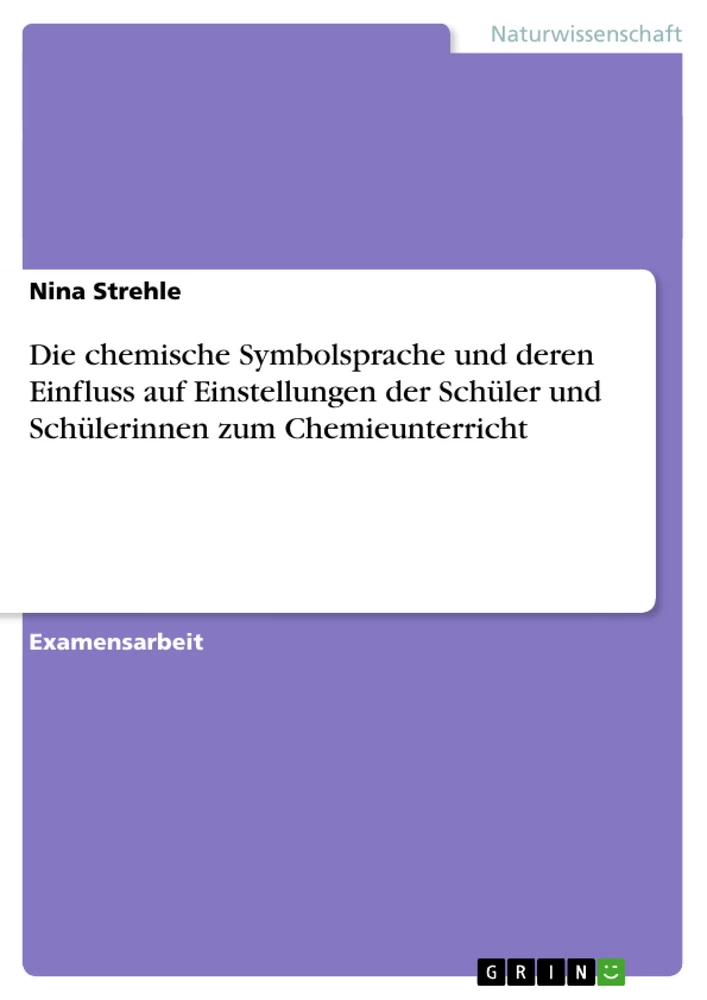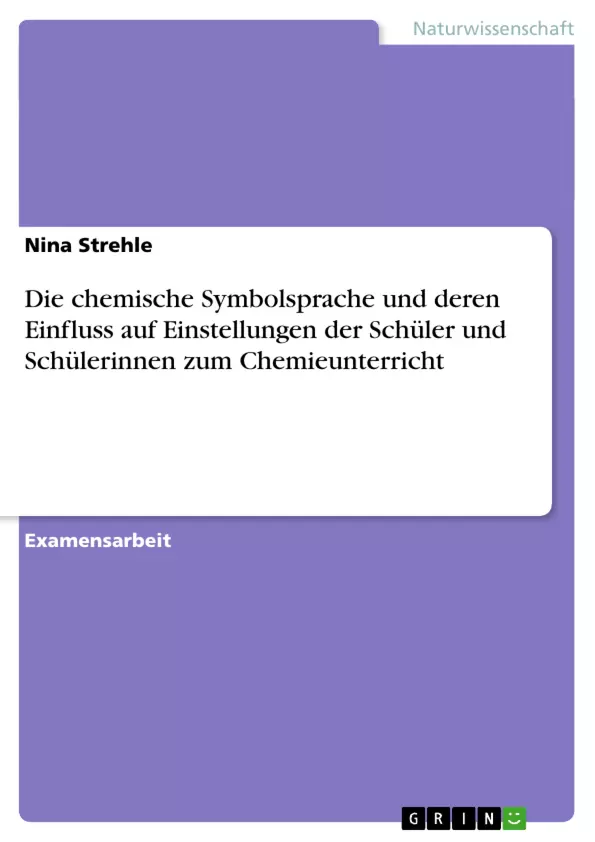„Die Chemie stimmt nicht!“
So fasst BURTSCHEIDT (2001) in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung den
Zustand des gegenwärtigen Chemieunterrichts zusammen. Gewöhnlich sind in der
Presse und Fachliteratur sowie im persönlichen Umfeld zumeist ablehnende
Stimmen, wie „Chemie ist ein Horrorfach“ oder „Chemie, das habe ich nie verstanden“
zu hören. Chemie scheint zu den unbeliebtesten Schulfächern zu gehören:
Es gilt als „zu abstrakt, zu wenig lebensnah, zu trocken, zu anspruchsvoll“
(RENN, 2001) oder als „zu theoretisch, abgehoben und mathematisiert“ (BURTSCHEIDT,
2001).
Zugleich wird dem Chemieunterricht zugeschrieben, in einer für den Schüler unverständlichen,
formalisierten Sprache stattzufinden: Chemie ist „Formelkram“
(ZITT, 2000) oder „Die Formel, das Schreckgespenst der Chemie!“ (SCHEIBLE,
1971), sind nur einige Ausdrücke, die die Abneigung ehemaliger und derzeitiger
Schüler gegenüber der chemischen Symbolsprache und dem Chemieunterricht
verdeutlichen.
Chemische Symbole gehören vermutlich zu den oft schwierigen, nicht verstandenen
Sachverhalten des Faches Chemie, deren Ablehnung sich auch auf die Haltung
von Schülerinnen und Schülern gegenüber dem gesamten Chemieunterricht
auswirken kann.
Das Thema der Arbeit:
„Die chemische Symbolsprache und deren Einfluss auf Einstellungen
der Schüler und Schülerinnen zum Chemieunterricht“
greift dieses besondere Problem des Chemieunterrichts heraus, das mit den wissenschaftlichen
Methoden der empirischen Sozialforschung bearbeitet werden
soll.
In der nachfolgenden Untersuchung sollen einerseits mögliche Schwierigkeiten
der Schüler – hier der 9. und 10. Jahrgangsstufe an einem Gymnasium – mit der
chemischen Symbolik aufgedeckt und kritisch beleuchtet und entsprechende Verbesserungen für die Handhabung der Symbolsprache im Chemieunterricht vorgeschlagen
werden. Andererseits gilt es, die Jugendlichen nach ihrer Meinung zum
Chemieunterricht und zur Symbolik zu befragen, um ihre Einstellungen und Wünsche
erkennen und verstehen zu können. Abschließend sollen Zusammenhänge
zwischen dem Verständnis der chemischen Symbolik, den Einstellungen zur chemischen
Symbolik und zum Fach Chemie untersucht werden.
Somit kann diese Arbeit einen Beitrag leisten, den Chemieunterricht insgesamt
effizienter, sinnvoller und attraktiver zu gestalten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einstellung
- 2.1 Reiz-Reaktions-Theorien...
- 2.2 Soziales Objekt ......
- 2.3 Das Dreikomponentenmodell der Einstellung...
- 2.4 Das eindimensionale Modell der Einstellung.
- 2.5 Grundlage der empirischen Untersuchung
- 2.6 Was ist Einstellung zum Chemieunterricht?
- 3 Einstellung zum Chemieunterricht...........
- 4 Ursachen für die negative Einstellung zum Chemieunterricht .......
- 4.1 Image der Chemie......
- 4.2 Lehrerpersönlichkeit..\li>
- 4.3 Alltagsbezug.
- 4.4 Schwierigkeit.
- 5 Die chemische Symbolsprache………………
- 5.1 Die chemische Fach- und Symbolsprache .........
- 5.2 Was bedeutet der Begriff Symbol?
- 5.3 Abkürzungen
- 5.4 Mehrdeutigkeit.......
- 5.5 Abstraktion
- 5.5.1 Kognitive Entwicklung nach PIAGET.
- 5.5.2 Unterrichtsmethoden
- 5.6 Schülervorstellungen
- 5.6.1 Stoffe als Eigenschaftsträger.
- 5.6.2 Kontinuum
- 5.6.3 Vernichtung von Stoffen
- 5.6.4 Ionen und Ionengitter..\li>
- 5.7 Zusammenfassung
- 6 Untersuchungsziele.
- 7 Konzeption der Untersuchung
- 7.1 Die Stichprobe.
- 7.2 Konzeption des Untersuchungsinstruments…..\
- 7.2.1 Fragebogen zum Verständnis der chemischen Symbolsprache....
- 7.2.2 Fragebogen zur Einstellung zum Chemieunterricht und zur\nchemischen Symbolik..\li>
- 7.3 Konzeption der Auswertung ....
- 7.3.1 Fragebogen zum Verständnis der chemischen Symbolsprache....
- 7.3.2 Fragebogen zur Einstellung zum Chemieunterricht und zur\nchemischen Symbolik...\li>
- 7.3.3 Überprüfung der Hypothesen
- 7.4 Durchführung der Untersuchung ..
- 8 Ergebnisse und Diskussion
- 8.1 Lösungen der Aufgaben
- 8.2 Zusammenfassung der Lösungen
- 8.3 Verständnis der chemischen Symbolsprache
- 8.4 Einstellung zum Chemieunterricht.
- 8.5 Einstellung zur chemischen Symbolsprache
- 8.6 Überprüfung der Hypothesen.
- 8.6.1 Verständnis der chemischen Symbolik und Einstellung\nzum Chemieunterricht
- 8.6.2 Verständnis der chemischen Symbolik und Einstellung zur\nzur Symbolik.........
- 8.6.3 Einstellung zur chemischen Symbolik und Einstellung zum\nChemieunterricht.
- 8.6.4 Zusammenfassung.
- 8.7 Kommentare zur chemischen Symbolik und zum Chemieunterricht .......
- 9 Perspektiven für den Chemieunterricht........
- 9.1 Einstellungen
- 9.2 Die chemische Symbolik.
- 9.2.1 Veranschaulichung von Symbolen durch konkrete\nStrukturmodelle
- 9.2.2 Vorteile des strukturorientierten Chemieunterrichts.
- 9.3 Zusammenfassung und Ausblick.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, den Einfluss der chemischen Symbolsprache auf Einstellungen von Schülern und Schülerinnen zum Chemieunterricht zu untersuchen. Die Studie untersucht, inwieweit das Verständnis der chemischen Symbolik die Einstellung zum Fach beeinflusst und umgekehrt.
- Schwierigkeiten von Schülern mit der chemischen Symbolsprache
- Einfluss der Symbolsprache auf die Einstellung zum Chemieunterricht
- Ursachen für negative Einstellungen zum Chemieunterricht
- Die Rolle von Schülervorstellungen beim Verständnis der chemischen Symbolik
- Perspektiven für den Chemieunterricht, um die Einstellung zu verbessern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und stellt das Problem des Chemieunterrichts im Kontext der negativen Einstellungen von Schülern dar. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Theorien zur Einstellung und definiert den Begriff der Einstellung zum Chemieunterricht. Kapitel 3 untersucht die Ursachen für negative Einstellungen zum Chemieunterricht, wie z.B. das Image des Faches, die Lehrerpersönlichkeit und die Schwierigkeit des Stoffes. Kapitel 4 konzentriert sich auf die chemische Symbolsprache und untersucht ihre Bedeutung und Komplexität. Das fünfte Kapitel analysiert die Untersuchungsziele und die Methodik der Studie, einschließlich der Stichprobe und des Fragebogens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Einstellung zum Chemieunterricht, chemische Symbolsprache, Verständnis, Schülervorstellungen, empirische Sozialforschung und Unterrichtsmethoden. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern das Verständnis der chemischen Symbolsprache die Einstellung zum Chemieunterricht beeinflusst und umgekehrt.
- Citation du texte
- Nina Strehle (Auteur), 2002, Die chemische Symbolsprache und deren Einfluss auf Einstellungen der Schüler und Schülerinnen zum Chemieunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18850