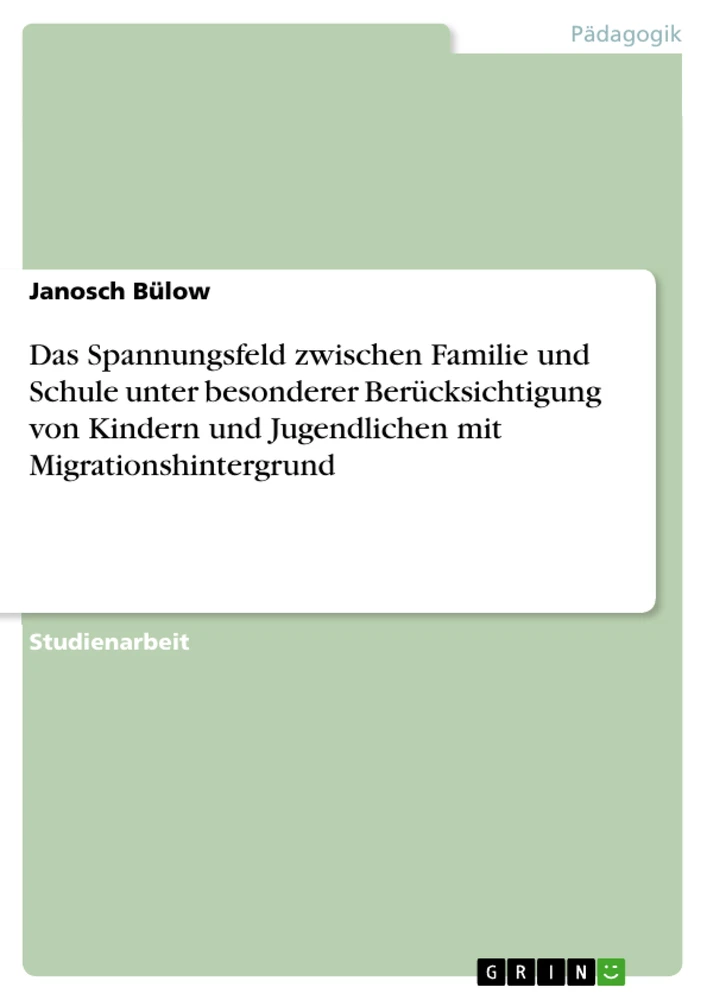Der erste Schultag. Die Schultüten bis oben hin gefüllt mit Süßigkeiten stehen sie da. Kein Kind wie das andere. Sie kennen sich untereinander kaum, nur ab und zu erblickt man ein bekanntes Gesicht aus dem eigenen Viertel. Und dann dieser große, grob wirkende Mann. Herr Müller will er genannt werden. Und der soll mir nun Dinge beibringen, die meine El-tern nicht können.
So oder ähnlich begegnen Schülerinnen und Schüler (im Folgenden SchülerInnen) der In-stitution, die für die nächsten 12 bis 13 Jahre Stätte ihrer Ausbildung, eine Art Paralleluni-versum und für manche sogar ein zweites zu Hause ist oder sein wird – Schule.
Doch genau mit dieser ersten Begegnung treffen auch gleich zwei verschiedene „Welten“ aufeinander. Man wird aus dem familiären Umfeld, in dem man sich kennt, liebt und un-terstützt, gerissen und sitzt nun mit fremden Menschen in unbekannten Räumen zusammen, in denen man Dinge lernen soll, ohne die man prima die letzten Jahre ausgekommen ist.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, worin genau die Unterschiede zwischen fami-liärem Umfeld und dem der Schule liegen, woher diese stammen und welche Auswirkun-gen sie auf die schulische Laufbahn haben können.
Der erste, allgemeine Teil dieser Arbeit beschäftigt sich zunächst mit offensichtlichen Un-terschieden, um daran anknüpfend die einzelnen Beziehungsebenen der Beteiligten spezifi-scher zu beleuchten.
Der zweite Teil dieser Arbeit geht der selbstgewählten Fragestellung nach, ob Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund in besonderer Weise von den zuvor erarbeiteten Differenzen betroffen sind. Wenn ja, welche Gründe dafür verantwortlich sind und ob es Möglichkeiten gibt an der Chancenungleichheit etwas zu ändern.
Die Erkenntnisse des ersten Teils folgen aus einem Konglomerat der drei Texte „Was wir in der Schule lernen?“ von Dreeben (Kap 2), „Familie und Schule“ von Susann Busse und Werner Helsper sowie „Individuation in pädagogischen Generationsbeziehungen“ von Merle Hummrich, Werner Helsper, Susann Busse und Rolf-Torsten Kramer.
Die Literatur zum persönlichen Schwerpunkt dieser Arbeit setzt sich zusammen aus Rainer Geißlers „Die Metamorphose der Arbeitertochter zum Migrantensohn - Zum Wandel der Chancenstruktur im Bildungssystem nach Schicht, Geschlecht, Ethnie und deren Verknüp-fungen“ und Heike Diefenbachs „Ethnische Segmentation im deutschen Schulsystem – Ei-ne Zustandsbeschreibung und einige Erklärungen für den Zustand“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Offensichtliche Unterschiede von Schule und Familie
- 1.1 Soziale Beziehungen
- 1.2 Formale Strukturen
- 1.3 Merkmale der Erwachsenen und Nicht-Erwachsenen
- 1.4 Sichtbarkeit der Merkmale
- 2. Besondere Aspekte der einzelnen Beziehungen
- 2.1 Die Beziehung Eltern - Kind
- 2.2 Die Beziehung Eltern - Lehrkraft
- 2.3 Die Beziehung Lehrkraft - SchülerIn
- 3. Besonderheiten bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- 3.1 Unterschiedliche Bildungschancen
- 3.2 Mögliche Gründe für die Nachteile
- 3.3 Einige Lösungsansätze
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen dem familiären Umfeld und dem Schulalltag und deren Auswirkungen auf die schulische Laufbahn von Kindern und Jugendlichen. Dabei wird besonders auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund eingegangen.
- Analyse der Unterschiede zwischen Familie und Schule hinsichtlich sozialer Beziehungen, formeller Strukturen und Merkmalen der Erwachsenen und Nicht-Erwachsenen.
- Untersuchung der Beziehungen zwischen Eltern und Kind, Eltern und Lehrkraft sowie Lehrkraft und SchülerIn im Kontext dieser Unterschiede.
- Bewertung der Herausforderungen, denen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Bildungssystem gegenüberstehen.
- Erörterung möglicher Ursachen für die Bildungsungleichheit und möglicher Lösungsansätze.
- Betrachtung des Spannungsfelds zwischen familiären Erwartungen und schulischen Anforderungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach den Unterschieden zwischen Familie und Schule und deren Auswirkungen auf die schulische Laufbahn, insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, dar. Das erste Kapitel analysiert die offensichtlichen Unterschiede zwischen Familie und Schule in Bezug auf soziale Beziehungen, formale Strukturen und die Merkmale der Erwachsenen und Nicht-Erwachsenen. Das zweite Kapitel beleuchtet die besonderen Aspekte der Beziehungen zwischen Eltern und Kind, Eltern und Lehrkraft sowie Lehrkraft und SchülerIn im Kontext dieser Unterschiede. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, denen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Bildungssystem gegenüberstehen. Es werden mögliche Ursachen für die Bildungsungleichheit diskutiert und Lösungsansätze aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Migrationshintergrund, Familie, Schule, soziale Beziehungen, formale Strukturen, Lehrkraft, SchülerIn, Eltern, Integration, Inklusion, Interkulturelle Bildung.
- Citar trabajo
- Janosch Bülow (Autor), 2009, Das Spannungsfeld zwischen Familie und Schule unter besonderer Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188521