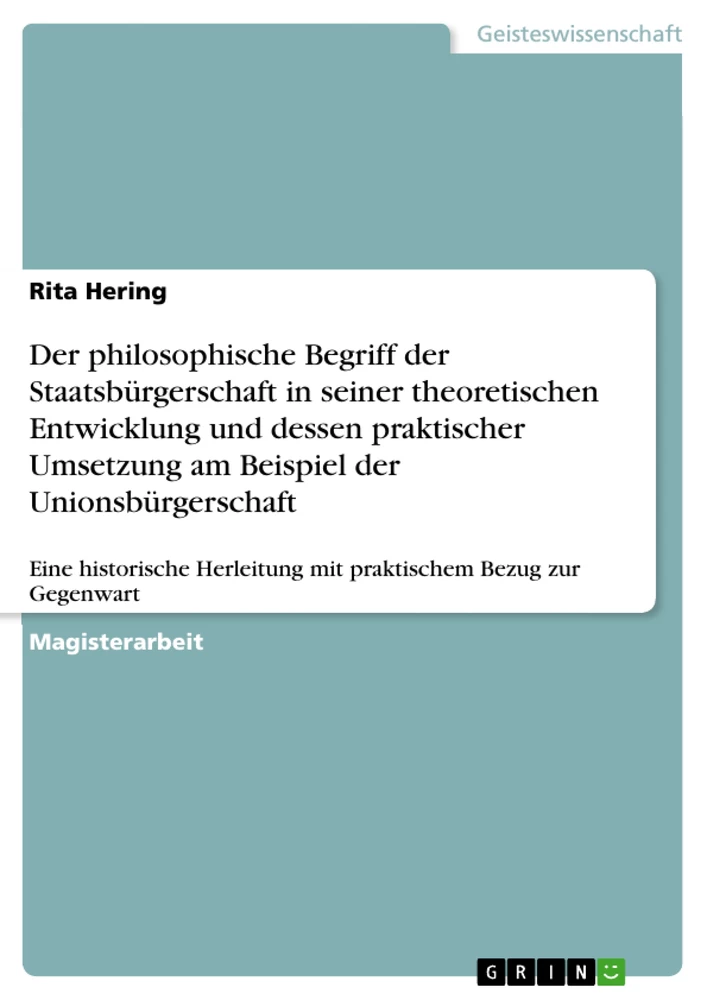„Der Dumme ist doch der Bürger, der Alles zahlt!“… Wie oft hören oder lesen wir aktuell diesen Satz, wenn es um die unterschiedlichsten innen- und aussenpolitischen Themen geht.
Ob es sich nun um innenpolitische Debatten handelt, die klären sollen in wie weit die aktuelle Finanzkrise abgewendet werden kann, der so teuer gewordene Sozialstaat weiterhin finanziert werden soll oder einzelne Projekte wie der Bahnhof "Stuttgart 21" öffentlich diskutiert und kritisiert werden oder um außenpolitische Problematiken wie die Rettung Griechenlands, die Flut der Flüchtlinge Nordafrikas oder auch die Rechtssicherheit des weltweiten Internets: immer steht zumindest am Rande der Bürger, dem dieses noch zuzumuten, jedoch schwer zu vermitteln ist. Wer genau ist denn dieser Bürger über den gemutmaßt wird, dass er dieses wohl noch akzeptieren wird, aber aus seiner Perspektive nicht einsehen kann? Welche Kriterien liegen dieser Bewertung der Zumutbarkeit und vor Allem der Rechtfertigung seitens der Politiker in Bezug auf die Bürger zu Grunde?
Nicht alle politischen Beweggründe zielen auf einen Sieg bei der nächsten Landtags- oder Bundestagswahl ab, sondern es gibt durchaus ein theoretisches Modell, welches sich hinter unserem derzeitigen politischen System verbirgt. Ein wesentlicher Punkt in diesem Modell ist die Idee der Staatsbürgerschaft, wobei der Bürger durch bestimmte Rechte und Pflichten an den Staat – dem er rechtlicht angehört – gebunden ist. Die Modifikationen und Variationen der Staatsbürgerschaft in unterschiedlichen politischen Gemeinschaften sind einerseits durch das vorherrschende Staatskonzept und der damit verbundenen historischen Entwicklungsgeschichte des Einzelstaates, andererseits aber auch durch die divergierenden Entwicklungen einiger philosophie-theoretischen Modelle der Staatsbürgerschaft, unter besonderer Berücksichtigung variabler historischer Aspekte, stringent impliziert.
Im Rahmen dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie sich der philosophische Begriff der Staatsbürgerschaft aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven entwickelt hat und in welcher Form er in die gegenwärtige politische Praxis eingebettet ist. Es soll herausgestellt werden welche Differenzen zwischen der theoretischen Definition des Begriffs der Staatsbürgerschaft und seiner praktischen Umsetzungsmöglichkeiten bestehen. Dies wird anhand des Beispiels der Unionsbürgerschaft verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der staatsbürgerlichen Idee
- Die vertragstheoretische Perspektive
- Hobbes
- Locke
- Rousseau
- Vom natürlichen Individuum zum Staatsbürger
- Gerechtigkeit
- Platon
- Aristoteles
- Rawls
- Gerechtigkeit als Maßstab kooperierender Bürger
- Sittlichkeit
- Platon
- Hegel
- Herrscher-kontra Bürgertugend
- Freiheit
- Kant
- Mill
- Freiheitssicherung durch ihre Einschränkung
- Definition der Staatsbürgerschaft
- Gesicherte Rechte
- Bindende Pflichten
- Erwerbungsprinzipien der Staatsbürgerschaft
- Die vertragstheoretische Perspektive
- Die Unionsbürgerschaft
- Von Schengen nach Lissabon
- Definition der Unionsbürgerschaft
- Gesicherte Rechte der Unionsbürgerschaft
- Bindende Pflichten der Unionsbürgerschaft
- Unions- und Staatsbürgerschaft im Vergleich
- Kritik und neue Ansätze
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem philosophischen Begriff der Staatsbürgerschaft und untersucht dessen theoretische Entwicklung sowie die praktische Umsetzung am Beispiel der Unionsbürgerschaft.
- Analyse der Entwicklung des staatsbürgerlichen Gedankens aus verschiedenen philosophischen Perspektiven, insbesondere der Vertragstheorie, der Gerechtigkeit, der Sittlichkeit und der Freiheit.
- Vertiefende Untersuchung der Definition der Staatsbürgerschaft in Bezug auf Rechte und Pflichten.
- Gegenüberstellung des theoretischen Modells der Staatsbürgerschaft mit dem praktischen Beispiel der Unionsbürgerschaft.
- Diskussion von Kritikpunkten und neuen Ansätzen im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaft.
- Beantwortung der Frage, inwieweit der philosophische Begriff der Staatsbürgerschaft in der gegenwärtigen politischen Praxis Anwendung findet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Staatsbürgerschaft in aktuellen politischen Debatten verdeutlicht und die Zielsetzung der Arbeit darlegt. In Kapitel 2 werden die wichtigsten philosophischen Perspektiven auf die Staatsbürgerschaft vorgestellt, darunter die Vertragstheorie (Hobbes, Locke, Rousseau), die Gerechtigkeit (Platon, Aristoteles, Rawls), die Sittlichkeit (Platon, Hegel) und die Freiheit (Kant, Mill). Es wird gezeigt, wie sich der Begriff der Staatsbürgerschaft in diesen philosophischen Ansätzen entwickelt hat und welche zentralen Aspekte dabei im Vordergrund stehen.
Kapitel 3 widmet sich der Unionsbürgerschaft als einem konkreten Beispiel für die praktische Umsetzung des staatsbürgerlichen Gedankens. Es werden die historische Entwicklung der Unionsbürgerschaft, ihre Definition sowie die ihr innewohnenden Rechte und Pflichten erläutert.
Kapitel 4 vergleicht die Unionsbürgerschaft mit der traditionellen Staatsbürgerschaft und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte.
Kapitel 5 diskutiert kritische Punkte und neue Ansätze im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaft. Hier werden verschiedene Perspektiven und Argumentationslinien vorgestellt, die die Gültigkeit und die Umsetzung des Staatsbürgerschaftskonzepts in Frage stellen.
Schlüsselwörter
Staatsbürgerschaft, Unionsbürgerschaft, Vertragstheorie, Gerechtigkeit, Sittlichkeit, Freiheit, Rechte, Pflichten, politische Praxis, theoretische Entwicklung, praktische Umsetzung, Vergleich, Kritik, neue Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Begriff der Staatsbürgerschaft historisch entwickelt?
Der Begriff entwickelte sich aus philosophischen Modellen der Vertragstheorie (Hobbes, Locke, Rousseau) sowie Konzepten von Gerechtigkeit (Aristoteles, Rawls) und Freiheit (Kant, Mill).
Was ist der Unterschied zwischen Staatsbürgerschaft und Unionsbürgerschaft?
Während die Staatsbürgerschaft an einen Einzelstaat gebunden ist, ergänzt die Unionsbürgerschaft diese um Rechte und Pflichten auf Ebene der Europäischen Union.
Welche Rechte und Pflichten sind mit der Unionsbürgerschaft verbunden?
Dazu gehören unter anderem das Aufenthaltsrecht, das Wahlrecht zum Europäischen Parlament sowie diplomatischer Schutz, aber auch bindende Pflichten gegenüber der Gemeinschaft.
Welche Rolle spielt die Gerechtigkeit im Konzept der Staatsbürgerschaft?
Gerechtigkeit dient als Maßstab für kooperierende Bürger. Die Arbeit beleuchtet Ansätze von Platon bis Rawls, um die Rechtfertigung staatlicher Ordnung zu erklären.
Wie wird die Unionsbürgerschaft in der politischen Praxis umgesetzt?
Die Umsetzung erfolgt durch Verträge von Schengen bis Lissabon, die den rechtlichen Rahmen für die Freizügigkeit und Teilhabe innerhalb der EU bilden.
- Quote paper
- M. A. Rita Hering (Author), 2011, Der philosophische Begriff der Staatsbürgerschaft in seiner theoretischen Entwicklung und dessen praktischer Umsetzung am Beispiel der Unionsbürgerschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188538