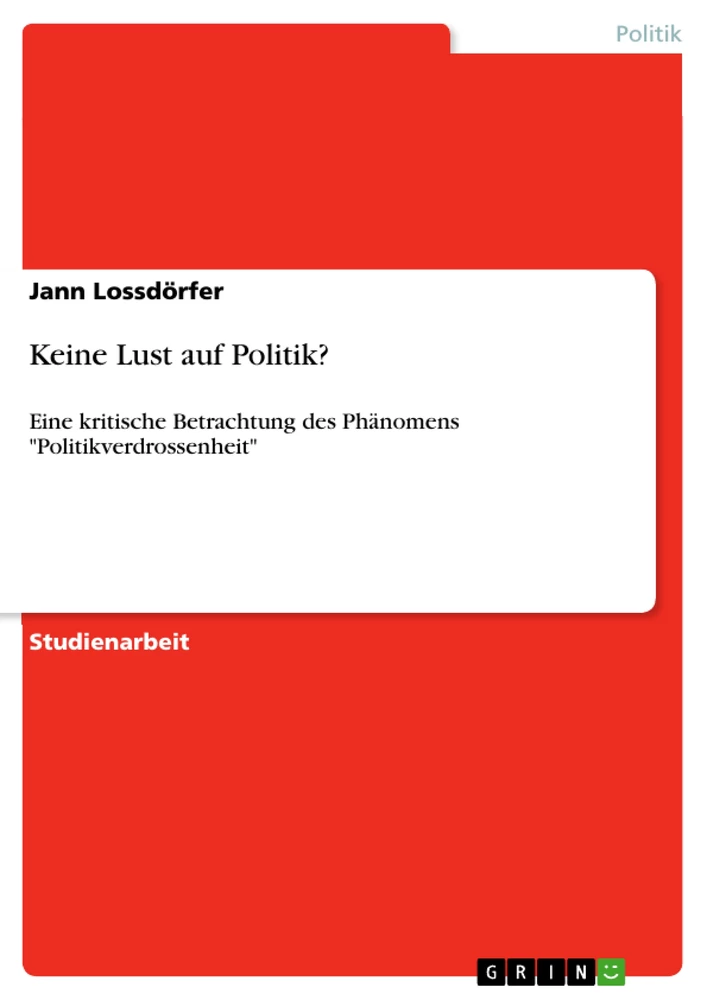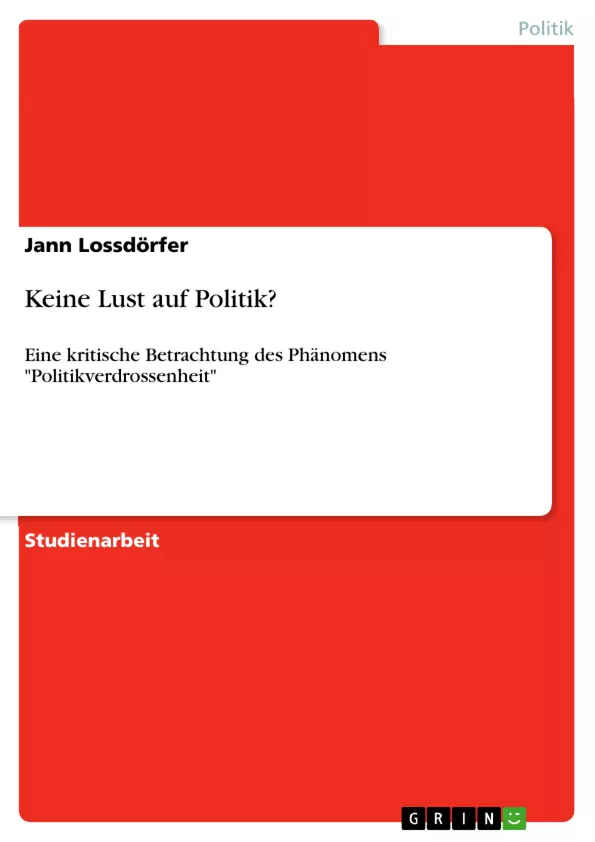Politikverdrossenheit hat Konjunktur. Insbesondere seit den 1990er Jahren ist in den Sozialwissenschaften eine breite Diskussion über die Frage entbrannt, was unter Politikverdrossenheit zu verstehen sei, woher sie komme und ob es sie überhaupt gibt, um nur einige der Diskussionspunkte herauszugreifen.
Ziel dieser Arbeit ist es, das „Phänomen Politikverdrossenheit“ zu untersuchen. Zunächst wird eine kritische Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit „Politikverdrossenheit“ gehen. Das ist hilfreich, weil der Begriff Politikverdrossenheit ein weit verbreiteter Überbegriff für eine Diskussion ist, in der viele unterschiedliche Erklärungsansätze in der Diskussion sind und Politikverdrossenheit nur einer für ähnliche Phänomene ist.
Den Hauptteil dieser Arbeit wird die kritische Diskussion von Symptomen und Ursachen sowie eine Bewertung einnehmen. Dazu werden unterschiedliche Studien und Aufsätze herangezogen.
In den meisten dieser Studien und Veröffentlichungen geht es bei der Untersuchung explizit um Einstellungen von Jugendlichen. Allein das unterstellt bereits, dass es sich um eine Politikverdrossenheit vor allem unter Jugendlichen handle. Daher soll in dieser Hausarbeit der Frage nachgegangen werden, ob diese Annahme richtig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Begriffsklärung und Vorbemerkung
- Symptome
- Ursachen
- Bewertung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Politikverdrossenheit und untersucht kritisch seine Definition, Symptome, Ursachen und Bewertung. Ziel ist es, das komplexe Verhältnis zwischen Mensch und dem Politischen im Kontext der Politikverdrossenheit zu beleuchten und verschiedene Studien und Publikationen zu analysieren. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Frage, ob die Annahme einer vorrangigen Politikverdrossenheit unter Jugendlichen zutrifft.
- Begriffliche Abgrenzung und Definition von Politikverdrossenheit
- Analyse der Symptome: Politisches Interesse, Wahlbeteiligung, Vertrauen in Institutionen und Engagement
- Untersuchung der Ursachen der Politikverdrossenheit
- Bewertung der Ergebnisse und der Relevanz der Politikverdrossenheit
- Kritische Auseinandersetzung mit der Annahme einer Jugend-Politikverdrossenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Politikverdrossenheit ein und erläutert den Hintergrund der Debatte sowie den wissenschaftlichen Kontext. Es wird die Zielsetzung der Arbeit definiert, die auf einer kritischen Untersuchung des Phänomens Politikverdrossenheit basiert.
Hauptteil
Begriffsklärung und Vorbemerkung
Dieser Abschnitt widmet sich der Definition von Politikverdrossenheit und der Klärung der Begrifflichkeit im Kontext der aktuellen Debatte. Es wird betont, dass der Begriff „Verdrossenheit“ nur ein Element des komplexen Phänomens darstellt und eine tiefergehende Analyse notwendig ist.
Symptome
Dieser Teil behandelt die wichtigsten Indikatoren der Politikverdrossenheit, wie das politische Interesse, die Wahlbeteiligung, das Vertrauen in Institutionen und die Bereitschaft zu Engagement. Es werden empirische Studien und ihre Ergebnisse vorgestellt, um die Symptome der Politikverdrossenheit zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe, die in dieser Arbeit behandelt werden, sind: Politikverdrossenheit, Politikdistanz, politisches Interesse, Wahlbeteiligung, Vertrauen in Institutionen, Engagement, Jugend-Politikverdrossenheit, empirische Forschung, Studien und Aufsätze.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Politikverdrossenheit?
Der Begriff beschreibt eine distanzierte oder negative Einstellung der Bürger gegenüber dem politischen System, den Parteien oder Politikern.
Sind vor allem Jugendliche politikverdrossen?
Die Arbeit hinterfragt diese gängige Annahme kritisch und untersucht, ob sich die Einstellungen von Jugendlichen tatsächlich von denen Erwachsener unterscheiden.
Was sind typische Symptome von Politikverdrossenheit?
Dazu zählen sinkendes politisches Interesse, abnehmende Wahlbeteiligung und ein schwindendes Vertrauen in staatliche Institutionen.
Gibt es einen Unterschied zwischen Politik- und Parteienverdrossenheit?
Ja, oft richtet sich der Unmut spezifisch gegen die Parteien und deren Akteure, während das Interesse an politischen Sachthemen bestehen bleibt.
Welche Ursachen werden für dieses Phänomen diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem mangelnde Transparenz, unerfüllte Versprechen der Politik sowie gesellschaftliche Individualisierungsprozesse.
- Citation du texte
- Jann Lossdörfer (Auteur), 2012, Keine Lust auf Politik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188560