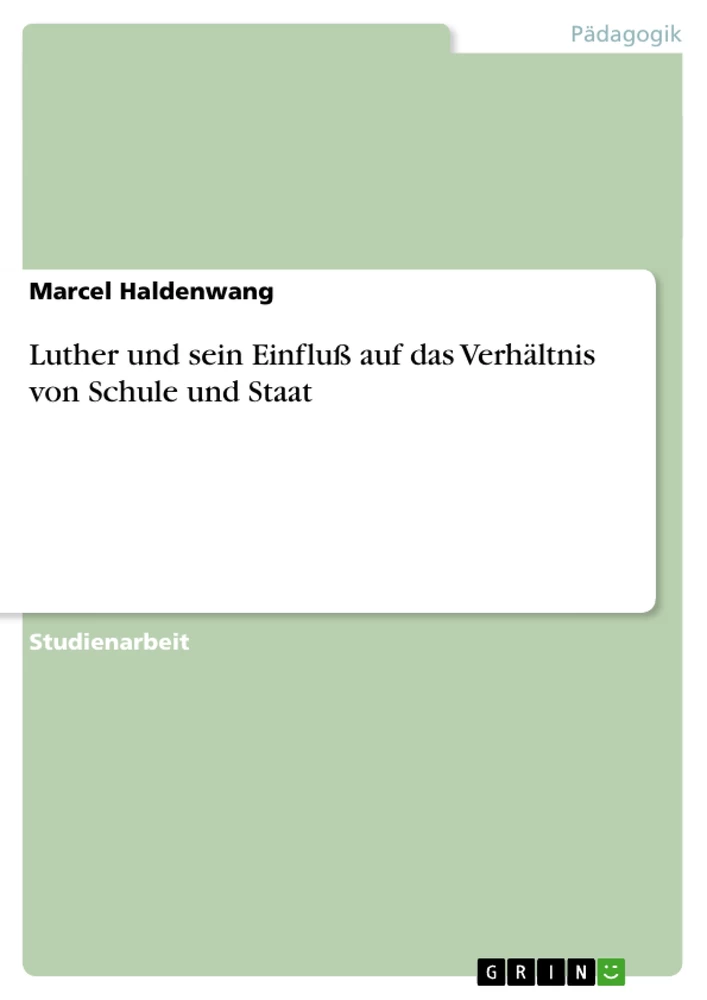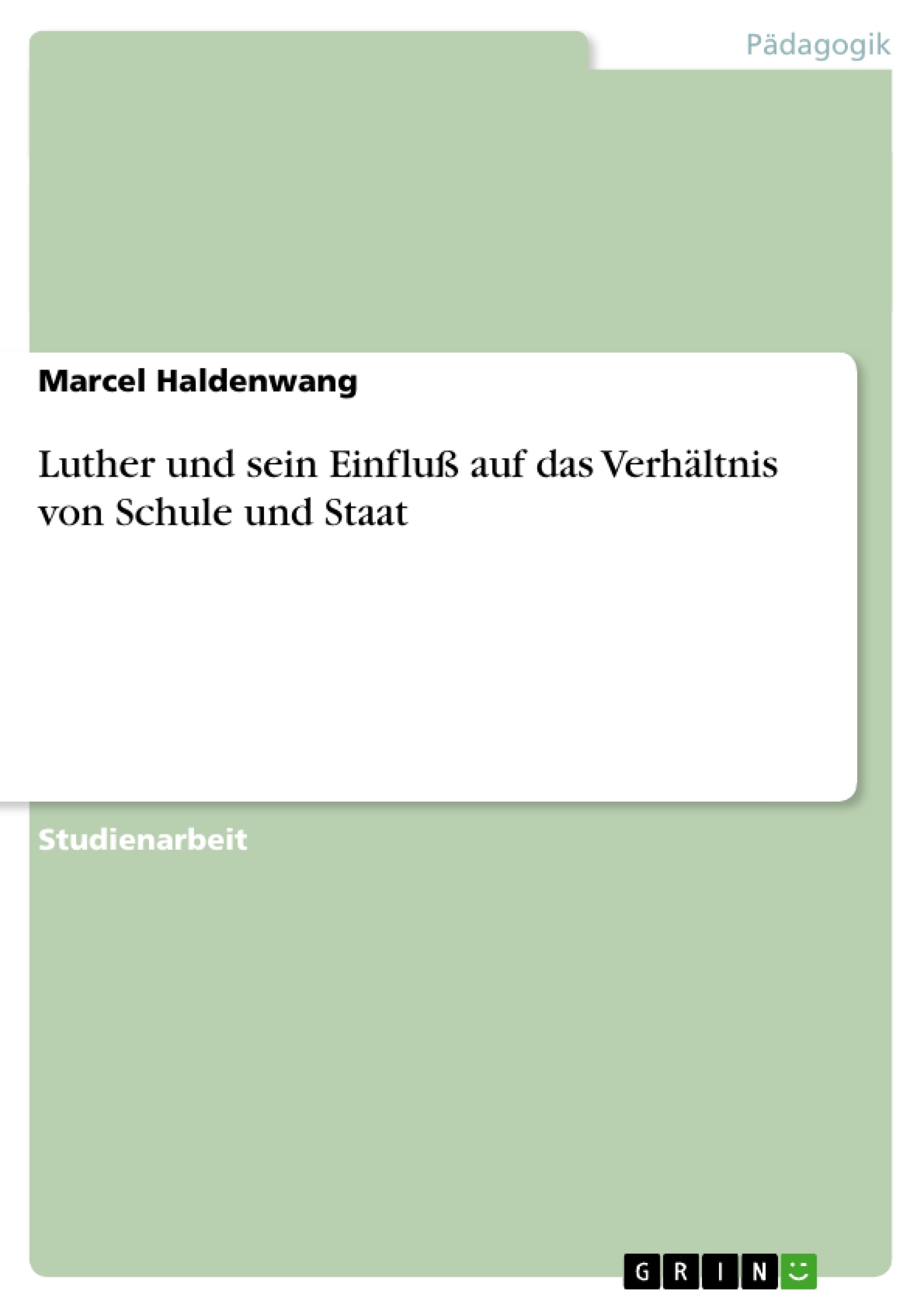"Schulboykott", "Homeschooling" - diese Begriffe waren kürzlich auf den Titelseiten der Tageszeitung zu lesen. Es besteht also Anlass dazu, das Verhältnis von Schule, Staat und Familie einmal kritisch in Augenschein zu nehmen. Heuristisches Instrument bei dem Versuch, zu einer eigenen Überzeugung in dieser Frage zu gelangen, soll hier die historische Perspektive sein, nämlich der große Pädagoge Luther.
Inhaltsübersicht
- Einleitung
- Die Situation des Schulwesens zur Reformationszeit
- Ausfall der Klosterschulen
- Ausfall der Unterhaltsbasis der fahrenden Scholaren
- Motivationsschwäche
- Luthers Einschätzung von Bildung und sein Interesse an der Schule
- Luthers Schriftprinzip
- Luthers allgemeines Priestertum
- Luthers Verhältnis zur Wissenschaft, zum Humanismus und zur Scholastik
- Konfessionalisierung
- Luthers Schulschrift von 1524
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Einfluss Martin Luthers auf die Entwicklung des Verhältnisses von Schule und Staat. Sie untersucht die Gründe für den Wandel von der kirchlichen zur staatlichen Kontrolle des Schulwesens und beleuchtet Luthers eigene Überzeugungen hinsichtlich Bildung.
- Die Situation des Schulwesens in der Reformationszeit
- Luthers Sichtweise auf Bildung und seine pädagogischen Gedanken
- Die Rolle der Obrigkeit im Schulwesen nach Luthers Reform
- Der Einfluss von Luthers Schrift "An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes" auf die Entwicklung des Schulwesens
- Die Folgen von Luthers Reformen für die Beziehung zwischen Kirche und Staat im Bereich der Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Aktualität der Debatte um die Kulturhoheit in Deutschland. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Luther den Wandel des Schulwesens von der Kirche zur Obrigkeit beeinflusst hat.
Das erste Kapitel beleuchtet die schwierige Situation des Schulwesens zur Reformationszeit. Es geht auf den Ausfall der Klosterschulen, die Unterhaltsprobleme fahrender Scholaren und die mangelnde Motivation der Schüler ein.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Luthers Einstellung zu Bildung und seinen pädagogischen Ideen. Es analysiert seine Schriften und erläutert seine Auffassung vom Schriftprinzip, dem allgemeinen Priestertum und seinem Verhältnis zu Wissenschaft, Humanismus und Scholastik.
Das dritte Kapitel behandelt Luthers "Schulschrift" von 1524, in der er die Obrigkeit dazu aufruft, christliche Schulen zu errichten und zu unterhalten.
Schlüsselwörter
Luther, Reformation, Schulwesen, Bildung, Obrigkeit, Kirche, Staat, Konfessionalisierung, Lateinschule, Schulschrift, "An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes", Geschichte der Bildung, Pädagogik.
- Quote paper
- Marcel Haldenwang (Author), 2001, Luther und sein Einfluß auf das Verhältnis von Schule und Staat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18857