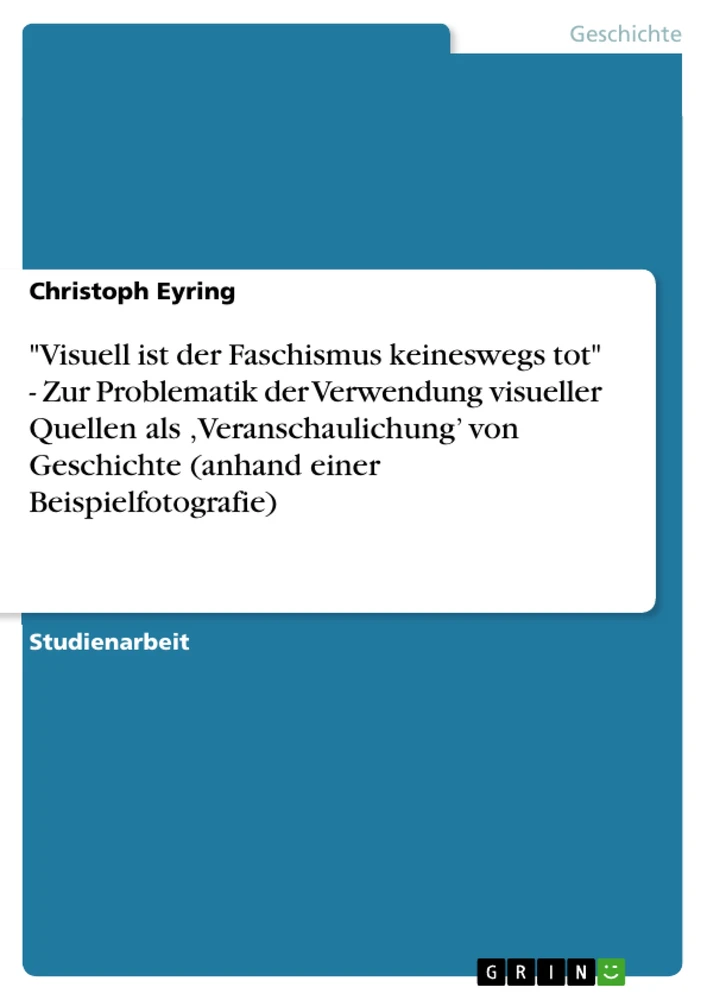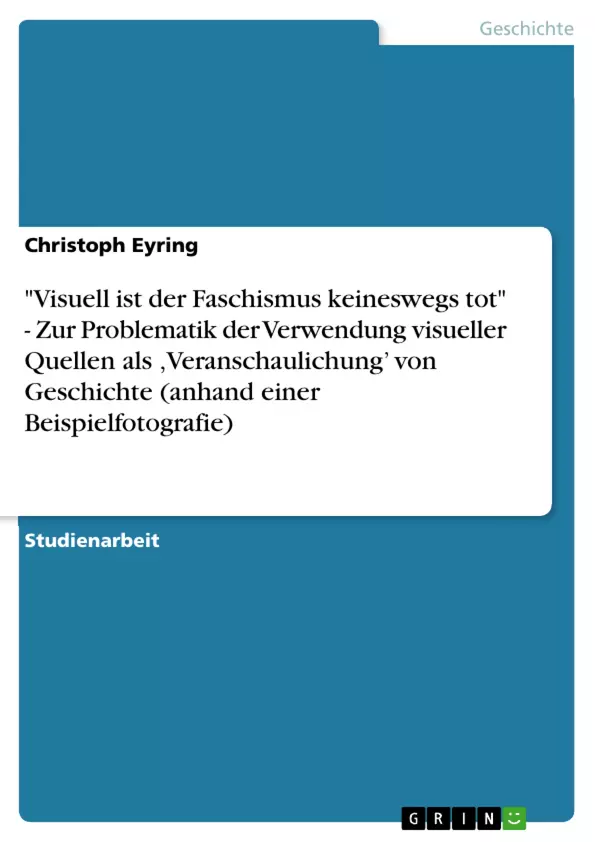Die (Geschichts-)Forschung hat in den letzten Jahrzehnten eine Fülle an Publikationen hervorgebracht, die sich beschäftigen mit der Fotografie ,als solcher’ und mit der Frage der Verwendbarkeit von Fotografien als historische Quellen. Philosophische Ansätze existieren neben praktisch orientierten. „Der Macht und der Masse der Bilder nicht nur mit kulturkritischer Resignation zu begegnen ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der sich auch die Geschichtswissenschaft nicht entziehen darf.“ Gegenstand der Untersuchungen ist oft auch die Frage, inwiefern sich das Medium Fotografie verwenden lässt, um mit seiner Hilfe Geschichte zu ,veranschaulichen’.
Besonders problematisch erscheint ein unreflektierter Umgang mit Fotografien, wenn diese zur ,Veranschaulichung’ nationalsozialistischer Geschichte herangezogen werden. Gerhard Paul konstatiert: „Nicht aus der Analyse von Reden und programmatischen Schriften, nicht mit den Mitteln der Ideologiekritik läßt sich das Wesen des deutschen Faschismus erfassen, sondern aus seinen öffentlichen Bildern und Inszenierungen.“ Weiterhin heißt es bei ihm: „Da die Bilder von damals nicht begriffen sind, werden sie kritiklos tradiert und mit ihnen ihre emotionale Faszinationskraft und die in ihnen enthaltenen Deutungs- und Orientierungsmuster. Visuell ist der Faschismus keineswegs tot.“
Inwiefern nationalsozialistische Deutungsmuster dadurch tradiert werden, dass Fotografien zur bloßen ,Veranschaulichung’ von Geschichte herangezogen werden, während eine differenzierte Analyse der Wirkungsmacht der Fotografie sowie von ihrem ,Status’ (vor allem innerhalb des Gesamtzusammenhangs, welcher in der Regel auch Text sowie weitere Quellen beinhaltet) ausbleibt, möchte ich im Folgenden beispielhaft ausführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Fotografie
- 3. Bedeutungsgebung durch die Bildbeschriftung
- 4. Die Suggestivkraft der Fotografie
- 5. Die Fotografie und ihr propagandistischer Charakter
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Problematik der Verwendung von Fotografien als „Veranschaulichung“ von Geschichte am Beispiel einer Fotografie, die die Entstehung der nationalsozialistischen Diktatur illustrieren soll. Sie untersucht die Suggestivkraft und den propagandistischen Charakter des Bildes und hinterfragt, inwiefern es nationalsozialistische Deutungsmuster tradiert.
- Die Verwendung von Fotografien in der Geschichtswissenschaft
- Die Rolle der Bildbeschriftung in der Deutung von Fotografien
- Die Tradition nationalsozialistischer Deutungsmuster durch die Fotografie
- Der „Status“ der Fotografie im Gesamtzusammenhang des Kapitels
- Die Gefahr der unreflektierten Verwendung von Bildern in der Geschichtsvermittlung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Der Autor stellt die Problematik der Verwendung von Fotografien als historische Quellen dar und beleuchtet die Bedeutung der Kontextualisierung von Bildern.
- Kapitel 2: Die Fotografie: Die Arbeit analysiert die Fotografie im Detail und stellt fest, dass sie zwar die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler visualisieren soll, aber keine eindeutige Aussage über das tatsächliche Ereignis macht.
- Kapitel 3: Bedeutungsgebung durch die Bildbeschriftung: Die Arbeit untersucht die Rolle der Bildbeschriftung bei der Interpretation der Fotografie und zeigt, wie diese die Bedeutung des Bildes prägt.
- Kapitel 4: Die Suggestivkraft der Fotografie: Der Autor analysiert die Suggestivkraft des Bildes und stellt fest, dass es dem Betrachter nationalsozialistische Deutungsmuster suggeriert.
- Kapitel 5: Die Fotografie und ihr propagandistischer Charakter: Die Arbeit untersucht den propagandistischen Charakter des Bildes und zeigt, wie es zur Tradition nationalsozialistischer Deutungsmuster beitragen kann.
Schlüsselwörter
Fotografie, Geschichte, Veranschaulichung, Nationalsozialismus, Deutungsmuster, Propaganda, Tradition, Kontextualisierung, Bildbeschriftung, Suggestivkraft.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Verwendung von Fotos als historische Quellen problematisch?
Fotos werden oft nur zur „Veranschaulichung“ genutzt, ohne ihre propagandistische Wirkung oder ihren Entstehungskontext zu hinterfragen. Dies kann dazu führen, dass historische Deutungsmuster ungeprüft übernommen werden.
Was bedeutet die Aussage „Visuell ist der Faschismus keineswegs tot“?
Gerhard Paul weist damit darauf hin, dass nationalsozialistische Inszenierungen und Bilder bis heute eine faszinierende Wirkung entfalten können, wenn sie nicht kritisch analysiert und dekonstruiert werden.
Welche Rolle spielt die Bildbeschriftung bei historischen Fotos?
Die Bildbeschriftung lenkt die Interpretation des Betrachters. Sie gibt dem Bild oft erst eine eindeutige Bedeutung, die das Foto allein vielleicht gar nicht hergeben würde, und trägt so zur Mythenbildung bei.
Wie wird Propaganda durch Fotografie erzeugt?
Propaganda nutzt die Suggestivkraft von Bildern, um bestimmte Emotionen und Orientierungsmuster zu wecken. Im Nationalsozialismus wurden Fotos gezielt inszeniert, um Macht und Einheit zu suggerieren.
Was ist der „Status“ einer Fotografie im historischen Kontext?
Der Status bezieht sich auf die Funktion des Bildes innerhalb eines Gesamtzusammenhangs (z. B. in einem Schulbuch). Es muss geklärt werden, ob das Bild ein Beleg für ein Ereignis oder lediglich ein Produkt zeitgenössischer Inszenierung ist.
- Quote paper
- Christoph Eyring (Author), 2011, "Visuell ist der Faschismus keineswegs tot" - Zur Problematik der Verwendung visueller Quellen als ,Veranschaulichung’ von Geschichte (anhand einer Beispielfotografie), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188635