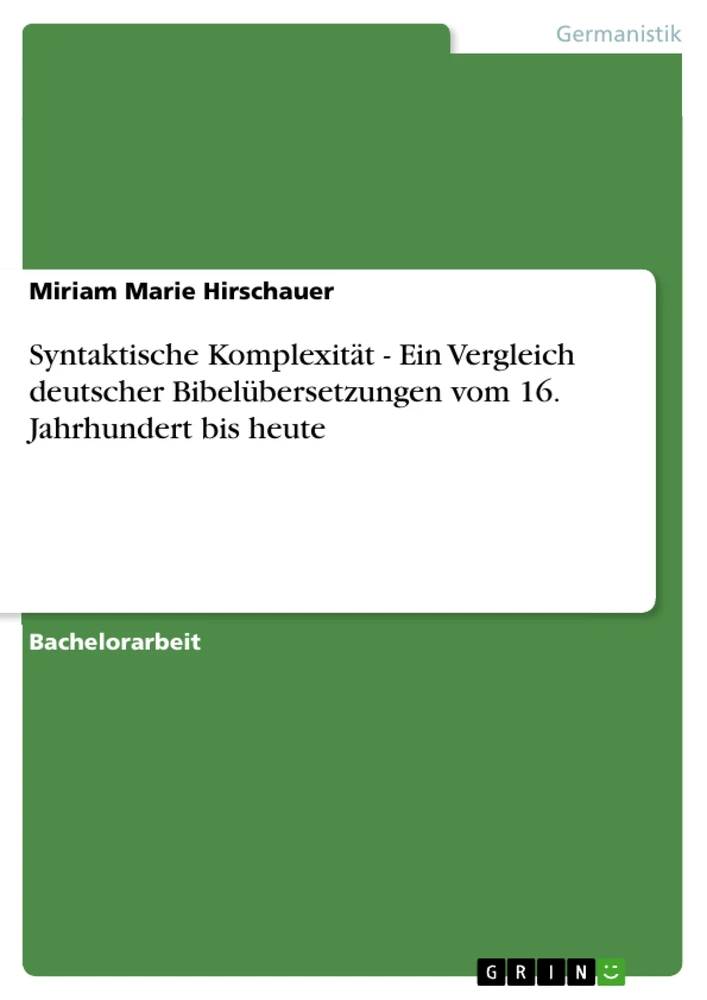Die BIBEL zu lesen, kann ganz schön langweilig sein. Allerdings liegt dieser Umstand nicht
daran, dass einen der Inhalt möglicherweise nicht anspricht. Sondern daran, dass man eine
klassische Übersetzung vor sich hat, in der vor allem ein Wort auffällt: und. Dies legt die
Vermutung nahe, dass zu der Zeit, in der diese Übersetzung geschrieben wurde, nicht viel
Wert auf syntaktische Varianz gelegt wurde. Oder aber es gab noch nicht so viele
unterschiedliche Konjunktionen beziehungsweise die Möglichkeit, komplizierte Sachverhalte
in Satzgefügen auszudrücken.
Heutzutage gilt es nicht als besonders gehoben, wenn man seine Sätze in schriftlichen
Ausarbeitungen zum Großteil nur mit und verknüpft. Im Gegenteil; es werden die
unterschiedlichsten Gliedsätze und Konjunktionen verwendet.
Auf der Grundlage dieser subjektiven Beobachtungen soll nun die Hypothese formuliert
werden, von welcher die folgenden Untersuchungen ihren Ausgang nehmen: Vom 16.
Jahrhundert bis heute ist die Sprache immer komplexer geworden. Diesen Aspekt kann
man anhand der Satzstruktur erkennen; früher wurden mehr Parataxen, heute mehr
Hypotaxen verwendet.
Der Beweis dieser Behauptung soll mittels BIBELübersetzungen erbracht werden. Denn
die BIBEL eignet sich insofern gut als Untersuchungsobjekt für eine diachrone Betrachtung,
als sie ihren Inhalt nicht verändert. In dieser Arbeit werden von LUTHERs Übersetzungen
bis heute nur solche verwendet, die den Anspruch haben, nach der jeweils zeitgemäß
modernen Sprache geschrieben worden zu sein. Jeweils drei Stichproben aus diesen
Übersetzungen werden dann auf die Häufigkeit von Nebensätzen und deren Komplexitätsgrad
hin analysiert, sowie auf den Gebrauch von Konjunktionen. Umfassender
wäre ein Vergleich der gesamten BIBEL oder von ganzen Büchern aus dem Neuen und
Alten Testament. Doch der Umfang dieser Arbeit lässt leider nur eine Analyse mit
möglichst repräsentativen Stichproben zu.
Dafür werden zunächst einmal die herangezogenen BIBELübersetzungen vorgestellt und
die Intentionen ihrer Autoren erläutert. Der Vergleich der Stichproben erfolgt tabellarisch
und wird nach einer Auswertung in einen sprachhistorischen Kontext gestellt. Um ein Fazit
ziehen zu können, wird zudem kurz diskutiert, wie sich sprachliche Verständlichkeit auswirkt und ob diese im Widerspruch zu sprachlicher Komplexität steht. Zum Schluss
wird die eingangs gestellte Hypothese auf Grundlage der Untersuchung und der
sprachhistorischen Erkenntnisse überprüft und ein Ergebnis gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorstellung der untersuchten BIBELübersetzungen vom 16. Jahrhundert bis heute
- 3. Vergleich
- 3.1 Tabellarische Untersuchung von je drei Stichproben
- 3.1.1 LUTHER 1545
- 3.1.2 LUTHER 1912
- 3.1.3 LUTHER 1984
- 3.1.4 ELBERFELDER 1871
- 3.1.5 ELBERFELDER 2006
- 3.1.6 ZÜRCHER 2007
- 3.1.7 KATHOLISCHE EINHEITSÜBERSETZUNG 1980
- 3.1.8 VOLXBIBEL ab 2004
- 3.2 Gesamtauswertung
- 4. Sprachhistorischer Bezug
- 4.1 Zur sprachlichen Situation im 16. Jahrhundert
- 4.2 Zur Entwicklung des Satzbaus vom 16. Jahrhundert an
- 4.3 Zur Entwicklung von Konjunktionen vom 16. Jahrhundert an
- 4.3.1 Die semantische Veränderung einzelner Konjunktionen
- 4.4 Zu LUTHERS Sprache
- 5. Betrachtung des Ergebnisses auf Grundlage der Sprachgeschichte - Schlussdiskussion und Zusammenfassung
- 5.1 Einbettung der BIBELübersetzungen in ihren jeweiligen historischen Kontext
- 5.2 Sprachliche Komplexität - sprachliche Verständlichkeit. Ein Konflikt?
- 5.3 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der syntaktischen Komplexität in deutschen Bibelübersetzungen vom 16. Jahrhundert bis heute. Ziel ist es, die Hypothese zu belegen, dass die Sprache im Laufe der Zeit komplexer geworden ist, was sich an der zunehmenden Verwendung von Hypotaxen im Vergleich zu Parataxen zeigt.
- Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen hinsichtlich ihrer syntaktischen Struktur
- Analyse der Häufigkeit von Nebensätzen und deren Komplexitätsgrad
- Untersuchung des Gebrauchs von Konjunktionen
- Einordnung der sprachlichen Entwicklung in den historischen Kontext
- Beziehung zwischen sprachlicher Komplexität und Verständlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Hypothese vor, die im Laufe der Arbeit untersucht werden sollen. Kapitel 2 bietet eine Vorstellung der untersuchten Bibelübersetzungen vom 16. Jahrhundert bis heute, wobei der Fokus auf den Anspruch der Übersetzungen liegt, in zeitgemäßer Sprache verfasst zu sein. Kapitel 3 führt einen tabellarischen Vergleich der ausgewählten Übersetzungen durch, analysiert die Häufigkeit von Nebensätzen und Konjunktionen und stellt die Ergebnisse in einer Gesamtauswertung dar. Kapitel 4 setzt die sprachlichen Beobachtungen in einen sprachhistorischen Kontext, indem es die Entwicklung des Satzbaus und der Konjunktionen vom 16. Jahrhundert bis heute beleuchtet. Das letzte Kapitel (5) diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung und ihre Implikationen für die sprachliche Verständlichkeit und Komplexität. Abschließend wird die eingangs gestellte Hypothese auf Grundlage der Untersuchung und der sprachhistorischen Erkenntnisse überprüft und ein Ergebnis gestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen syntaktische Komplexität, Bibelübersetzungen, Sprachgeschichte, deutsche Sprache, Satzstruktur, Hypotaxen, Parataxen, Konjunktionen, Verständlichkeit und historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Ist die deutsche Sprache im Laufe der Zeit komplexer geworden?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass die Satzstruktur von parataktischen (einfachen) zu hypotaktischen (komplexen) Gefügen zugenommen hat.
Warum eignen sich Bibelübersetzungen für Sprachvergleiche?
Bibelübersetzungen sind ideal, da der Inhalt über Jahrhunderte gleich bleibt, während sich die Sprache der Übersetzung dem jeweiligen Zeitgeist anpasst.
Wie unterschied sich Luthers Sprache von modernen Übersetzungen?
Luthers Sprache im 16. Jh. nutzte oft einfachere Satzverknüpfungen (z.B. das häufige "und"), während moderne Fassungen variablere Konjunktionen nutzen.
Was ist die Volxbibel?
Die Volxbibel ist eine moderne Übertragung in Jugendsprache, die in der Arbeit als Beispiel für zeitgemäße sprachliche Anpassung analysiert wird.
Steht sprachliche Komplexität im Widerspruch zur Verständlichkeit?
Das ist ein zentraler Diskussionspunkt: Während komplexe Sätze präziser sein können, fördern einfache Strukturen oft die unmittelbare Verständlichkeit.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Miriam Marie Hirschauer (Auteur), 2011, Syntaktische Komplexität - Ein Vergleich deutscher Bibelübersetzungen vom 16. Jahrhundert bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188785