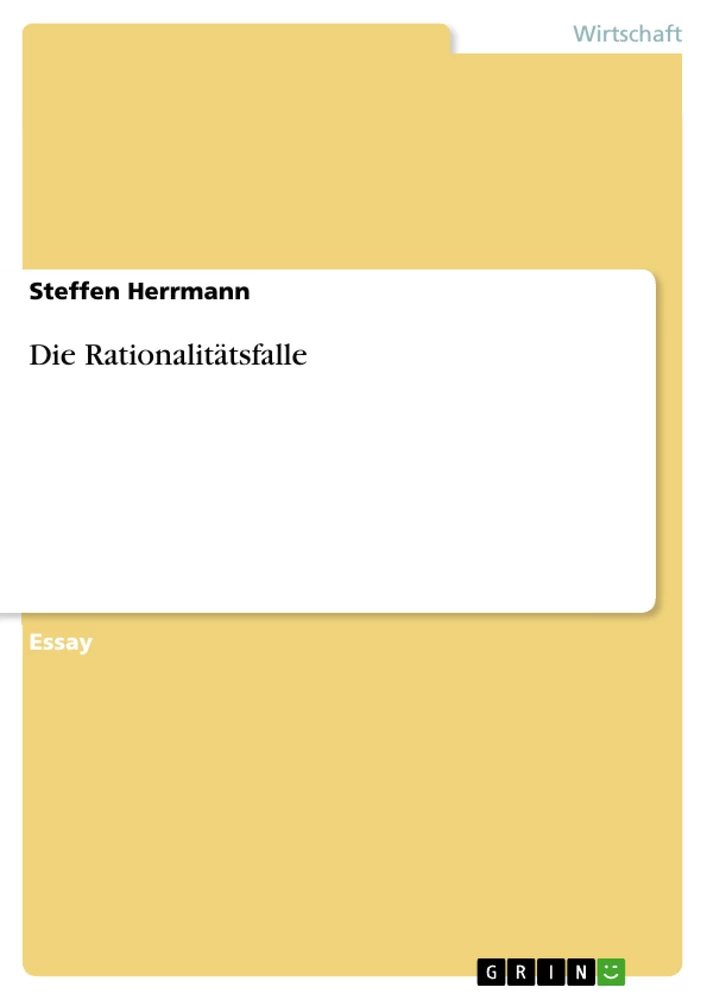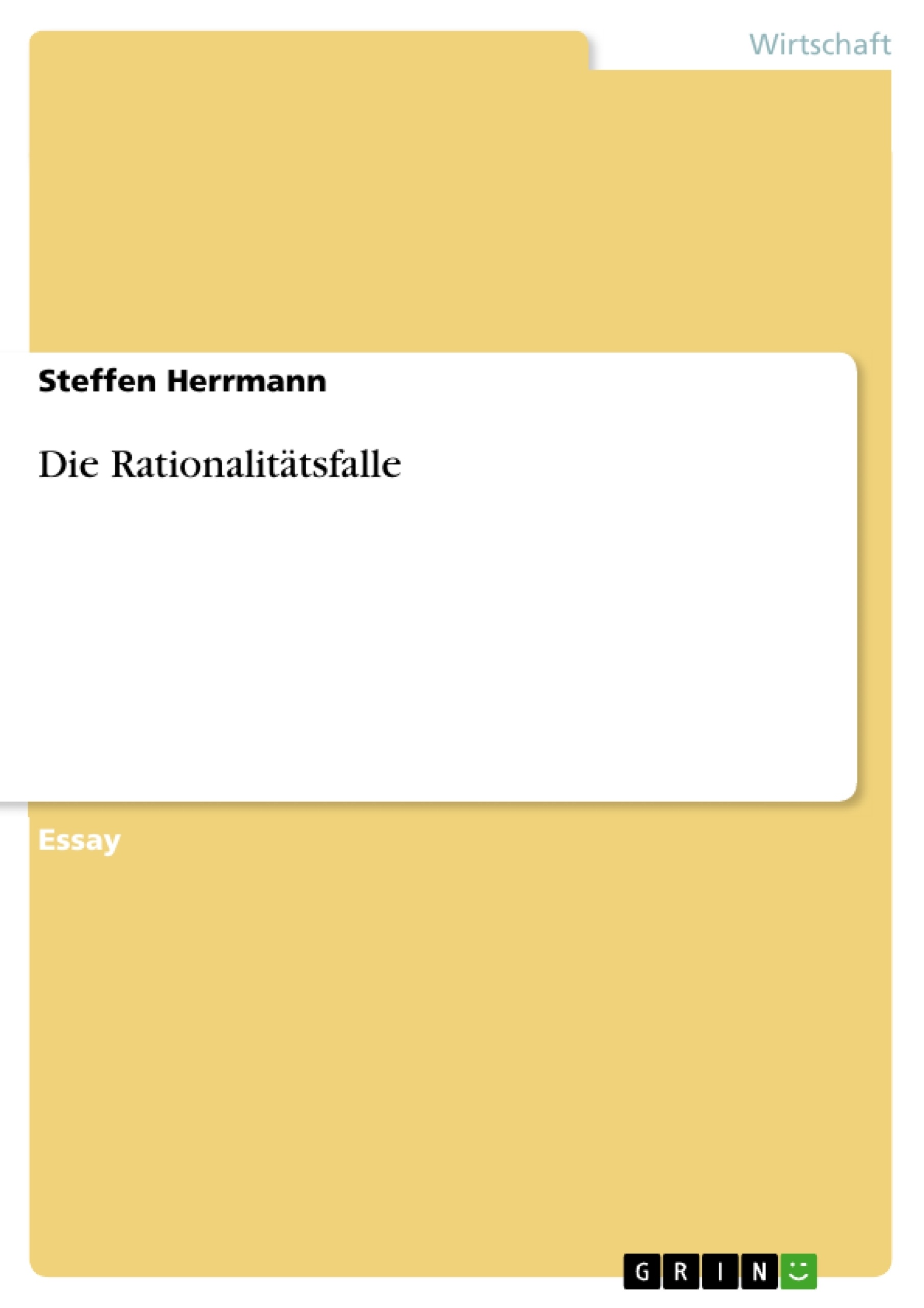Der Essay untersucht mit systemtheoretischen Methoden die Struktur einer Wachstumskrise, in die Unternehmen geraten können, wenn sie eine kritische Grösse erreichen, bei der eine primär auf Interaktion beruhende Unternehmenskultur ineffizient wird und eine auf Organisation basierende Struktur nötig wird.
Die Rationalitätsfalle
1. Einleitung
Der folgende Aufsatz handelt von einer paradoxen Situation, in die Organisationen geraten können. Die Situation besteht darin, dass alle Operationen des Systems einem Ziel untergeordnet werden, die Organisation aber gerade an diesem selbstgesetzten Ziel scheitert.
(Eine politische Partei ordnet alles dem Machterwerb unter, landet aber in der Bedeutungslosigkeit. Eine NGO will um jeden Preis moralisch gut sein, vermehrt aber die Not. Eine Gruppe will nichts als Wissen erwerben und erzeugen, bleibt aber unfruchtbar. Ein Unternehmen sucht den unbedingten ökonomischen Erfolg, rutscht aber immer tiefer in die roten Zahlen.)
Ich untersuche die Rationalitätsfalle des ökonomischen Typs, weil sie am leichtesten zu behandeln und auch am häufigsten zu sein scheint.
2. Der Ausgangspunkt
In die Rationalitätsfalle geraten ausschliesslich mittelgrosse Unternehmen, Betriebe also, die nicht mehr in familiärer Weise organisiert werden können, aber auch noch keine Konzernstruktur entwickelt haben.
Grossbetriebe dagegen sind voll ausdifferenziert. Die einzelnen Funktionssysteme stehen zwar unter dem Primat des Ökonomischen, besitzen aber ihre jeweilige Autonomie, die von den spezifischen symbolischen Medien perpetuiert wird. Die Entscheidungs- und Machtstrukturen sind geronnen; die Rechtsicherheit innerhalb der Firma ist gewährleistet, eventuell durch Gewerkschaften und Betriebsräte flankiert; das Vertrauen, das die Produkte oder die Dienstleistungen geniessen, wirkt in die Organisation hinein; der Erwerb und die Verteilung von Wissen ist organisiert. Ein Grossbetrieb kann Fehler machen, sogar schwere Fehler, aber er neigt nicht zur Institutionalierung von Panik, weil die verschiedenen Kontroll- und Regelinstanzen zu ausgeprägt sind.Ein Unternehmen kann nur gross werden, wenn es ziemlich lange ziemlich viel richtig gemacht hat.
Ein Kleinbetrieb unterliegt einer rigiden Kontrolle durch den Markt. Die Fehlertoleranz seiner Umwelt ist gering. Er kann zunächst wachsen, ohne seine Struktur wesentlich zu verändern.
Ein Kleinunternehmen ist grundsätzlich ein Interaktionssytem. Es beruht darauf, dass jeder jeden kennt und die betrieblichen Handlungen direkt aus persönlichen Kommunikationen folgen. Die kaum ndifferenzierte Interaktionsstruktur wird durch ein Zentrum-Peripherie Schema ergänzt (das sich zu einer Herr-Knecht Situation zuspitzen kann). Im Zentrum steht eine zumeist integere und bisweilen charismatische Person, nicht selten der Gründer der Firma.
Ein gesellschaftliches System, das zwischen Interaktion und Zentrum-Peripherie-Schema oszilliert und dabei dynamisch funktionale Differenzierungen erzeugen und auch wieder löschen kann, das ist ein Team. Ein Kleinbetrieb ist in dieser Hinsicht ein Team.
Es gibt hier Mechanismen, die die Verteilung von Geld, Macht, Vertrauen, Einfluss und Wissen steuern, doch die symbolischen Medien sind nicht gegeneinander ausdifferenziert, die Funktionen bleiben (da Interaktionssysteme dominieren) in den Personen inkarniert.
3. Die Wachstumskrise
Wenn die Firma wächst, kommt es zu einem Punkt, an dem diese Struktur an ihre Grenzen kommt. Das Unternehmen gerät immer mehr in den Druck, Organisation aufzubauen. Am augenscheinlichsten betrifft das die Position des personalen Zentrums. Der Chef muss sich selbst als ersetzbar institutionalisieren, sonst wäre das Überleben der Firma gefährdet und Wachstum bald unmöglich. Es erfolgt der Umschlag in eine Struktur, die vor allem auf Organisation beruht. Denn in dem Moment, da selbst der Firmengründer nur noch eine Position innehat, die prinzipiell austauschbar ist, schlägt die interaktiv dominierte Struktur in einen Primat der Organisation um.
Das ist die Situation einer Krise, die bemerkenswert zäh sein und ein Unternehmen über Jahre beschäftigen kann. Es ist dann ständig mit sich selbst beschäftigt, innere Umstrukturierungen folgen aufeinander, ohne dass sich ein Ende dieser Nervosität abzeichnet.
Die Gefahr dieser Orientierungslosigkeit ist beträchtlich und es bietet sich als Lösung an, die unternehmerischen Entscheidungen unter den Primat der Ökonomie zu stellen. Das mag als Trivialität erscheinen, weil ein Betrieb nun einmal dazu da ist, Geld zu verdienen. Der entscheidende Punkt besteht in der Radikalität dieser Ausrichtung. Es geht also um eine Unternehmensstrategie, der es NUR darum geht, Geld einzufahren und die das (zwar bisweilen verblümt, doch verständlich) auch so kommuniziert. Eine solche Reduktion der inneren Kultur mag als eine rationale Wende erscheinen und bietet sich als Ausweg einer vielleicht schon länger andauernden oder sich rasch zuspitzenden Krise an, doch sie wird das ursprüngliche Problem verschlimmern.
Die Paradoxie besteht darin, dass die Strategie gerade an ihren eigenen Zielen scheitert. Das Unternehmen wird nicht sozial kalt, aber wirtschaftlich erfolgreich, es scheitert gerade in seinem Ökonomismus. Je rigider die ökonomische Engführung, desto katastrophaler die Bilanzen.
Wenn man wissen will, warum das so ist, muss man auch wissen, welche Art von Betrieben die Wachstumskrise befällt.
Relativ resistent sind segmentierte Wirtschaftsbereiche. Mit dem Wachstum entstehen Klone des ursprünglichen Unternehmens, die alle ähnlich funktionieren. Es bilden sich zwar mit zunehmender Grösse Hierarchieebenen über den Segmenten, doch es bleibt viel von der ursprünglichen Operationalität unangetastet. Restaurant- und Hotelketten, Werkstätten, Bäckereien, Reisebüros – hier dominieren segmentierte Wirtschaftsformen, bei denen unter Umständen der Durchmarsch vom Kleinunternehmen zum Konzern ohne vitale Wachstumskrise möglich ist. ALDI ist noch heute ein Familienunternehmen.
Auf der anderen Seite stehen Betriebe, die hochspezialisierte Produkte anbieten. Diese geraten in die Situation, dass relativ rasch ihre Eigenständigkeit verlorengeht. Der Verlust an Autonomie geht mit einem Gewinn an Sicherheit einher. Sie werden zu Zulieferern von Konzernen, zu deren privilegierten Partnern oder aufgekauft.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Die Rationalitätsfalle"?
Der Aufsatz behandelt eine paradoxe Situation, in die Organisationen geraten können: Alle Operationen des Systems werden einem Ziel untergeordnet, die Organisation scheitert aber gerade an diesem selbstgesetzten Ziel.
Welche Art von Unternehmen geraten in die Rationalitätsfalle?
Ausschliesslich mittelgrosse Unternehmen, die nicht mehr familiär organisiert sind, aber auch noch keine Konzernstruktur entwickelt haben.
Warum sind Grossbetriebe weniger anfällig für die Rationalitätsfalle?
Grossbetriebe sind voll ausdifferenziert. Die einzelnen Funktionssysteme stehen zwar unter dem Primat des Ökonomischen, besitzen aber ihre jeweilige Autonomie, die von den spezifischen symbolischen Medien perpetuiert wird. Entscheidungsprozesse sind stabil und es gibt etablierte Kontrollinstanzen.
Warum sind Kleinbetriebe weniger anfällig für die Rationalitätsfalle?
Kleinbetriebe unterliegen einer rigiden Kontrolle durch den Markt und sind stark von persönlichen Interaktionen geprägt. Die Fehlertoleranz ihrer Umwelt ist gering.
Was passiert in der Wachstumskrise?
Wenn ein Unternehmen wächst, stösst die ursprüngliche Struktur an ihre Grenzen. Es entsteht Druck, Organisation aufzubauen. Das persönliche Zentrum (Chef) muss sich selbst als ersetzbar institutionalisieren. Es erfolgt ein Umschlag in eine Struktur, die vor allem auf Organisation beruht.
Was ist das Problem, wenn Unternehmen in der Wachstumskrise den Primat der Ökonomie setzen?
Die Strategie, sich NUR auf den ökonomischen Erfolg zu konzentrieren, scheitert an ihren eigenen Zielen. Je rigider die ökonomische Engführung, desto katastrophaler die Bilanzen.
Welche Unternehmen sind relativ resistent gegen die Wachstumskrise?
Segmentierte Wirtschaftsbereiche, bei denen mit dem Wachstum Klone des ursprünglichen Unternehmens entstehen, die alle ähnlich funktionieren (z.B. Restaurantketten, Bäckereien).
Was passiert mit hochspezialisierten Unternehmen?
Diese Unternehmen verlieren relativ rasch ihre Eigenständigkeit und werden zu Zulieferern von Konzernen, zu deren privilegierten Partnern oder aufgekauft.
Welche Art von Unternehmen hat die grössten Probleme in der Wachstumskrise?
Unternehmen, die so komplex sind, dass ihrer Segmentierung enge Grenzen gesetzt sind. Jedes Wachstum zieht Umstrukturierungen nach sich, wobei die Sekundärdynamiken dieser Veränderungen so ausgeprägt sein können, dass sie weiteres Wachstum gefährden. Diese Firmen sind auch so sperrig, dass sie von Konzernen zwar verschluckt, aber nicht verdaut werden können.
- Citar trabajo
- Steffen Herrmann (Autor), 2012, Die Rationalitätsfalle, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188846